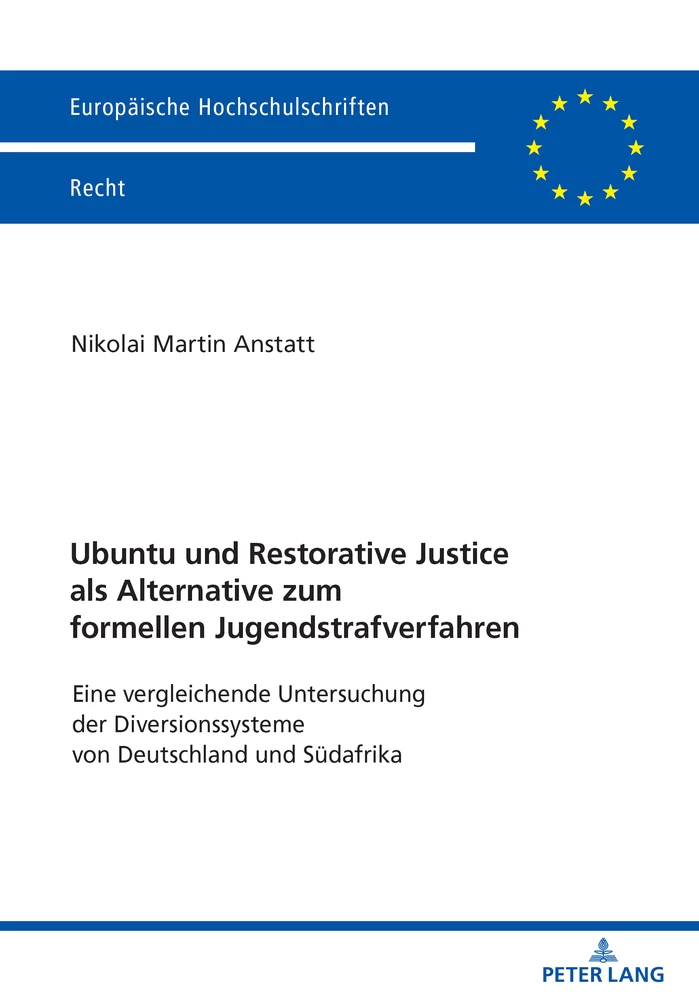Ubuntu und Restorative Justice als Alternative zum formellen Jugendstrafverfahren
Eine vergleichende Untersuchung der Diversionssysteme von Deutschland und Südafrika
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- A. Theoretische Grundlagen
- I. Die besondere Beziehung Südafrikas zu Restorative Justice
- 1. Einleitung
- 2. Die südafrikanischen Wurzeln von Restorative Justice
- 2.1. Historisches und kulturelles Vorverständnis
- 2.1.1. Südafrika vor der Apartheid
- 2.1.2. Südafrika auf dem Weg zur Apartheid
- 2.1.3. Apartheid als Regierungssystem
- 2.1.4. Sharpeville und wachsender Widerstand
- 2.1.5. Das Ende der Apartheid
- 2.2. Ausgangspunkt Nr. 1: Die Wahrheits- und Versöhnungskommission
- 2.2.1. Die Aufarbeitung von Verbrechen während der Apartheid
- 2.2.2. Versöhnung als Grundlage von Restorative Justice
- 2.2.2. Amy Biehl – ein drastischer Beispielsfall
- 2.3. Ausgangspunkt Nr. 2: Die afrikanische Ubuntu- Philosophie
- 2.3.1. Ubuntu – Erklärungsversuche
- 2.3.2. Ubuntu – Grundlage der Konfliktlösung afrikanischer Stämme
- 2.3.3. Wiederbelebung von Ubuntu im modernen Recht
- 2.3.4. Ubuntu und Restorative Justice
- II. Restorative Justice – abstrakte Annäherung
- 1. Definitionen und Schlüsselbegriffe
- 2. Grundprinzipien und Grundannahmen
- 2.1. Restorative Justice vs. Retributive Justice
- 2.2. Die Bedürfnisorientierung von Restorative Justice
- 2.2.1. Bedürfnisse der Opfer
- 2.2.2. Bedürfnisse der Täter
- 2.2.3. Bedürfnisse der Gemeinschaft
- 2.3. Zusammenfassung
- 3. Klassifizierung von Restorative-Justice-Maßnahmen
- III. Fazit
- B. Die rechtlichen Rahmenbedingungen im Ländervergleich
- I. Einleitung
- II. Diversion im deutschen Jugendstrafrecht
- 1. Die Entwicklung des deutschen Diversionssystems
- 1.1. Die Ursprünge der Diversionsidee
- 1.2. Das erste Jugendgerichtsgesetz von 1923
- 1.3. Die Zeit des Nationalsozialismus und das Reichsjugendgerichtsgesetz 1943
- 1.4. Das JGG von 1953 – die Grundlage des heutigen Jugendstrafrechts
- 1.5. Diversionsentwicklung durch Wissenschaft und Praxis
- 1.6. Das 1. JGGÄndG von 1990
- 1.7. Die Entwicklung seit 1990 und internationale Impulse
- 2. Geltende rechtliche Rahmenbedingungen
- 2.1. Einführung, allgemeine Voraussetzungen
- 2.2. Zielsetzungen von Diversion im JGG
- 2.3. Diversion nach § 45 JGG
- 2.3.1. § 45 Abs. 1 JGG – Nicht-intervenierende Einstellung durch den Staatsanwalt
- 2.3.2. § 45 Abs. 2 JGG – Einstellung aufgrund erzieherischer Maßnahmen
- 2.3.3. § 45 Abs. 3 JGG – Einstellung unter Beteiligung des Jugendrichters
- 2.4. Richterliche Diversion nach § 47 JGG
- 2.5. Regelungsebenen und Diversionsrichtlinien
- 2.6. Diversionsoptionen
- 2.6.1. Diversionsoptionen im Überblick
- 2.6.2. Der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) im Rahmen der Diversion
- 2.6.3. Sonstige Restorative-Justice-Elemente in den Diversionsoptionen
- 2.7. Rechtliche Folgen bei durchgeführter Diversion
- 3. Anwendungspraxis und quantitative Befunde
- III. Diversion „the South African Way“
- 1. Die Entwicklung des südafrikanischen Diversionssystems
- 1.1. Das NICRO und die Ursprünge der Diversionsbewegung
- 1.2. Umbruch und Wandel
- 1.3. Die Entstehung des ersten kodifizierten Jugendstrafrechts
- 2. Die Diversionsbestimmungen des CJA
- 2.1. Einführung und Definition
- 2.2. Zielsetzungen von Diversion im CJA
- 2.3. Die informelle Voruntersuchung (preliminary inquiry)
- 2.4. Anwendungsbereich von Diversion
- 2.4.1. Verfahrensstadien, in denen divergiert werden kann
- 2.4.2. Allgemeine deliktsunabhängige Voraussetzungen
- 2.4.3. Spezielle Voraussetzungen nach Deliktsklassen
- 2.5. Diversionsoptionen
- 2.5.1. Level-1-Diversionsoptionen
- 2.5.2. Level-2-Diversionsoptionen
- 2.5.3. Family Group Conferences
- 2.5.4. Victim-offender mediation
- 2.6. Ermessensvorschriften bei der Wahl von Diversionsoptionen
- 2.7. Mindeststandards von Diversionsoptionen
- 2.8. Vollstreckung und Überwachung von Diversionsordern
- 2.9. Rechtliche Konsequenzen bei durchgeführter Diversion
- 2.10. Akkreditierung und Überwachung von Diversionsanbietern
- 3. Anwendungspraxis und quantitative Befunde
- IV. Fazit: Wesentliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Überblick
- C. Kriminologische Vergleichsanalyse der Bezugsländer
- I. Einleitung
- II. Jugendkriminalitätsbelastung im Ländervergleich
- 1. Südafrika - die gewalttätigste Demokratie der Welt?
- 2. Statistische Befunde
- 2.1. Polizeiliche Kriminalitätsstatistiken
- 2.1.1. Mangelnde Vergleichbarkeit zwischen Hell- und Dunkelfeld
- 2.1.2. Tötungsdelikte als Indikator der allgemeinen Gewaltkriminalität
- 2.2. Inhaftierungsraten
- 2.3. Der Global Peace Index (GPI)
- 3. Zwischenfazit
- III. Die Lebenswirklichkeit Jugendlicher im Ländervergleich
- 1. Einleitung
- 2. Gesundheit und Familienstrukturen
- 3. Armut und Massenarbeitslosigkeit
- 4. Soziale Ungleichheit – das eigentliche Problem
- 5. Townships und Wohnstrukturen
- IV. Kriminologische Erklärungsansätze und Restorative Justice
- 1. Einleitung
- 2. Klassische Kriminalitätstheorien
- 2.1. Bindungs- und kontrolltheoretische Ansätze
- 2.1.1. Theoretische Grundannahmen
- 2.1.2. Länderspezifische Anwendung
- 2.1.3. Relevanz für Restorative Justice und Diversion
- 2.2. Lerntheoretische Ansätze
- 2.2.1. Theoretische Grundannahmen
- 2.2.2. Länderspezifische Anwendung
- 2.2.3. Relevanz für Restorative Justice und Diversion
- 2.3. Drucktheoretische Ansätze
- 2.3.1. Theoretische Grundannahmen
- 2.3.2. Länderspezifische Anwendung
- 2.3.3. Relevanz für Restorative Justice und Diversion
- 2.4. Kulturkonflikt, Subkultur und soziale Desorganisation
- 2.4.1. Theoretische Grundannahmen
- 2.4.2. Länderspezifische Anwendung
- 2.4.3. Relevanz für Restorative Justice und Diversion
- 3. Die Theorie des reintegrative shaming von J. Braithwaite
- 3.1. Theoretische Grundannahmen
- 3.2. Ubuntu oder die Bedingungen für ein erfolgreiches shaming
- 3.3. Relevanz für Restorative Justice und Diversion
- 4. Entwicklungsdynamische Ansätze und Desistance- Forschung
- 4.1. Einleitung und empirische Befunde
- 4.2. Die Ansätze von Greenberg und Thornberry
- 4.3. Die Theorie der altersabhängigen informellen Sozialkontrolle
- 4.4. Von der Entwicklungskriminologie zur Desistance-Forschung
- 4.5. Relevanz für Restorative Justice und Diversion
- V. Fazit
- D. Das Beste beider Welten
- I. Einleitung
- II. Vereinbarkeit der Leitprinzipien Erziehung und Restorative Justice
- III. Drei Fälle aus der Strafverteidigung als Diskussionsgrundlage
- 1. Der „Käsekuchenfall“
- 2. Der „Schuleinbruchsfall“
- 3. Der „Revierkampffall“
- IV. Die Einteilung von Straftatbeständen in ein Klassensystem
- V. Die Ausweitung von Diversionsoptionen nach Vorbild des CJA
- 1. Einleitung
- 2. Der Net-Widening-Effekt
- 3. Gefahr bei Adaption der südafrikanischen Diversionsoptionen
- 4. Nicht-Intervention und Restorative Justice im Spannungsfeld
- 5. Fazit
- VI. Die Einbeziehung des Opfers in den Diversionsprozess
- 1. Einleitung
- 2. Täter- und Opferinteressen im Spannungsfeld
- 3. Auflösung durch die Art und Weise der Einbeziehung des Opfers
- 4. Empfehlung: Stärkung des TOA
- 5. Fazit
- VII. Die Einbeziehung der Gemeinschaft in den Diversionsprozess
- 1. Einleitung
- 2. Bedenken gegen die Einbeziehung: Stigmatisierung und Etikettierung
- 3. Nutzen der Einbeziehung
- 3.1. Die Vorbildfunktion Neuseelands
- 3.2. Kulturelle Angemessenheit
- 3.3. Nutzung, aber auch Stärkung der Sozialraumressourcen
- 3.4. Verfassungsrechtliche Gebotenheit
- 3.5. Erweiterung der Kommunikationskanäle
- 3.6. Opferschutzinteressen
- 4. Auflösung des Spannungsfeldes zwischen Bedenken und Nutzen
- 5. Einführung von Gruppenkonferenzverfahren in das JGG
- 5.1. Rechtliche Zulässigkeit
- 5.2. Kriminologische Gebotenheit
- 5.3. Empfehlung
- VIII. Fazit
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Nikolai Martin Anstatt
Ubuntu und Restorative Justice als
Alternative zum formellen
Jugendstrafverfahren
Eine vergleichende Untersuchung der
Diversionssysteme von Deutschland und
Südafrika

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet Über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Zugl.: Mainz, Univ., Diss., 2022
D 77
ISSN 0531-7312
ISBN 978-3-631-89311-1 (Print)
E-ISBN 978-3-631-89324-1 (E-PDF)
E-ISBN 978-3-631-89325-8 (EPUB)
DOI 10.3726/ b20556
© Peter Lang GmbH
Internationaler Verlag der Wissenschaften
Berlin 2022
Alle Rechte vorbehalten.
Peter Lang – Berlin · Bern · Bruxelles · New York · Oxford · Warszawa · Wien
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschÜtzt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Diese Publikation wurde begutachtet.
www.peterlang.com
Autorenangaben
Nikolai Anstatt studierte von 2008 bis 2014 Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Strafrechtspflege an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 2015 absolvierte er ein postgraduales Masterstudium (LL.M.) an der Stellenbosch University in SÜdafrika. Das anschließende Referendariat verbrachte er unter anderem am Max-Planck-Institut fÜr ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg. Seit Abschluss der Zweiten StaatsprÜfung im Jahr 2018 ist er in einer Mainzer Strafrechtssozietät als Rechtsanwalt tätig.
Über das Buch
Südafrika verabschiedete 2010 ein neues Gesetz, welches eine radikale Kehrtwende im bisherigen Umgang mit Jugendkriminalität einleitete - den Child Justice Act. Die traditionellen Säulen der Bestrafung, Vergeltung und Abschreckung wurden konsequent ersetzt durch Diversion und Restorative Justice. Doch dieser Ansatz trifft auf eine horrende Kriminalitätsbelastung. Handelt es sich daher um eine ideelle, aber praktisch nutzlose Herangehensweise? Zur Beantwortung dieser Frage stellt der Autor die Diversionssysteme beider Länder rechtsvergleichend gegenÜber. Unter Bezugnahme auf kriminologische Erkenntnisse wird das Wirkpotential des neuen sÜdafrikanischen Systems bewertet. Ergänzt durch praktische Erfahrungen aus der Strafverteidigung wird abschließend „das Beste beider Welten“ herausgearbeitet.
Zitierfähigkeit des eBooks
Diese Ausgabe des eBooks ist zitierfähig. Dazu wurden der Beginn und das Ende einer Seite gekennzeichnet. Sollte eine neue Seite genau in einem Wort beginnen, erfolgt diese Kennzeichnung auch exakt an dieser Stelle, so dass ein Wort durch diese Darstellung getrennt sein kann.
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2022 vom Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz als Dissertation angenommen. Literatur und Rechtsprechung konnten bis zum Stand der Einreichung im November 2021 berücksichtigt werden.
Meinem Doktorvater Professor Dr. Dr. Hauke Brettel danke ich herzlich für die Betreuung. Er hat mir großen Freiraum bei der Umsetzung des Projekts gelassen, stand aber gleichwohl mit wertvollen Ratschlägen und entscheidenden Denkanstößen zur Seite. Frau Professorin Dr. Wapler danke ich für die Erstellung des Zweitgutachtens.
Den Rechtsanwaltskollegen Niko Brill und Christoph Weiß gilt mein besonderer Dank. Sie haben mit der promotionsbegleitenden Anstellung die Möglichkeit geschaffen, das Projekt fertigzustellen und gleichzeitig reichhaltige praktische Erfahrungen sammeln zu können.
Mit dem Verfassen dieses Vorworts endet ein mehrjähriger und fordernder Schaffungsprozess. Meine Familie und meine Freunde waren diejenigen, die mir die Kraft gegeben haben, diesen durchzuhalten. Ohne die Unterstützung und Förderung meiner Eltern und Großeltern wäre ich nie in der Lage gewesen, studieren und promovieren zu können. Besonders danken möchte ich meinem Vater für das Korrekturlesen der Arbeit.
Schließlich gebührt mein tiefster Dank meiner Verlobten Tanja. Sie hat mich bedingungslos von Beginn bis zum Abschluss der Arbeit unterstützt und ihre eigenen Interessen viel zu oft zurückgestellt.
Mainz, im Oktober 2022
Nikolai Anstatt
Inhaltsverzeichnis
I. Die besondere Beziehung Südafrikas zu Restorative Justice
2. Die südafrikanischen Wurzeln von Restorative Justice
2.1. Historisches und kulturelles Vorverständnis
2.1.1. Südafrika vor der Apartheid
2.1.2. Südafrika auf dem Weg zur Apartheid
2.1.3. Apartheid als Regierungssystem
2.1.4. Sharpeville und wachsender Widerstand
2.2. Ausgangspunkt Nr. 1: Die Wahrheits- und Versöhnungskommission
2.2.1. Die Aufarbeitung von Verbrechen während der Apartheid
2.2.2. Versöhnung als Grundlage von Restorative Justice
2.2.2. Amy Biehl – ein drastischer Beispielsfall
2.3. Ausgangspunkt Nr. 2: Die afrikanische Ubuntu- Philosophie
2.3.1. Ubuntu – Erklärungsversuche
2.3.2. Ubuntu – Grundlage der Konfliktlösung afrikanischer Stämme
2.3.3. Wiederbelebung von Ubuntu im modernen Recht
2.3.4. Ubuntu und Restorative Justice
←11 | 12→II. Restorative Justice – abstrakte Annäherung
1. Definitionen und Schlüsselbegriffe
2. Grundprinzipien und Grundannahmen
2.1. Restorative Justice vs. Retributive Justice
2.2. Die Bedürfnisorientierung von Restorative Justice
2.2.3. Bedürfnisse der Gemeinschaft
3. Klassifizierung von Restorative-Justice-Maßnahmen
B. Die rechtlichen Rahmenbedingungen im Ländervergleich
II. Diversion im deutschen Jugendstrafrecht
1. Die Entwicklung des deutschen Diversionssystems
1.1. Die Ursprünge der Diversionsidee
1.2. Das erste Jugendgerichtsgesetz von 1923
1.3. Die Zeit des Nationalsozialismus und das Reichsjugendgerichtsgesetz 1943
1.4. Das JGG von 1953 – die Grundlage des heutigen Jugendstrafrechts
1.5. Diversionsentwicklung durch Wissenschaft und Praxis
1.7. Die Entwicklung seit 1990 und internationale Impulse
2. Geltende rechtliche Rahmenbedingungen
2.1. Einführung, allgemeine Voraussetzungen
2.2. Zielsetzungen von Diversion im JGG
2.3.1. § 45 Abs. 1 JGG – Nicht-intervenierende Einstellung durch den Staatsanwalt
←12 | 13→2.3.2. § 45 Abs. 2 JGG – Einstellung aufgrund erzieherischer Maßnahmen
2.3.3. § 45 Abs. 3 JGG – Einstellung unter Beteiligung des Jugendrichters
2.4. Richterliche Diversion nach § 47 JGG
2.5. Regelungsebenen und Diversionsrichtlinien
2.6.1. Diversionsoptionen im Überblick
2.6.2. Der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) im Rahmen der Diversion
2.6.3. Sonstige Restorative-Justice-Elemente in den Diversionsoptionen
2.7. Rechtliche Folgen bei durchgeführter Diversion
3. Anwendungspraxis und quantitative Befunde
III. Diversion „the South African Way“
1. Die Entwicklung des südafrikanischen Diversionssystems
1.1. Das NICRO und die Ursprünge der Diversionsbewegung
1.3. Die Entstehung des ersten kodifizierten Jugendstrafrechts
2. Die Diversionsbestimmungen des CJA
2.1. Einführung und Definition
2.2. Zielsetzungen von Diversion im CJA
2.3. Die informelle Voruntersuchung (preliminary inquiry)
2.4. Anwendungsbereich von Diversion
2.4.1. Verfahrensstadien, in denen divergiert werden kann
2.4.2. Allgemeine deliktsunabhängige Voraussetzungen
2.4.3. Spezielle Voraussetzungen nach Deliktsklassen
2.5.1. Level-1-Diversionsoptionen
←13 | 14→2.5.2. Level-2-Diversionsoptionen
2.5.3. Family Group Conferences
2.5.4. Victim-offender mediation
2.6. Ermessensvorschriften bei der Wahl von Diversionsoptionen
2.7. Mindeststandards von Diversionsoptionen
2.8. Vollstreckung und Überwachung von Diversionsordern
2.9. Rechtliche Konsequenzen bei durchgeführter Diversion
2.10. Akkreditierung und Überwachung von Diversionsanbietern
3. Anwendungspraxis und quantitative Befunde
IV. Fazit: Wesentliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Überblick
C. Kriminologische Vergleichsanalyse der Bezugsländer
II. Jugendkriminalitätsbelastung im Ländervergleich
1. Südafrika - die gewalttätigste Demokratie der Welt?
2.1. Polizeiliche Kriminalitätsstatistiken
2.1.1. Mangelnde Vergleichbarkeit zwischen Hell- und Dunkelfeld
2.1.2. Tötungsdelikte als Indikator der allgemeinen Gewaltkriminalität
Details
- Pages
- 310
- Year
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631893241
- ISBN (ePUB)
- 9783631893258
- ISBN (Softcover)
- 9783631893111
- DOI
- 10.3726/b20556
- Language
- German
- Publication date
- 2023 (January)
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 310 S., 14 farb. Abb., 6 s/w Abb.