Excerpt
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Hauptteil
A) Geschichte des Antinatalismus und seine Ursachen
1) Erste Zeugnisse des leidvollen Lebens: Hinduismus und Buddhismus
2) Die Antike: Gnosis und Manichäismus - Die verfehlte Schöpfung und der zweite Messias
3) Das Mittelalter - Der katholische Zölibat und die Katharer
4) Die Neuzeit
I) Arthur Schopenhauer, Subjekt-Objekt und das Ende der Menschheit
II) Philipp Mainländer - Gott will sterben
5) Die Junge Vergangenheit
I) Der Neo-Nihilismus - Kurnig und die „sanfte Entvölkerung der Welt“
II) Die Ein-Kind-Politik der Volksrepublik China
III) Karl Popper - Die Asymmetrie von Glück und Leid
B) Emil Cioran: Die Katastrophe im Leben des Menschen ist seine Geburt
1) Der junge Radikale und der alte Skeptiker
2) „Der Mensch stinkt" - Die Sinnlosigkeit von Geburt, Leben und Tod
I) Cioran als Anti-Existenzialist: Von Freiheit und Bedeutungslosigkeit
C) Ist das Leben ethisch richtig? - Antinatalismus der Gegenwart
1) Wann ist ein Mensch ein Mensch? Abtreibung, Sterbehilfe und Euthanasie
2) Klimawandel und Überbevölkerung - Abwertung des Menschen
Fazit
Bibliographie und Quellenverzeichnis
Einleitung:
Die Menschheit sollte nicht existieren. Dies ist eine Aussage, die ein „Antinatalist“ treffen könnte, die aber auf uns wohl eher abschreckend wirkt. Während sich der Großteil der Denker des Mittelmeerraums damit beschäftigt(-e), wie das Leben des Einzelnen mit der größten Menge an Gutem, der höchsten Gemütsruhe oder dem besten Staat gelingen kann, finden sich nur vereinzelt Antworten auf die Frage, ob das „Geborenwerden“ und Gebären etwas Erstrebenswertes ist. Diese vernachlässigte Grundfrage der Philosophie und Politik verneint der Antinatalismus. Menschliches Leben ist an sich schlecht, ein Malus, etwas an sich Falsches.
Bisher existiert keine - über unzuverlässige Wikipedia-Einträge hinausgehende - stringente Geschichte des Antinatalismus. Gleichzeitig verliert sich unsere Gegenwart in Kriegen, Klimawandel und Überbevölkerung, weshalb zumindest daran gezweifelt werden muss, dass die Existenz der Menschheit ihr selbst und dem übrigen leidempfindlichen Leben einen Gefallen tut.
Diese Arbeit wird sich also im ersten Teil mit der Geschichte antinatalistischer Gedanken beschäftigen, die sich in Religion, Mythos, Kultur und Philosophie finden lassen, um historisch nach verschiedenen Ursachen zu suchen.
Im zweiten Teil der Arbeit wird der Blick dann explizit auf einen höchst kontroversen Denker Frankreichs im 20. Jahrhundert gelenkt: Emil Cioran, gebürtiger Rumäne und Autor, der seine zweite Lebenshälfte in Frankreich verbrachte. Hierbei wird als ein zentraler Aspekt seine Biografie untersucht, um darin nach Gründen für seinen Pessimismus und seine Todessehnsucht, die in seinen Aphorismen eindeutig herausstechen, zu forschen. So wird also die Untersuchung gesellschaftlicher Umstände aus dem ersten Teil um die beispielhafte Analyse dieses Autors ergänzt werden. Im nächsten Aspekt wird auf Ciorans Werk eingegangen; spezifischer wird in seinen Werken nach Überschneidungen gesucht, aus denen sich zentrale Motive seiner Gedanken ableiten lassen könnten. Außerdem soll seine Position zum Existenzialismus erörtert werden.
Wurden bisher nur philosophische und religiöse Argumentationen betrachtet, wird es im dritten Teil der Untersuchung mehr um gegenwärtige und lebenspraktische Fragen der Ethik gehen: Wann darf abgetrieben werden? Was umfasst die Freiheit des Menschen? Sollte man sich überhaupt noch fortpflanzen oder lieber einsehen, dass es das Beste wäre, wenn die Menschheit ausstürbe?
Diese Fragestellungen sollen aus antinatalistischer Perspektive beleuchtet werden, um abschließend ein Bild dieser Argumentation historisch kontextualisieren zu können, sodass die Frage, warum Menschen sich gegen das Leben aussprechen, das für viele ein kosmisches oder unabdingbares Prinzip zu sein scheint, strukturiert beantwortet werden kann.
Zitiert wird mithilfe direkter Verweise auf das QV (Quellenverzeichnis) - in dem genaue Angaben zu Autor, Titel, Verlagsort, Verlag, Erscheinungsjahr und Auflage gemacht werden - mit Sei- tenzahl(-en) Zeilenangaben. Die Quellen sind in Primär- und Sekundärquellen sowie jeweils in Print- und Onlinemedien sortiert, aber durchlaufend nummeriert. Die Auflistung der Quellen erfolgt nach den allgemeinen Werken jeweils in der Reihenfolge ihres Auftretens.
Hauptteil:
A) : Die Geschichte des Antinatalismus und seine Ursachen
Der Antinatalismus hat eine lange Tradition. Doch aus welchen Gründen dachten sich ganze Völker, dass das Leben zu überwinden sei? Die ältesten uns bekannten mythischen Vorstellungen und Religionen sind wegen der besonders kritischen Quellenlage kaum letztendlich zu ergründen, dennoch soll aber von den ersten Gedanken ausgehend eine „Geschichte des Antinatalis- mus“ entstehen, die uns zumindest einen Überblick darüber verschafft, wo, wann, weshalb und in welcher Form man antinatalistisch argumentierte oder glaubte.
Allerdings gibt es in der Geschichte der Philosophie keine homogene „Strömung des Antinata- lismus“, der sich Menschen zugeordnet hätten. Mit der Zuschreibung „Antinatalist“ ist keine Person oder Religion gemeint, die sich diesem verschreibt. Stattdessen ist eine Person oder Religion mit Gedanken, die dem Prinzip der Geburtenvermeidung folgt, gemeint.
A) 1): Erste Zeugnisse des leidvollen Lebens: Hinduismus und Buddhismus
Die ältesten Zeugnisse religiöser Lehren, deren Grundlagen sich mit antinatalistischen Gedanken in Verbindung bringen lassen, sind die hinduistischen bzw. buddhistischen Lehren. Obwohl die hinduistische Tradition durch mündliche Überlieferung der Veden - kanonische Zeugnisse der Lehren, zu denen sich Hindus bekennen - schon viele Jahrtausende existierte, seien sie laut Christiane Willers nach „vorsichtigen Schätzungen“ erst zwischen 1500 und 900 v. Chr. verschriftlicht worden.1 Der wirkliche Ursprung des Hinduismus ist nicht eindeutig nachzuverfolgen. Wie alle sozialen Gedankenkonstrukte handelt es sich hierbei nicht um punktuell entstandene, festgelegte Normentitäten, sondern um Prozesse, die sich durch die Umgebung, mit der sie konfrontiert werden, verändern. So entstand der Hinduismus als Religion in Asien wahrscheinlich in einem Prozess der Verschmelzung altasiatischer Traditionen und den Vorstellungen der sog. „Arier“.2
Im Hinduismus wie im Buddhismus gelten die „vier großen Lebensziele “ als Richtlinie für gutes Handeln auf Erden. Das vierte dieser Lebensziele ist das sog. Moksha. Aus Sanskrit übersetzt bedeutet es so viel wie „Befreiung“ und beschreibt im hinduistischen Weltbild die Erlösung der Seele durch das Ausbrechen aus dem ewigen Kreislauf - dem Samsara.3 Um jene Befreiung realisieren zu können, muss der gläubige Hindu sein Karma bestmöglich prägen. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Umschreibung des uns bekannten Ursache-Wirkung-Prinzips - kurz gesagt: Kausalität. Wenn der Einzelne im Moment der Entscheidung das Richtige tut, dann hat dies wiederum gute Auswirkungen auf seine Zukunft bzw. seine Wiedergeburt. Denn das zyklische Modell des Hinduismus bezieht sich nicht nur auf die Zeitalter, sondern umfasst auch jeden Menschen und jedes Tier. Wer ein gutes Karma hat, dem steht in dem Sinne ein besseres Leben bevor, dass er in eine wohlhabendere Schicht geboren wird. Die bestmögliche Kaste ist die des Pries- ters.4 Möchte man nun das Leben auf Erden, das vor allem in den unteren Kasten leidvoll ist, vorzeitig beenden und endgültige Erlösung erfahren, muss eine absolute Gemütsruhe des Innen und Außen geschaffen werden, sodass das Moksha erreicht werden kann.5
Dieses oberste Ziel der Befreiung aus dem Lebenskreislauf, der voller Leiden und Verzweiflung steckt, weist antinatalistische Züge auf, die sich jedoch von denen der heutigen Antinatalis- ten unterscheiden: Hier geht es nämlich nicht darum, das Leben und die Existenz per se zu degradieren, sondern darum, durch die Vernetzungen von Karma, Samsara und Moksha einen Ansporn für ein bestmögliches Leben zu erzeugen. Dennoch legt die Wortwahl einer „Befreiung“ vom Diesseits nahe, dass es eine erstrebenswertere Welt gibt, die Erlösung verspricht. Im Mechanismus der hinduistischen Weltvorstellung ist zwar der Mensch nach jeder Geburt darauf aus, dass diese die letzte gewesen ist, doch muss die Geburt etwas Gutes sein, da Erlösung ohne Geburt unmögliche wäre. Das Leben auf der Erde ist hier also wie später im Christentum nur ein Mittel, um den letzten Zweck - die Erlösung im Nirwana durch das Moksha (oder im Himmel) - zu erreichen. Das Leben ist vielleicht schmerzvoll, aber alternativlos.
A) 2): Die Antike: Gnosis und Manichäismus - Die verfehlte Schöpfung und der zweite Messias
Erst einige Jahrtausende später finden sich neue relevanten Strömungen mit Gedanken, die das irdische Leben als „unzureichend“ beschreiben. Laut Precht stand das Wort „Gnosis“ vor allem im dritten Jahrhundert - also zu Lebzeiten Plotins - für eine Vielzahl religiöser Strömungen, Theorien und Anschauungen, die alle nach einer Form der Errettung aus dem Diesseits streben. Dass diese Erlösung angestrebt wird, zeigt schon, dass die Welt aus Sicht der Gnostiker nicht lebenswert (bzw. nicht die „lebenswerteste“ Welt) ist. Für sie sei die Schöpfung verfehlt - oder, anders ausgedrückt, nicht vollkommen.6 Sie sei die „missratene Tat eines schlechten Demiurgen“7.
Der Grundgedanke dieser Vorstellung hat allerdings eine längere Tradition: Schon Platon selbst und auch viele Platoniker nach ihm sahen die Welt des Geistes, des Intelligiblen bzw. der Ideen als höherwertigere, realere oder wesentlichere Welt. Die Welt im Diesseits ist hier nur ein Abklatsch des Wirklichen. Was den Platonismus jedoch von der Gnosis unterscheidet, ist die Vorstellung einer Erlösung nach dem Tod. Diese taucht bei Platon nicht auf; er lässt Sokrates in seinem Phaidon sogar von einer Unvergänglichkeit der Seele sprechen. Nach dessen Ausführung (bzw. dem Gespräch mit den Nebenfiguren) sei die Seele unsterblich und werde ständig wiedergeboren. Weil die Seele ewig sei, erinnere sie sich an die Ideen, die sie in der Vergangenheit geschaut habe, was dem Menschen eine Idee vom Intelligiblen vermittle.8 Eine Erlösung ist hier irrelevant.
Bei Epikur hingegen bedeutet der Tod auch die vollständige Auflösung der Seele. Nach seiner Argumentation müsse kein Mensch den Tod fürchten, weil er ihn nie erleben würde. Es erwarte den Menschen weder etwas Gutes, noch etwas Schlechtes: „Der Tod betrifft uns nicht.“9
Im Gegensatz dazu wird der Gnostizismus in den folgenden Jahrhunderten immer wieder Strömungen hervorbringen, die das durch die christliche Kirche versprochene Heil und die Perfektion von Gott und Mensch infrage stellen werden.
So wird sich im dritten Jahrhundert der Perser Mani (216-276/277) zum Propheten Gottes erklären und auf diese Weise das frühe Christentum, die Gnosis und den Zoroastrismus (alte nahöstliche religiöse Strömung, die auf Zarathustra zurückgeht) vermischen, um eine weitere Lehre der Erlösung aufzustellen. Mani geht utopisch davon aus, die eigentlichere, vollkommenere Welt stehe im Sinne des zyklisch-hinduistischen Modells noch als goldenes Zeitalter im Diesseits be- vor.10
Der Grund dafür, dass sich der Manichäismus (die von Mani begründete Glaubensströmung) in den folgenden Jahrhunderten bis zu seiner Auslöschung durch die Christen so gut behauptet, scheint ein Bedarf nach Erlösung zu sein. Während der Feudalisierung des Landes, auf dem sich der ehem. römische Stadtadel die Bauern zu Untertanen macht, als der finanzielle Niedergang droht11, des Einbruchs der Hunnen um 375, der Plünderung Roms durch die Goten 410, der darauffolgenden Reichsteilung12 und vieler weiterer Ereignisse, die in dieser Zeit das Sicherheitsgefühl der Menschen und das Konstrukt des alten Imperiums erschütterten und schließlich in dessen Untergang mündeten13, verspürten die Bewohner des Mittelmeerraums zunehmend das Bedürfnis nach einer Erlösung aus der leidvollen Welt, in der sie lebten. Das Dasein schien mehr Strafe als Geschenk Gottes zu sein.
Wie einst das Leid vieler Hinduisten der unteren Kasten sie in dem Glauben, nach dem Tod aufsteigen zu können, bestärkte, so bestärkte in der Spätantike die Erlösungsutopie des Manich- äismus die Menschen darin, dass sie noch ein besseres Leben erwarte. Obwohl also gnostische und manichäische Lehren das Leben auf der Erde als unzureichend erklären, tragen sie doch den Funken Hoffnung in sich, den die Menschen brauchen, um Sinnstiftung zu erfahren.
A) 3) Das Mittelalter: Der katholische Zölibat und die Katharer
Doch auch die Christen selbst forderten schon früh weitaus deutlicher antinatalistisches Verhalten ihrer Mitglieder. Vom Kirchenvater Augustinus von Hippo (354-430) ist laut Gunter Bleibohm folgendes Zitat überliefert:
„Ich kenne einige, welche murren und sagen: wie nun, wenn alle sich jeder Begattung enthalten wollten, wie könne dann das Menschengeschlecht bestehen? dann würde das Reich Gottes weit schneller verwirklicht werden, indem das Ende der Welt beschleunigt würde.“14
Für Augustinus ist es Teil des christlichen Glaubens, sich der Keuschheit zu verschreiben. Dies gelte nicht nur für Priester, sondern für jeden Gläubigen. Die Menschheit erfahre nur zeitnah Erlösung im Gottesreich, wenn ihre Existenz beendet werde.
So galt jedoch die Forderung nach priesterlicher Keuschheit zunächst nur in Spanien. Erst im Mittelalter wurde durch Papst Innozenz II. 1139 die priesterliche Ehe allgemein verboten. Doch diese Neuregelung fußte auch auf monetären Grundlagen: Wenn ein Priester Kinder zeugte, dann wurde nach seinem Tod der Privatbesitz an die Hinterbliebenen vererbt. Wenn Priester aber keine Ehe schließen durften, dann fiel der gesamte Besitz in die Hände der Kirche. Dennoch steht die biblische Begründung des Zölibats seit jeher auf wackeligen Beinen, denn einerseits wird die Schwiegermutter des Petrus erwähnt, bei dem es sich immerhin um den ersten Papst handelte, und andererseits ist die Auslegung des Satzes „Manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig,manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht um des Himmelreiches willen“15 eben nur eine Auslegung. Obwohl der Zölibat also keine zentrale Lehre Jesu war - wenn denn überhaupt - und die katholische Kirche vor allem den finanziellen Nutzen im Auge hatte, muss diese Art antinatalistischer Gedanken erfasst werden, denn ein weiterer Grund dafür, andere Menschen vom Kinderkriegen abzuhalten, ist ein egoistisches Vorteilsdenken von Institutionen wie der katholischen Kirche. Die antinatalistischen Gedanken sind hier also nur ein Mittel zur Vermehrung des eigenen Reichtums.
Im zwölften Jahrhundert erhoben sich in Südfrankreich die sog. Katharer16 gegen die katholisch-römische Kirche und breiteten ihre neue Glaubensrichtung in ganz Europa aus. Laut Richard David Precht folgten sie der gnostischen und manichäischen Tradition, die verdorbene Welt im Diesseits vom perfekten Jenseits zu differenzieren. In einem Dualismus aus Gut und Böse (Jenseits und Diesseits) hätten sie einen eigenen Glauben inklusive eigener Gebete, Bekenntnisse und Rituale entwickelt, der sie zu Rivalen der katholischen Kirche machte. Ihre Vernichtung sei brutal und rücksichtslos erfolgt. Etliche Katharer seien als Ketzer öffentlich verbrannt oder ermordet worden.17
Die Katharer, die zusätzlich zu ihrem politischen Wirkungsgrad auch wirtschaftlich sehr erfolgreich geworden seien, habe der Klerus in päpstlichen Bullen als „Neumanichäer“ im Sinne Augustinus beschimpft, der sich in der Spätantike in 33 Schriften gegen die oben dargestellte Strömung wendete.18 Die Katharer waren also gebrandmarkt durch die Kirche, doch in welcher Form und warum waren sie nun Antinatalisten? Die Katharer gehen - wie gesagt - davon aus, dass die diesseitige Welt ein Produkt des Bösen ist. Denn durch den Sündenfall Adams im Paradies sei die Menschheit nicht mehr göttlich.19 Dem Consolamentum (das katharische Glaubensbekenntnis) lässt sich folgender Wortlaut entnehmen: „Versprichst du.[...] [n]icht zu lügen, zu schwören, kein Kriechtier zu töten, keine körperliche Lust zu üben..]?“20. Der Antinatalismus der Katharer steht in der Linie der Gnostiker und Manichäer: Menschliches Leben zu erzeugen, ist für die Mitglieder des Ordens dem Gelöbnis nach untersagt. Das zentrale Motiv der Leidvermeidung läuft auf eine Erlösung hinaus, die aber im Gegensatz zu Hinduismus und Buddhismus gar nicht erst notwendig gewesen wäre, wenn der Mensch sich niemals reproduziert hätte. Hier steht jedoch im Fokus, dass die Versuchung des Menschen getilgt wird, indem ihn der Heilige Geist aufsucht und zum Katharismus bekehrt.21
A) 4) Die Neuzeit
Die Neuzeit bietet nun wieder Ansatzpunkte, die sich wirklich auf die zugrunde liegende Vorstellung von Antinatalistischem beziehen lassen. Erst um den Zeitpunkt des Todes Hegels im November 1831 bahnen sich erneut Denkweisen an, die sich durchaus als Reaktion auf dessen Idee vom endgültigen Abschluss der Philosophie sehen lassen. Die Geschichte dieses Denkens beginnt ausgerechnet mit einem Schüler Hegels...
A) 4) I) Arthur Schopenhauer, die Subjekt-Objekt Problematik und das Ende der Menschheit
Arthur Schopenhauer wird 1788 geboren. In seiner Jugend begeistert er sich für Kant und Platon und kritisiert die Sicherheit, mit der Ersterer die Vernunft an oberste Stelle setzte, vehement. Schopenhauer sieht hier die Möglichkeit, dass nicht die Vernunft, sondern die Gefühle das Höchste alles Intelligiblen darstellen.22
Als sein Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung erscheint, reiht er sich in die Reihe seiner aufklärerischen und idealistischen Vorbilder ein, wenn er die Welt der Sinneswahrnehmung als uneigentlich deklassiert. Die Welt, wie wir sie wahrnehmen, orientiert sich laut Schopenhauer nur nach unseren Sinneswahrnehmungen und unserem Bewusstsein. Der Mensch ist nicht mehr als ein Tier unter Tieren. Anders als seine Vorgänger geht er aber noch weiter: Er beschreibt eine Art natürliche Kraft, die er außerhalb des Denkens sieht. Diese nennt er Wille. Im Gegensatz zu Platon, Kant, Schelling, Hegel, Fichte und vielen anderen manifestiert sich die Welt bei ihm nicht durch den Verstand (die Vernunft), sondern durch den „gespürten und begriffenen Willen kommt die Natur zu sich selbst“. Es sei das Gefühl, das die Welt als Wille durchströmt.23
Schopenhauers Ethik geht von der Prämisse aus, dass Leiden, Schmerz und Schuld grundlegende menschliche Gefühle seien, die ausschließlich jene besonders starken Menschen24 - wie er einer sei - überwinden könnten. Da alles Geschehen auf der Welt voller Extremen sei, die allesamt kein Glück ermöglichten oder stattdessen Leid förderten, müsse dieser Mensch nach der Erkenntnis der Sinnlosigkeit des Strebens nach Glück „den eigenen Egoismus[…] bezwingen“. 1
[...]
1 vgl. und s. QV 11) S. 21
2 vgl. QV 26) Z. 1-5
3 vgl. QV 11) S. 31-33
4 vgl. hierzu das hinduistische Kastensystem: Abbildung in QV 27)
5 vgl. Willers: „Dies gelingt nur, wenn die emotionale Beziehung zwischen dem, was äußerlich sichtbar geschieht, den Handlungen und ihren Auswirkungen auf der einen Seite, und der Gemütslage des Übenden auf der anderen Seite durchbrochen wird.“ s. QV 11) S. 41
6 vgl. QV 12) S. 363 f.
7 s. QV 12) S. 367; Ein Demiurg ist hier ein „Weltenschöpfer“, eine Art erschaffendes Prinzip in Person
8 s. QV 1) S. 31 f.
9 s. und vgl. QV 1) S. 56 f.
10 vgl. QV 12) S. 385 f.
11 vgl. QV 12) S. 387 f.
12 S. 400 QV 12)
13 s. historischer Diskurs zu Untergang d. Römischen Reichs, der wegen d. Umfangs nicht betrachtet werden kann
14 s. QV 28) ab Z. 16
15 s. Matthäusevangelium: Mt 19,3- 12
16 dieser Name wurde ihnen von der katholischen Kirche gegeben. Sie nannten sich selbst wohl nie so
17 vgl. QV 12) S. 515 f.
18 QV 15) S. 45 f.
19 vgl. QV 25) S. 334.
20 s. QV 32) bei „Zitate“
21 vgl. QV 31) S. 22
22 vgl. QV 14) S. 37 f.
23 s. und vgl. ebd. S. 43 f.
24 vgl. hierzu den Übermenschen Nietzsches
1 vgl. und s. QV 14) S. 46
- Quote paper
- Anonymous, 2021, Antinatalismus. Untersuchung der Geschichte mit Fokus auf Emil Cioran und den Konflikt mit J. -P. Sartre sowie Übertragung auf ethische Grundfragen der Gegenwart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1167977
Publish now - it's free
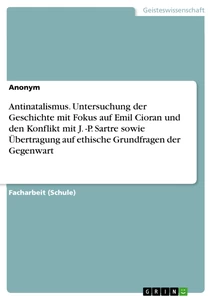
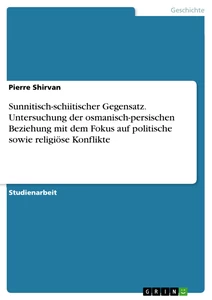
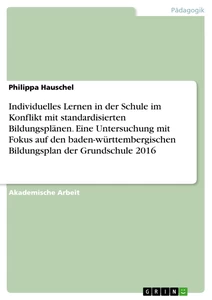

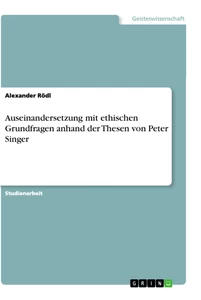
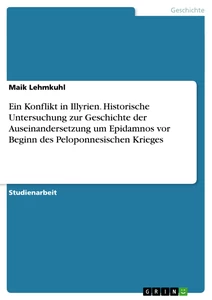
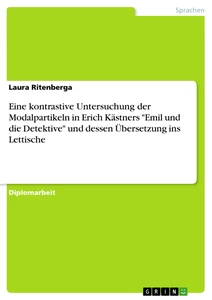

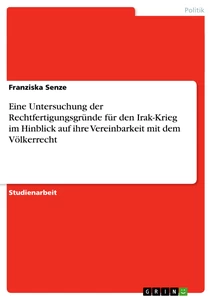
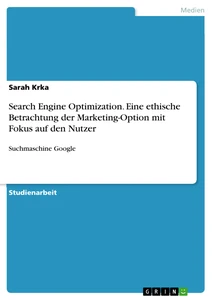

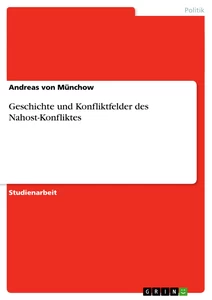
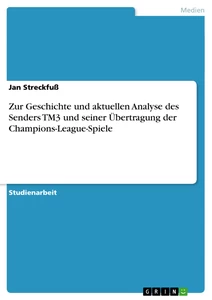
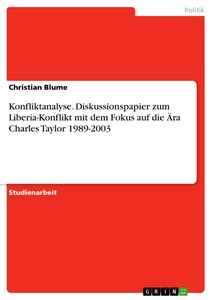
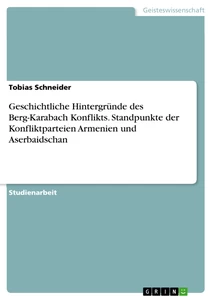
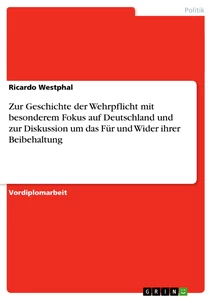
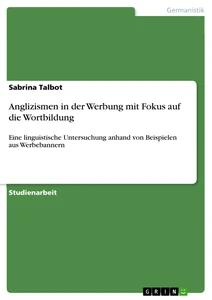
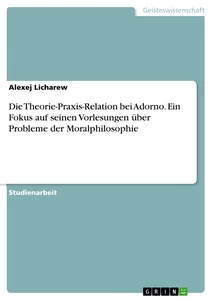
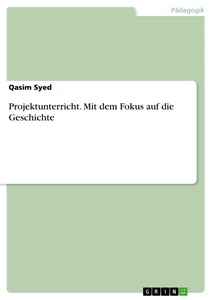
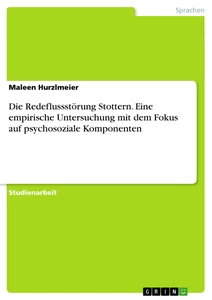
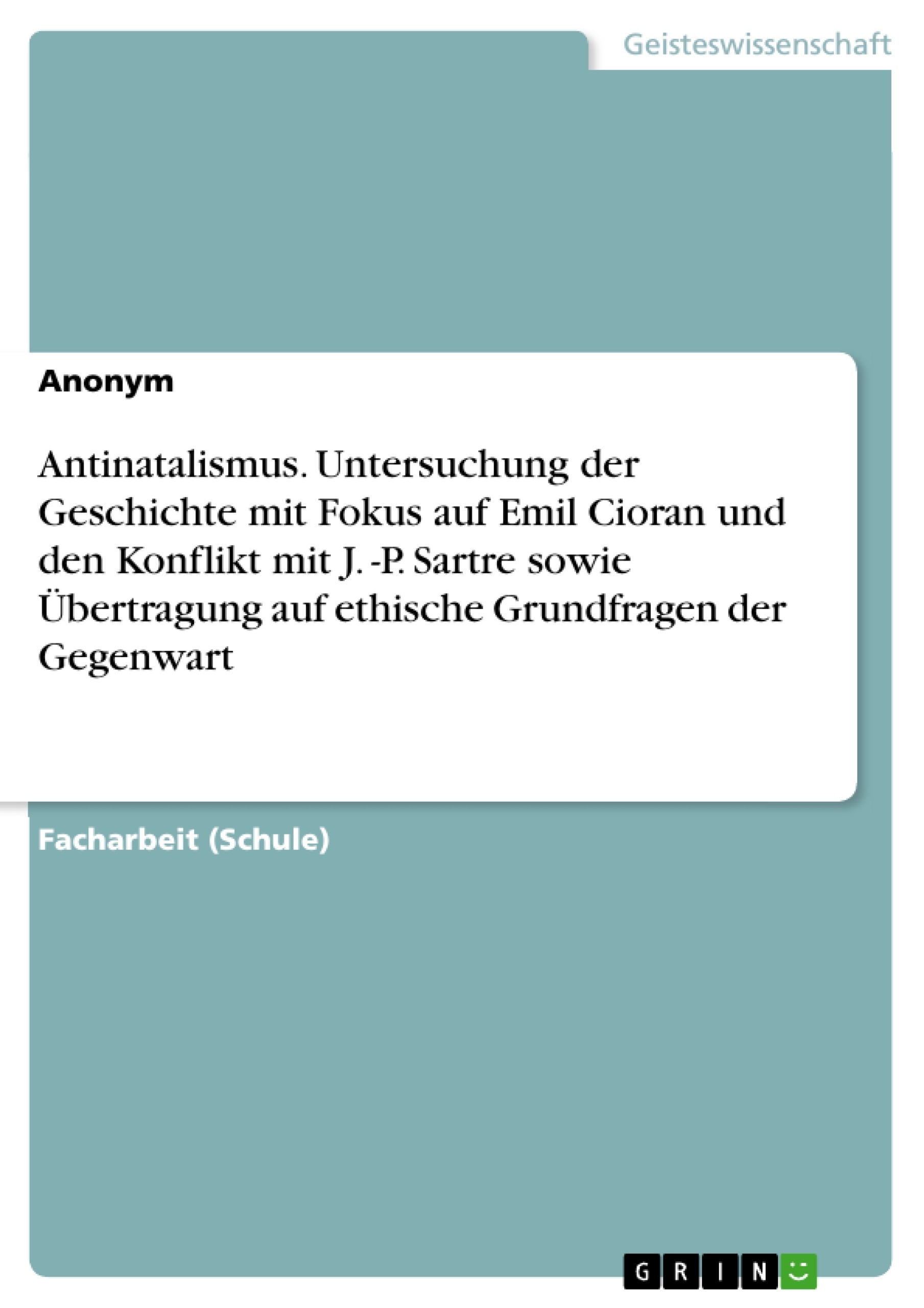

Comments