Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
Formelverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Einführung in das Thema
1.2 Zielsetzung der Arbeit
1.3 Aufbau der Arbeit
2 Portfoliotheoretische Grundlagen
2.1 Allgemeine Anmerkungen
2.2 Portfoliotheoretischer Modellansatz
2.2.1 Grundzüge und Annahmen der Portfoliotheorie
2.2.2 Kritik an der Portfoliotheorie
2.2.3 Indexmodell von Sharpe
2.3 Kapitalmarkttheorie
2.3.1 Capital Asset Pricing Model
2.3.2 Arbitrage Pricing Theory
2.4 Performance- und Risikomessung
2.4.1 Überblick
2.4.2 Sharpe-Ratio
2.4.3 Volatilität
3 Derivative Finanzinstrumente
3.1 Allgemeine Anmerkungen
3.2 Grundidee und Entstehung von Derivaten
3.3 Definition
3.4 Charakteristika von Termingeschäften
3.4.1 Bedingte und unbedingte Termingeschäfte
3.4.2 Börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Derivate
3.4.3 Grundformen derivativer Finanzinstrumente
3.4.3.1 Forwards
3.4.3.2 Futures
3.4.3.3 Optionen (Traded Options)
3.4.3.4 Optionsscheine (Warrants)
3.5 Options-Positionen
3.5.1 Kauf eines Call (Long Call)
3.5.2 Verkauf eines Call (Short Call)
3.5.3 Kauf eines Put (Long Put)
3.5.4 Verkauf eines Put (Short Put)
3.6 Preisbildungsmechanismen
3.6.1 Preisbildung bei Futures
3.6.2 Preisbildung bei Optionen
3.6.2.1 Überblick
3.6.2.2 Innerer Wert und Zeitwert
3.6.2.3 Restlaufzeit
3.6.2.4 Volatilität
3.6.2.5 Zinssatz
3.6.2.6 Dividendenzahlungen
3.6.2.7 Black-Scholes-Modell
3.6.2.8 Put-Call-Parität
3.6.3 Options-Risikokennzahlen
4 Portfoliooptimierung durch derivative Strategien
4.1 Allgemeine Anmerkungen
4.2 Klassifizierung derivativer Strategien
4.2.1 Hedging-Strategien
4.2.2 Trading-Strategien
4.2.3 Arbitrage-Strategien
4.3 Portfolioabsicherung durch Aktienindex-Futures
4.4 Konzept der Portfolio-Insurance
4.4.1 Systematisierung
4.4.2 Statische Wertsicherungsstrategien
4.4.2.1 Protective-Put-Strategie
4.4.2.2 Bond-Call-Strategie
4.4.3 Dynamische Wertsicherungsstrategien
4.4.3.1 Delta-Hedging mit Puts
4.4.3.2 Dynamische Replikation von Optionen
4.5 Absicherung durch das Schreiben von Optionen
4.5.1 Covered Call Writing
4.5.2 Capped-Strategien
4.6 Fazit
5 Portfoliooptimierung in der Praxis
5.1 Allgemeine Anmerkungen
5.2 Modellannahmen
5.3 Modellportfolio
5.4 Portfoliooptimierung
5.4.1 Systematisierung der Vorgehensweise
5.4.2 Ermittlung der zukünftigen Rendite
5.4.3 Ermittlung des zukünftigen Risikos
5.4.4 Ermittlung der Portfoliorendite und des Portfoliorisikos
5.4.5 Bestimmung des optimalen Portfolios
5.4.6 Benchmarking
5.5 Portfolioabsicherung durch Derivate
5.5.1 Allgemeine Anmerkungen
5.5.2 Statische Absicherung
5.5.3 Dynamische Absicherung
5.6 Performancemessung und abschließende Betrachtung
6 Schlussbetrachtung
6.1 Ergebnisse
6.2 Danksagung
Anhang
Literaturverzeichnis
Weiterführende Dokumentation
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 2.1: Risiko-Performance-Diagramm
Abbildung 2.2: Effizienzkurve
Abbildung 2.3: Kapitalmarktlinie
Abbildung 2.4: Wertpapierlinie
Abbildung 3.1: Abgrenzung Kassa- und Termingeschäft
Abbildung 3.2: OTC-Handel und Börsenhandel
Abbildung 3.3: Gewinn-Verlust-Diagramm eines Long Call
Abbildung 3.4: Gewinn-Verlust-Diagramm eines Short Call
Abbildung 3.5: Gewinn-Verlust-Diagramm eines Long Put
Abbildung 3.6: Gewinn-Verlust-Diagramm eines Short Put
Abbildung 3.7: Konvergenz zwischen dem DAX und dem DAX-Future
Abbildung 3.8: Ermittlung des fairen Optionspreises
Abbildung 3.9: Wertentwicklung einer amerikanischen Call-Option
Abbildung 3.10: Grafische Darstellung des Black-Scholes-Modells
Abbildung 4.1: Symmetrische vs. asymmetrische Renditeverteilung
Abbildung 4.2: Gewinn-Verlust-Diagramm eines Protective Put
Abbildung 4.3: Gewinn-Verlust-Diagramm der Bond-Call-Strategie
Abbildung 4.4: Grundidee des synthetischen Put
Abbildung 4.5: Gewinn-Verlust-Diagramm eines Covered Call
Abbildung 4.6: Gewinn-Verlust-Diagramm eines Risk Reversal
Abbildung 5.1: Microsoft Excel-Add-In „Solver“
Abbildung 5.2: Relative Performance-Grafik der Portfolios und des DAX
Abbildung 5.3: Absolute Performance-Grafik der Portfolios
Abbildung 5.4: Portfolioperformance 2006 mit Protective Put 5900
Abbildung 5.5: Portfolioperformance 2006 mit Protective Put 5400
Abbildung 5.6 Portfolioperformance 2006 mit Delta Hedge 5900
Abbildung A.1: Excel-Spreadsheet zur Berechnung von Optionen
Tabellenverzeichnis
Tabelle 3.1: Rechte und Pflichten der Optionskäufer und-verkäufer
Tabelle 3.2: Chancen und Risiken der einzelnen Options-Positionen
Tabelle 3.3: Optionsphasen und -begriffe
Tabelle 3.4: Reaktion des Optionspreises bei veränderten Faktoren
Tabelle 4.1: Ermittlung eines Portfolio-Beta-Faktors
Tabelle 5.1: Auswahl des Modellportfolios
Tabelle 5.2: Zusammenstellung des Modellportfolios
Tabelle 5.3: Erwartete Rendite des Modellportfolios
Tabelle 5.4: Erwartete Volatilität des Modellportfolios
Tabelle 5.5: Kovarianzmatrix des Modellportfolios
Tabelle 5.6: Erwartungswerte des Modellportfolios
Tabelle 5.7: Gewichtung des optimierten Portfolios
Tabelle 5.8: Erwartungswerte des optimierten Portfolios
Tabelle 5.9: Portfoliozusammenstellung der Portfolios
Tabelle 5.10: Ermittlung des Portfolio-Beta-Faktors I
Tabelle 5.11: Ermittlung des Portfolio-Beta-Faktors II
Tabelle 5.12: Szenarioanalyse Protective Put
Tabelle 5.13: Portfolioumschichtungen zur Finanz. des Delta-Hedge
Tabelle 5.14: Ergebnisse des Delta-Hedge, Teil I
Tabelle 5.15: Ergebnisse des Delta-Hedge, Teil II
Tabelle 5.16: Performance- und Risikomessung
Tabelle A.1: Aktien- und Portfolioentwicklung 2006
Tabelle A.2: Warrant- und Portfolioentwicklung 2006
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Symbolverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Formelverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
1.1 Einführung in das Thema
In den vergangenen Jahrzehnten hat die Bedeutung der Kapitalmärkte stetig zugenommen. Dies liegt einerseits daran, dass sich Unternehmen immer häufiger des Kapitalmarkts als Finanzierungsform bedienen und andererseits, dass im Rahmen der privaten Altersversorgung und des Vermögensaufbaus der Kapitalmarkt eine viel wichtigere Rolle im Leben des Einzelnen einnimmt.[1] Diese Entwicklung wird durch entsprechende Statistiken untermauert. So besaßen nach der Statistik des Deutschen Aktieninstitutes im ersten Halbjahr 2006 insgesamt 9,905 Millionen Menschen in Deutschland Aktien oder Aktienfonds, dies stellt gegenüber 1997 annähernd eine Verdoppelung dar.[2]
Seit dem Börsencrash von 1929 haben dabei die Risikokontrolle und das Risikomanagement stetig an Bedeutung gewonnen und zur Entwicklung der modernen Kapitalmarkttheorie beigetragen. Als Meilenstein und theoretische Fundierung gilt dabei allgemein die in den 1950er Jahren von Harry M. Markowitz entwickelte Portfoliotheorie.[3] Markowitz entwickelte die Theorie, dass sich eine Risikoreduktion des Gesamtportfolios durch das Mischen von verschiedenen Anlagen erreichen lässt, wobei das unsystematische Risiko sogar vollständig durch Diversifikation eliminiert werden kann.[4]
Den tatsächlichen Durchbruch in der Praxis bei Portfolio- und Fondsmanagern schaffte die Portfoliotheorie jedoch erst zu Beginn der 1990er Jahre. Erst seit dieser Zeit stehen leistungsfähige Computer zur Verfügung, die es ermöglichen, das enorme Daten- und Informationsaufkommen zu bewältigen und die Portfoliotheorie über eine große Menge von Wertpapieren praxisgerecht anzuwenden.
Die Entwicklung der Portfoliotheorie und starke Marktschwankungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts führten zur Entstehung von Derivaten Finanzinstrumente, bei denen es sich um Produkte handelt, deren Entwicklung an die Kursverläufe eines Basiswerts gekoppelt ist.[5] Der Einsatz von Derivaten im Portfoliomanagement und zur Risikoabsicherung konnte seinen endgültigen Durchbruch in Deutschland in den Jahren zwischen 1987 und 1992 feiern, bedingt durch fünf in kurzen Abständen einsetzende Kurseinbrüche. Seitdem beherrscht das Thema Derivate und deren Einsatz die öffentliche Diskussion, zumal diese anscheinend adäquate Lösungswege für viele finanzwirtschaftliche Probleme bieten.[6]
Mittlerweile werden Derivate in jedem Portfolio eines institutionellen Anlegers zur Risikosteuerung eingesetzt. Privatanwender verwenden diese jedoch selten zur Portfolioabsicherung, da Derivate aus Sicht vieler Privatanleger immer noch überwiegend mit Spekulation und „Zockerei“ gleichgesetzt werden.[7]
1.2 Zielsetzung der Arbeit
Die vorliegende Arbeit soll Möglichkeiten und Strategien der Portfoliooptimierung vorstellen und analysieren. Dabei stehen insbesondere die Portfoliooptimierung nach Harry M. Markowitz im Rahmen der Portfoliotheorie sowie der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten im Vordergrund. Es soll analysiert werden inwiefern sich Aktienportfolios von Privatanlegern tatsächlich in Bezug auf Rendite und Risiko optimieren lassen, welche besondere Rolle dabei derivative Finanzinstrumente spielen und welche Instrumente eingesetzt werden können.
In diesem Zusammenhang sollen Derivate ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Portfoliooptimierung und –absicherung (Hedging) betrachtet werden und nicht unter dem Aspekt der Spekulation oder der Arbitrage.[8]
1.3 Aufbau der Arbeit
Zu Beginn der Arbeit werden zunächst portfoliotheoretische Grundlagen in Kapitel Zwei vorgestellt. Neben der klassischen Portfoliotheorie von Markowitz erfolgen eine theoretische Einordnung der Kapitalmarkttheorien sowie die kurze Vorstellung von Instrumenten zur Performance- und Risikomessung.
In Kapitel Drei werden grundlegende Aspekte von derivativen Finanzinstrumenten behandelt. Dazu gehört die Abgrenzung von bedingten und unbedingten Termingeschäften, deren Spezifikation sowie die Einführung in Preisbildungsmechanismen.
Darauf aufbauend erfolgt in Kapitel Vier die Vorstellung derivativer Strategien zur Portfoliooptimierung. Hierbei liegt der Fokus insbesondere bei den bedingten Termingeschäften und es werden im Rahmen des Portfolio-Insurance-Konzepts Strategien zur Absicherung des Portfolios gegen Kursschwankungen vorgestellt, die auch von Privatanlegern durchgeführt werden können.
In Kapitel Fünf erfolgt die praktische Anwendung und Untersuchung der Praxistauglichkeit der zuvor vorgestellten Optimierungsansätze. Dazu wird zunächst ein Modellportfolio entwickelt und analysiert, das in einem weiteren Schritt mithilfe der Portfoliotheorie optimiert sowie durch einige ausgewählte derivative Strategien gegen Kursschwankungen abgesichert wird. Das Kapitel schließt mit einer Performance- und Risikobetrachtung der einzelnen Optimierungsvarianten mit realen Kursdaten des Jahres 2006.
2 Portfoliotheoretische Grundlagen
2.1 Allgemeine Anmerkungen
Wie bereits einleitend erwähnt, ist Harry M. Markowitz als Begründer der modernen Portfoliotheorie anzusehen und die Kapitalmarkttheorie wurde in den letzten fünfzig Jahren entscheidend durch ihn geprägt. In einem Artikel im „Journal of Finance“[9] 1952 und in seinem Werk „Portfolio Selection“[10], welches 1959 erschien, stellte er die Gedanken zur Portfoliotheorie vor und wurde dafür zusammen mit seinen Kollegen Merton H. Miller und William F. Sharpe 1990 mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet. Seine Theorie basiert im Wesentlichen auf der Annahme, dass sich eine Risikoreduktion von Wertpapierportfolios durch das Mischen von verschiedenen Anlagen erreichen lässt. Nach Markowitz kann das unsystematische oder auch das unternehmensindividuelle Risiko durch eine entsprechende Diversifizierung der Kapitalanlage vollständig eliminiert werden.[11]
Die moderne Portfoliotheorie lieferte damit den Grundstein für weitere, auf dieser Theorie aufbauende Ansätze zur Portfoliooptimierung und bildet das Fundament für jüngere Kapitalmarkttheorien. Insbesondere William Sharpe konnte im Rahmen der Portfoliotheorie weitere Preisbildungstheorien im Kapitalmarkt, wie z. B. das Indexmodell oder das Capital Asset Pricing Model, entwickeln. Dieses Kapitel wird sich neben der Portfoliotheorie den wichtigsten auf dem Markowitz-Modell aufbauenden Kapitalmarktmodellen widmen und im letzten Teil die Performance- und Risikomessung vorstellen. Eine formale Definition der in diesem Kapitel vorgestellten Kennzahlen und Formeln erfolgt im Rahmen des Kapitels Fünf.
2.2 Portfoliotheoretischer Modellansatz
2.2.1 Grundzüge und Annahmen der Portfoliotheorie
Ausgangspunkt der „Portfolio Selection Theory“ war die empirische Beobachtung Markowitz’, dass Anleger ihr Vermögen gewöhnlich auf mehrere verschiedene Anlagen diversifizieren. Eine Diversifikation des Vermögens ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn nicht ausschließlich die Rendite des Portfolios im Vordergrund steht, sondern auch das Risiko. Im Falle der Fokussierung allein auf die Rendite wäre die Investition des gesamten Kapitals lediglich in das Wertpapier mit der höchsten erwarteten Rendite sinnvoll.[12]
Dieser Investmentansatz der Fokussierung widerspricht jedoch nach Markowitz jeglichem rationalem und risikobewusstem Investmentverhalten. Daher entwickelte Markowitz den Ansatz, die Selektion eines Portfolios anhand von erwarteter Rendite und erwartetem Risiko zu analysieren und zu optimieren. Im Rahmen der Portfoliotheorie bewies er, dass durch die optimale Diversifikation eines Portfolios wesentlich höhere Renditen bei geringerem Risiko erzielt werden können.[13]
Dabei greift die Portfoliotheorie auf das Entscheidungsprinzip unter Unsicherheit zurück, da die zukünftigen Entwicklungen der Rendite und des Risikos des Portfolios nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden können. Als Entscheidungshilfe und Prognosemöglichkeit finden hierbei insbesondere historische Kursentwicklungen der zu betrachtenden Wertpapiere Beachtung. Das zu erwartende Portfoliorisiko wird in der Portfoliotheorie durch die Varianz σ² ausgedrückt, die als Streuungsmaß die durchschnittliche quadratische Abweichung der Erträge vom Erwartungswert angibt. Anstelle der Varianz kann auch die Standardabweichung σ, die sich aus der Wurzel der Varianz ergibt, Verwendung finden.[14]
Um im Rahmen der Portfoliotheorie ein Wertpapierportfolio zu optimieren, sind jedoch nicht nur die durch die Varianz gemessenen Einzelrisiken von Bedeutung, sondern vielmehr deren Wechselwirkung zueinander.[15] Um die Kursveränderung eines Wertpapiers im Verhältnis zur Kursveränderung eines anderen Wertpapiers zu messen, wird im Rahmen der Portfoliotheorie die Kovarianz COV verwendet. Dabei drückt eine positive Kovarianz eine gleichläufige und eine negative Kovarianz eine gegenläufige Korrelation aus. Bei einer Kovarianz von null besteht kein Zusammenhang zwischen den Kursveränderungen der verschiedenen Anlagen.[16] Durch eine Kombination von schwach miteinander korrelierenden Wertpapieren können die Wertschwankungen bzw. das Risiko des Portfolios bei gleich bleibender Rendite verringert werden.[17] Das nachfolgende Diagramm 2.1 verdeutlicht, wie ein risikoarmes Portfolio (Aktie B) durch die Hinzunahme einer geeigneten, risikoreichen Aktie noch risikoärmer werden kann (Portfolio P).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2.1: Risiko-Performance-Diagramm[18]
Anhand der Portfoliokennzahlen erwartete Rendite, erwartetes Risiko und erwartete Korrelation lassen sich unter Berücksichtigung der individuellen Risikoneigung des jeweiligen Investors sämtliche effizienten Portfolios errechnen. Ein Portfolio, das auf der Effizienzkurve liegt und damit für den Investor relevant ist, hat bei einem bestimmten Risiko die höchste Renditeerwartung bzw. bei einer bestimmten Renditeerwartung das geringste Risiko (siehe Abbildung 2.2).[19]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2.2: Effizienzkurve[20]
Dabei gelten für das Grundmodell der Portfoliotheorie diese Annahmen:[21]
- Der Planungszeitraum beträgt genau eine Periode.
- Alle Wertpapiere sind bis in die kleinste Quantität beliebig teilbar.
- Transaktionskosten und Steuern existieren nicht.
- Den Investoren wird Risikoaversion unterstellt, das bedeutet, dass ein Investor bei gleicher Rendite immer die Alternative mit dem geringsten Risiko vorzieht.
2.2.2 Kritik an der Portfoliotheorie
Durch die Portfoliotheorie ist es Markowitz gelungen, ein Erklärungsmodell für das in der Praxis zu beobachtende Anlegerverhalten der Diversifikation zu finden. Darüber hinaus kommt das Modell von Markowitz zu dem Schluss, dass es in erster Linie auf die Korrelation zwischen den im Portfolio befindlichen Wertpapieren ankommt und nicht primär auf die Menge der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere.[22]
Dennoch ist die Portfoliotheorie nicht frei von Problemen. So besteht eine Grundannahme der Portfoliotheorie darin, dass sich aus der Vergangenheit keine verlässlichen zukünftigen Kursentwicklungen vorhersagen lassen. Trotzdem werden die zukünftigen Renditen zum erheblichen Teil aus historischen Daten geschätzt, deswegen darf die Chance, dass ein Anleger ex ante ein seiner Risikoneigung entsprechendes, effizientes Portfolio findet, nicht überschätzt werden.[23] Ein weiterer Kritikpunkt ist die Vernachlässigung des Timing-Gedanken. Die Portfoliotheorie trifft keine Aussage über die optimalen Ein- und Ausstiegszeitpunkte bei den Wertpapieren, die das optimale Portfolio bilden. Folglich werden durch das Markowitz-Modell die Erkenntnisse der fundamentalen und technischen Analyse vollkommen vernachlässigt.[24]
Häufig zielt darüber hinaus die Kritik auf die enorme Informationsbeanspruchung. Um die Berechnung effizienter Portfolios zu gewährleisten, werden leistungsfähige Computer zur Verarbeitung großen Datenmengen benötigt. So müssen schon bei der Betrachtung von zehn Wertpapieren insgesamt 65 verschiedene Parameter, die sich aus zehn Renditen, zehn Varianzen und 45 Kovarianzen zusammensetzen berechnet und geschätzt werden. Aus diesem Grund räumt auch Markowitz ein, dass die praktische Anwendbarkeit der Portfoliotheorie über große Mengen von Wertpapieren nur institutionellen Anlegern möglich ist.[25]
2.2.3 Indexmodell von Sharpe
Die bereits angesprochene Datenproblematik des Portfolio-Selection-Modells von Markowitz hat zur Entwicklung des Indexmodells[26] (auch: Single-Index-Modell) durch den Wirtschaftswissenschaftler William F. Sharpe geführt. Ziel des Modells ist es, die Anzahl von Input-Daten zu minimieren und somit das Markowitz-Modell praktisch anwendbarer zu gestalten.[27]
Nach Markowitz lässt sich das Risiko eines Portfolios dadurch vollständig eliminieren, dass dem Portfolio absolut negativ korrelierende Wertpapiere beigemischt werden. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass vollständig negativ korrelierende Wertpapiere nicht existieren. Nach Sharpe hat dies fundamentale Ursachen, da sich Ereignisse wie Leitzinsänderungen, Kriege und wirtschaftliche oder politische Veränderungen auf den gesamten Kapitalmarkt auswirken.[28]
Unter der Annahme, dass diese Einflüsse mithilfe eines Indizes (z. B. dem DAX) erfasst werden können, besteht die Möglichkeit, die Korrelation zwischen allen Paaren von Wertpapieren vollständig auf die Korrelation jedes Wertpapiers mit dem Index zurückzuführen.[29] Allerdings bestehen neben diesen globalen, gesamtwirtschaftlichen Ereignissen auch unternehmensindividuelle Besonderheiten, die sich im Aktienkurs des jeweiligen Unternehmens widerspiegeln und die Aktienkurse von anderen Unternehmen nicht oder nur leicht tangieren. Um diesen Faktor zu berücksichtigen, hat Sharpe eine titelspezifische Störkomponente єi eingeführt.[30]
Kritisch bleibt anzumerken, dass die Unterstellung, unternehmensindividuelle Ereignisse hätten keinen oder nur einen sehr geringen Einfluss auf die Wertentwicklung von Aktien anderer Unternehmen in der Praxis nicht standhält und dass insbesondere die Aktienkursentwicklung innerhalb von Branchen häufig das Gegenteil beweist.
2.3 Kapitalmarkttheorie
2.3.1 Capital Asset Pricing Model
Das CAPM wurde zusammen von Sharpe, Lintner und Mossin in den 1960er Jahren entwickelt und baut unmittelbar auf der Portfoliotheorie von Markowitz auf.[31] Insbesondere Sharpe greift dabei den Grundgedanken der Portfoliotheorie auf, nach dem das unsystematische Risiko von Wertpapieren durch Diversifikation vollständig eliminiert werden kann.[32]
Von den Kapitalmarkttheoretikern wird deshalb die Meinung vertreten, dass es nicht mit Kosten verbunden ist, Risiken auf diese Weise auszuschalten. Aufgrund der Annahme dieser Kostenfreiheit wird eine Eliminierung von Risiken über die Diversifikation von Seiten des Marktes auch nicht honoriert. Das Gesamtrisiko setzt sich dabei aus dem unsystematischen, durch Diversifikation eliminierbaren Risiko und dem systematischen Risiko zusammen. Das systematische ist im Gegensatz zum unsystematischen Risiko nicht durch Diversifikation reduzierbar, so dass eine Adaption dieses zusätzlichen Risikos von Seiten des Marktes durch eine zusätzliche Risikoprämie, die über der risikolosen Verzinsung Rf liegt, gewürdigt wird.[33]
Entsprechend der Portfoliotheorie können dabei sämtliche optimalen Portfolios, unter Berücksichtigung der individuellen Risikonutzenfunktion des jeweiligen Anlegers, auf einer beliebigen Stelle der Effizienzkurve liegen. Unter der Prämisse, dass jederzeit beliebig viel Geld zum risikolosen Zinssatz Rf angelegt und akquiriert werden kann, kann es zu einer Mischung der risikolosen Anlagemöglichkeit mit den individuellen Portfolios kommen.[34]
Die folgende Abbildung 2.3 illustriert die Effizienzgerade, die auch als Kapitalmarktlinie bezeichnet wird und alle anderen Geraden in Bezug auf die Risikoeffizienz dominiert.
Dabei kennzeichnet der Tangentialpunkt zwischen der Kapitalmarktlinie und der Effizienzkurve das Marktportfolio M. Hierbei handelt es sich um die optimale Zusammensetzung der Wertpapiere und keine andere Kombination führt zu effizienteren Ergebnissen.[35]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2.3: Kapitalmarktlinie[36]
Aus der Kapitalmarktlinie und der erwarteten Risikoprämie lässt sich die Renditeerwartung für jedes einzelne Wertpapier des Marktportfolios im Kapitalmarktgleichgewicht herleiten. Das Ergebnis ist die Wertpapierlinie, die die Grundlage des CAPM bildet.[37] Dabei ist für jedes einzelne Wertpapier im Portfoliozusammenhang nur der Beta-Faktor βi als Risikomaß des systematischen Risikos von Bedeutung. Wie bereits erwähnt, lassen sich im Rahmen der Portfoliotheorie sämtliche unsystematischen Risiken durch Diversifikation eliminieren, so dass das Beta lediglich das systematische Risiko in Relation zum Risiko des Marktportfolios misst.[38]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Den systematischen Teil des Gesamtrisikos muss jeder Anleger in Kauf nehmen und wird dafür mit einer Risikoprämie belohnt, die zusammen mit dem risikolosen Zinssatz die erwartete Rendite des Wertpapiers ergibt. Je höher das Beta eines Wertpapiers ist, umso höher fallen die erwartete Rendite, aber auch das Risiko aus. Definitionsgemäß ist der Beta-Faktor des Marktportfolios βm eins (siehe Abbildung 2.4).[39]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2.4: Wertpapierlinie[40]
2.3.2 Arbitrage Pricing Theory
Die APT wurde 1976 von Ross[41] entwickelt und wird allgemein in der Literatur als einer der Hauptherausforderer des CAPM angesehen. Obwohl die Aufgabenstellung der beiden Modelle, die Bewertung risikobehafteter Wertpapiere im Marktgleichgewicht, die gleiche ist, stellt die APT im Gegensatz zum CAPM ein Mehrfaktormodell dar. Die Rendite eines Wertpapiers ist nach der APT von mehreren gemeinsamen Faktoren Fj abhängig und setzt sich konträr zum CAPM nicht nur aus dem Beta-Faktor für das bewertungsrelevante Risiko zusammen.[42]
In der Theorie wird dabei nicht exakt vorgegeben, um welche Faktoren es sich konkret handelt, diese müssen nur Träger des systematischen Risikos sein. Am häufigsten werden dabei makroökonomische Einflussgrößen wie z. B. die Inflation, das Wirtschaftswachstum oder Zinsveränderungen verwendet, die Einfluss auf die Renditen aller Wertpapiere ausüben.[43] Dabei verwendet die APT nicht das Fundament der Portfoliotheorie, sondern baut auf der Annahme der Arbitragefreiheit des Marktes auf, der zufolge kein risikoloser Gewinn (Free Lunch) durch das Ausnutzen von Marktungleichgewichten erzielt werden kann. Um im kompetitiven Markt einen Gewinn zu erzielen, muss der Anleger zwangsweise ein systematisches, nicht diversifizierbares Risiko eingehen.[44]
Sofern Arbitrage-Möglichkeiten aufgrund eines Marktungleichgewichts existieren, führen diese in einem kompetitiven Markt automatisch so lange zu Preisanpassungen, bis sich der Markt wieder im Gleichgewicht befindet. Die APT gelangt letztendlich zu einer linearen Bewertungsgleichung, die eine große Ähnlichkeit mit der Wertpapiermarktlinie des CAPM aufweist, wobei beide Modelle jedoch auf vollkommen verschiedenen Annahmen beruhen. Der APT wird aufgrund der realitätsnahen Berücksichtigung von mehreren Faktoren ein höherer Aussagegehalt und eine bessere empirische Testbarkeit zugeschrieben.[45]
2.4 Performance- und Risikomessung
2.4.1 Überblick
Im Rahmen des Portfoliomanagements kommt der Performance- und Risikomessung eine besondere Bedeutung zu. Neben der Determination der absoluten Rendite ist die Einbeziehung des Risikos, das zur Erzielung der Rendite eingegangen werden musste, von besonderer Bedeutung.[46] Darüber hinaus ist es im Rahmen der relativen Performancemessung relevant, die erzielten periodischen Ergebnisse mit einem festgelegten Benchmark, z. B. einem anderen Portfolio oder einem Aktienindex, zu vergleichen, um festzustellen, ob das Portfolio in einem vorgegebenen Zeitraum den Benchmark risikoadjustiert übertreffen konnte. Durch diese relative Erfolgsmessung kann die unmittelbare Beurteilung des aktiven Portfoliomanagements erfolgen.[47]
Auch ein entsprechendes Risikomaß, um festzustellen, unter welchem Risiko bzw. unter welcher Schwankung der Renditen die Performance erreicht werden konnte, ist unerlässlich für ein professionelles Portfoliomanagement. Dabei stellt die Volatilität, die sich als periodisierte Standardabweichung errechnet, neben dem Beta-Faktor das wohl bekannteste und am einfachsten nachvollziehbare Risikomaß dar.[48] Eine detaillierte Betrachtung sämtlicher Performance- und Risikomaße würde über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen, so dass an dieser Stelle lediglich auf die Sharpe-Ratio als Performancemaß und die Volatilität als Risikomaß eingegangen wird.
2.4.2 Sharpe-Ratio
Die Sharpe-Ratio hat sich mittlerweile sehr stark in der Performancemessung durchgesetzt und ist nach dem gleichnamigen Wirtschaftswissenschaftler benannt, der dieses Performancemaß 1966 erstmals vorstellte.[49] Dabei bildet die Portfoliotheorie den Bezugsrahmen der Sharpe-Ratio, die die Aussage trifft, dass um eine Anlage fair bewerten zu können, die Verzinsung einer risikolosen Anlage von der Gesamtperformance abgezogen werden muss.[50]
Die Sharpe-Ratio misst dabei das Verhältnis dieser Überschussrendite (Excess Return) zum eingegangenen Risiko, das durch die Volatilität ausgedrückt wird. Dabei zeigt eine positive Sharpe-Ratio, dass gegenüber der risikolosen Verzinsung eine Überschussrendite erwirtschaftet wurde und in welchem Verhältnis diese zum eingegangenen Risiko steht. Währenddessen drückt eine negative Sharpe-Ratio aus, dass noch nicht einmal die risikolose Verzinsung übertroffen wurde. Das Sharpe-Maß lässt sich auch als Risikoprämie deuten, die pro Einheit übernommenen Gesamtrisikos erzielt wird.[51]
2.4.3 Volatilität
Die Volatilität als Quadratwurzel der Varianz stellt das in der Praxis am häufigsten verwendete Risikomaß dar. Als annualisierte Standardabweichung interpretiert die Volatilität die Streuung der einzelnen Renditen eines Wertpapiers um dessen Mittelwert. Die populäre Verwendung der Volatilität beruht dabei im Wesentlichen auf der Risikodefinition, nach der das Risiko das Abweichen von erwarteten Risiken darstellt. Derartige Abweichungen können dabei sowohl positive als auch negative Ausprägungen annehmen, wobei im allgemeinen Sprachgebrauch Risiko intuitiv mit negativen Abweichungen assoziiert wird.[52]
Für die Berechnung der Volatilität werden üblicherweise Tagesrenditen verwendet, die die Wertentwicklung eines Wertpapiers von einem Tag zum nächsten reflektieren. Dabei wird die Volatilität annualisiert, um eine höhere Vergleichbarkeit sicherzustellen. Standardgemäß wird die Volatilität in zwei Varianten ermittelt und veröffentlicht, die sich entweder auf die vergangenen 30 oder 250 Börsentage beziehen. Neben diesen historischen Volatilitäten finden insbesondere bei den Derivaten implizierte Volatilitäten als Erwartungswerte Verwendung.[53]
3 Derivative Finanzinstrumente
3.1 Allgemeine Anmerkungen
Das folgende Kapitel dient als Einführung in die Grundlagen der derivativen Finanzinstrumente. Bei diesem Thema handelt es sich um einen komplexen Sachverhalt, weswegen im Rahmen dieser Arbeit schwerpunktmäßig börsengehandelte, bedingte Produkte in der Form von Aktienoptionen behandelt werden. Der interessierte Leser findet detaillierte Ausführungen zu sämtlichen derivativen Finanzinstrumenten, zu denen neben klassischen Futures und Optionen auch Zins- und Währungsderivate oder exotische Optionen gehören, in dem Standardwerk von John C. Hull.[54]
3.2 Grundidee und Entstehung von Derivaten
Die Grundidee von Derivaten sind Sicherungszwecke, um bestimmte Risiken zu versichern (Hedging) bzw. auf andere Marktteilnehmer zu transferieren. So können Derivate als Versicherung gegenüber ungünstigen Preisschwankungen verwendet werden oder um zukünftige Transaktionen bereits heute mit den gewünschten Konditionen festzuschreiben. Die Entstehung der ersten Derivate reicht fast 4.000 Jahre zurück, als Hammurabi, der damalige König von Babylon, einen Optionskontrakt in die erste Gesetzessammlung der Geschichte einfügte. Dieser Kontrakt erlaubte es den Bauern, bei Ernteausfällen den Schuldendienst für das gepachtete Land auszusetzen.[55]
Den großen Erfolg als Finanzinnovationen können Derivate jedoch erst seit Beginn der 1970er Jahre feiern, als der Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems zur Abkehr von festen Wechselkursen führte. Die darauf folgende, steigende Volatilität beim Ölpreis und starke Kursfluktuationen an den Kapitalmärkten führten zu einem verstärkten Absicherungsbedürfnis der Marktteilnehmer gegen Zins-, Preis- und Wechselkursrisiken. Begünstigt wurde die Entwicklung durch die Aufnahme des Handels mit Aktienoptionen an der „Chicago Board Options Exchange“ und vor allem durch die Arbeit der Wirtschaftswissenschaftler Fischer Black und Myron Scholes[56], die 1973 die Optionspreistheorie und damit eine theoretisch fundierte Bewertungsformel für Optionen vorstellten.[57]
Seitdem sind das Angebot an und die Nachfrage nach derivativen Produkten an den Finanzmärkten stetig gestiegen und führten letztendlich zu der Entwicklung der strukturierten Produkte wie beispielsweise der Zertifikate. Dieser Schritt öffnete die Welt der Derivate einer breiten Öffentlichkeit und insbesondere in Deutschland erfreuen sich strukturierte Produkte großer Beliebtheit. Neben der Grundidee der Derivate, dem Absichern zukünftiger Geschäfte werden heutzutage Derivate überwiegend zur Spekulation, zur Umsetzung spezifischer Markterwartungen und zur Arbitrage verwendet.[58]
3.3 Definition
Derivate (lat. = abgeleitet) sind abgeleitete Finanzinstrumente, die sich auf einen Basiswert (Underlying) wie Aktien, Aktienkörbe, Indizes, Devisen, Zinsinstrumente oder Rohstoffe beziehen. Die Preisentwicklung des Derivats ist (unter anderem) abhängig von der Preisentwicklung des jeweiligen Underlying. Im Hinblick auf die Form der Vertragserfüllung handelt es sich bei Derivaten um Termingeschäfte, wobei die Erfüllung der vertraglichen Vereinbarungen anders als bei Kassageschäften erst zu einem in den Vertragsbedingungen festgelegten, zukünftigen Zeitpunkt erfolgt.[59]
Abhängig von der Art des Termingeschäfts sind die beteiligten Parteien berechtigt oder verpflichtet einen bestimmten Basiswert zu verkaufen oder zu kaufen, wobei Zeitpunkt, Menge und Preis von vornherein festgelegt sind (siehe Abbildung 3.1).[60]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3.1: Abgrenzung Kassa- und Termingeschäft[61]
Charakteristisch für viele Derivate, insbesondere für Option oder Financial Futures, ist die Hebelwirkung, das bedeutet, dass die effektiven Investitionen im Verhältnis zu den involvierten Beträgen gering sind, so dass mit geringem Kapitaleinsatz große Beträge kontrolliert werden können. Durch diese Hebelwirkung sind die prozentualen Preisschwankungen beim Derivat wesentlich größer als die Preisschwankungen im Basiswert. Dadurch ergeben sich größere Gewinnmöglichkeiten, aber auch größere Verlustrisiken als eine Direktinvestition in den Basiswert.[62]
3.4 Charakteristika von Termingeschäften
3.4.1 Bedingte und unbedingte Termingeschäfte
Grundsätzlich können Termingeschäfte in zwei verschiedene Arten unterteilt werden, wobei die Abgrenzung hierbei über die Existenz eines Wahl- rechts erfolgt. Besteht bei beiden Vertragsparteien eine unbedingte Verpflichtung zur Leistung und Gegenleistung, handelt es sich um ein unbedingtes oder ein festes Termingeschäft. Beispielhaft sind hier insbesondere Futures, Forwards, Forward Rate Agreements und Swaps zu nennen. Bedingte Termingeschäfte hingegen zeichnen sich durch das Wahlrecht des Käufers aus, die Lieferung bzw. Abnahme des vereinbarten Gegenstandes vom Verkäufer zu verlangen oder darauf zu verzichten. Der Optionsinhaber hat folglich das Recht, jedoch nicht die Pflicht.[63]
Darüber hinaus findet selten eine tatsächliche physische Lieferung des Basiswertes statt. In den meisten Fällen findet ein so genanntes Differenzgeschäft oder Cash Settlement statt, in dem ein Barausgleich zur Erfüllung der Vertragsbedingungen realisiert wird.[64]
3.4.2 Börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Derivate
Termingeschäfte können entweder direkt über eine spezielle Terminbörse wie beispielsweise die deutsch-schweizerische EUREX gehandelt werden oder außerbörslich als so genanntes Over-the-Counter-Geschäft (OTC). Beim börslichen Handel gibt die Börse die Rahmendaten vor und jeder handelbare Terminkontrakt ist hinsichtlich der Laufzeit, des Basiswertes, der Andienungsart und der Kontraktgröße genormt. Der OTC-Handel hingegen findet außerhalb eines börslichen Marktplatzes statt und die Vertragsparteien sind hinsichtlich der Ausstattungsmerkmale vollkommen frei und können diese nach den individuellen Bedürfnissen abstimmen.[65]
OTC-Termingeschäfte sind vor allem bei institutionellen Anlegern beliebt und das Handelsvolumen übertrifft mittlerweile das der Terminbörsen. Die Vorteile beim OTC-Handel sind in den wesentlich geringeren Kosten und den Möglichkeiten der Individualität zu sehen. Beim Börsenhandel hingegen herrscht eine wesentlich höhere Fungibilität, da die genormten Finanzprodukte jederzeit von einem Market-Maker gekauft bzw. an einen Market-Maker verkauft werden können. Darüber hinaus erfolgt der Ausschluss jeglichen Kreditrisikos durch die Clearingstelle der Börse, die die Erfüllung des Termingeschäfts garantiert.[66]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3.2: OTC-Handel und Börsenhandel[67]
3.4.3 Grundformen derivativer Finanzinstrumente
3.4.3.1 Forwards
Bei einem Forward handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, einen Basiswert zu einem bestimmten, zukünftigen Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Vertragspartei nimmt dabei die Short-Position (Verkaufsposition) ein und verpflichtet sich, den Basiswert zum vereinbarten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen. Die andere Vertragspartei nimmt die Long-Position (Kaufposition) ein und verpflichtet sich, den Basiswert zum vereinbarten Zeitpunkt und Preis zu kaufen.[68] Ein Forward ist ein unbedingtes, außerbörsliches Geschäft und es gibt so gut wie kein Finanzinstrument, das nicht in der Form eines Forwards handelbar sein könnte. In der Praxis werden Forwards vor allem auf Devisen und Zinsprodukte eingesetzt, um beispielsweise Exporte gegen eine ungünstige Währungskursentwicklung abzusichern.[69]
3.4.3.2 Futures
Im Prinzip funktioniert ein Future genauso wie ein Forward. Zwei Vertragsparteien treffen die Vereinbarung, einen Basiswert zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis auszutauschen. Futures sind jedoch standardisierte, börsengehandelte Produkte, so dass die Ausgestaltung des Kontraktes von der Börse definiert wird. Es wird grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Arten von Futures unterschieden: Commodity Futures beziehen sich auf Rohstoffe und Financial Futures auf Finanztitel wie beispielsweise Aktienindizes. Letztere zählen zu den populärsten Future-Kontrakten, so dass im Folgenden der an der EUREX gehandelte DAX-Future vorgestellt wird.[70]
Der DAX-Future wurde im November 1990 erstmals zum Handel angeboten und bietet die Möglichkeit, den Deutschen Aktienindex auf Termin zu kaufen und zu verkaufen, ohne dreißig verschiedene Einzeltransaktion der einzelnen DAX-Werte durchführen zu müssen. Darüber hinaus erlaubt der Future, durch so genanntes Short Selling (Leerverkäufe) eine einfache Spekulation auf fallende Kurse ohne umständliche Leihgeschäfte abschließen zu müssen.[71] Der Fälligkeitszeitpunkt der einzelnen Kontrakte ist dabei von der EUREX vorgeschrieben und bezieht sich immer auf den dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember. Durch die Konzentration auf nur vier Termine im Jahr sind der Umsatz und die Liquidität der einzelnen Kontrakte außergewöhnlich hoch und ein permanenter Handel wird ermöglicht.[72]
Darüber hinaus wird auch die Kontraktgröße des DAX-Futures von der Börse vorgegeben und einem Future liegen 25 einzelne DAX-Indizes zugrunde, wobei jeder Indexpunkt einem Euro entspricht. So muss der Käufer eines DAX-Futures zum Kurs von 7.000 Punkten am Ende der Laufzeit insgesamt 175.000 Euro bezahlen. Es ist jedoch nur eine Einschusszahlung in der Form einer Margin notwendig, die für das jeweilige Geschäft von der Börse berechnet wird und erfahrungsgemäß zwischen 8.000 und 10.000 Euro liegt. Durch diese Hebelwirkung kann mit einer kleinen Investition eine große Summe von 175.000 Euro bewegt werden.[73]
3.4.3.3 Optionen (Traded Options)
Unter einer Option versteht man das Recht des Käufers, eine bestimmte Ware in einer bestimmten Menge bis zu einem festgelegten Zeitpunkt zum festgelegten Preis (Strike) zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn es sich bei der Option um eine Kaufoption handelt, wird diese als Call bezeichnet und wenn es sich um eine Verkaufsoption handelt, wird diese als Put bezeichnet. Der Verkäufer der Option, der auch als Stillhalter oder Schreiber der Option bezeichnet wird, hat die Pflicht, dem Käufer, sofern dieser sein Recht ausübt, den Basiswert zu liefern (Call) bzw. abzunehmen (Put). Für das Einräumen des Optionsrechts erhält der Stillhalter der Option eine Optionsprämie vom Käufer, welche gleichzeitig den Preis darstellt, zu dem die Option am Markt gehandelt wird.[74] Die folgende Tabelle 3.1 stellt die Rechte und Pflichten der einzelnen Vertragsparteien dar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3.1: Rechte und Pflichten der Optionskäufer und-verkäufer[75]
Hinsichtlich der Art der Ausübung lassen sich europäische Optionen, bei denen die Ausübung erst am Fälligkeitstag möglich ist, von amerikanischen Optionen differenzieren, bei denen die Ausübung während der gesamten Laufzeit möglich ist.[76] Optionen werden genauso wie andere Termingeschäfte über eine Terminbörse oder alternativ außerbörslich gehandelt. Grundsätzlich können Optionen dabei auf sämtliche verfügbaren Basiswerte zielen, wobei sich an den Terminbörsen insbesondere Aktienoptionen (Equity Options) auf Blue Chips und Aktienindizes großer Beliebtheit erfreuen. Anders als bei Futures wird an Terminbörsen darauf geachtet, dass für jeden Fälligkeitstermin (Verfallsmonat) ein großes Angebotsspektrum von Optionen in allen Zuständen bereit steht, so dass die Börsenteilnehmer ihr jeweilige Strategie auch garantiert umsetzen können.[77]
3.4.3.4 Optionsscheine (Warrants)
Optionen, Futures und Forwards haben die Gemeinsamkeit, dass diese Termingeschäfte nur im außerbörslichen Handel oder über spezielle Terminbörsen wie die EUREX handelbar sind. Aufgrund der aufwändigen Vertragsregelungen und der hohen Mindestbeträge werden diese derivativen Finanzinstrumente v. a. von institutionellen und professionellen Anlegern genutzt. Um auch Privatanlegern die Möglichkeit zu bieten, Derivate zu handeln, wurden Anfang der 1990er Jahre die ersten Optionsscheine in Deutschland eingeführt. Warrants sind eng verwandt mit klassischen Optionen und ihnen liegt die gleiche Theorie und Funktionsweise zugrunde. Bei einem Optionsschein handelt es sich jedoch um ein Wertpapier, was bedeutet, dass die Rechte und Pflichten beider Vertragsparteien durch die Ausgabe von Urkunden durch den Emittenten verbrieft sind.[78] So können Warrants, anders als unverbriefte Titel wie klassische Optionen, an regulären Kassabörsen gehandelt und daher ohne weiteres über ein bereits bestehendes Wertpapierdepot geordert werden. Da jedoch Warrants aufgrund der Verbriefung nur von emissionsfähigen Marktteilnehmern stammen können, fungieren in der Regel Banken als Schreiber des Optionsscheins und nicht einzelne Marktteilnehmer. Ein weiterer wichtiger Vorteil aus Sicht des Privatanlegers ist das große Bezugsverhältnis (Ratio). Die meisten Warrants werden in einem Bezugsverhältnis zum Basiswert von eins zu zehn oder eins zu hundert emittiert, so dass der Kaufpreis sehr attraktiv gestaltet ist.[79]
3.5 Options-Positionen
3.5.1 Kauf eines Call (Long Call)
Durch den Kauf einer Call-Option erwirbt der Käufer das Recht, vom Stillhalter oder Schreiber der Option das zugrunde liegende Underlying zum vereinbarten Preis (Strike) und innerhalb einer bestimmten Frist oder zu einem bestimmten Termin geliefert zu bekommen.[80]
Die folgende Abbildung 3.3 verdeutlicht den Charakter eines Long Call und dessen asymmetrisches Risikoprofil. Aus Sicht des Käufers steht einem theoretisch unbegrenzten Gewinn ein Verlustrisiko in Form der Optionsprämie gegenüber. Auf der Ordinate des Diagramms ist der Gewinn bzw. der Verlust der Call-Option dargestellt, auf der Abszisse die Entwicklung des Aktienkurses des zugrunde liegenden Underlying.
[...]
[1] Vgl. Garz (2006), S. 13.
[2] Vgl. Deutsches Aktieninstitut (2006), Abb. 08.3-Zahl-D.
[3] Vgl. Garz (2006), S. 13. Spremann (2003), S. 4.
[4] Vgl. Aulibauer; Thießen (2002a), S. 73. Marx (1996), S. 50.
[5] Vgl. Rudolph; Schäfer (2005), S. 1ff.
[6] Vgl. Moriabadi (2006), S. 251. Rudolph; Schäfer (2005), Vorwort.
[7] Vgl. Müller-Möhl (1995), S. 17. Beike; Schlütz (2005), S. 467.
[8] Unter Arbitrage wird allgemein die Erzielung von risikolosen Gewinnen durch das Ausnutzen von Marktungleichgewichten verstanden. Vgl. Steiner; Bruns (2002), S. 17.
[9] Vgl. Markowitz (1952), S. 77ff. Leupold (1996), S. 12.
[10] Vgl. Markowitz (1959).
[11] Vgl. Aulibauer; Thießen (2002a), S. 73. Vgl. Marx (1996), S. 50.
[12] Vgl. Markowitz (1952), S. 77. Markowitz (1991), S. 206.
[13] Vgl. Markowitz (1991), S. 206. Steiner; Bruns (2002), S. 7, S. 9.
[14] Vgl. Steiner; Bruns (2002), S. 8. Leupold (1996), S. 7ff.
[15] Vgl. Marx (1996), S. 50. Steiner; Bruns (2002), S. 8.
[16] Vgl. Aulibauer; Thießen (2002a), S. 77.
[17] Vgl. Bruns; Meyer-Bullerdiek (2003), S. 72.
[18] Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Reilly; Brown (2006), S. 221.
[19] Vgl. Bruns; Meyer-Bullerdiek (2003), S. 73. Michaud (1998), S. 9.
[20] Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Reilly; Brown (2006), S. 221. Michaud (1998),
S. 2.
[21] Vgl. Steiner; Bruns (2002), S. 10. Schmidt-von Rhein (1996), S. 230ff.
[22] Vgl. Markowitz (1952), S. 77. Markowitz (1952), S. 89.
[23] Vgl. Steiner; Bruns (2002), S. 15.
[24] Vgl. Steiner; Bruns (2002), S. 15.
[25] Vgl. Markowitz (1952), S. 77. Steiner; Bruns (2002), S. 15. Kempf; Memmel (2002),
S. 896.
[26] Vgl. Sharpe (1963), S. 277ff.
[27] Vgl. Elton u. a. (2003), S. 130. Marx (1996), S. 60. Steiner; Bruns (2002), S. 16.
[28] Vgl. Aulibauer; Thießen (2002a), S. 73. Steiner; Bruns (2002), S. 16.
[29] Vgl. Breuer; Gürtler; Schuhmacher (2004), S. 301. Schmidt-von Rhein (1996), S. 272.
[30] Vgl. Schmidt-von Rhein (1996), S. 273. Steiner; Bruns (2002), S. 17.
[31] Vgl. Sharpe (1964), S. 425ff. Lintner (1965), S. 13ff. Mossin (1966), S. 768ff.
[32] Vgl. Beike; Schlütz (2005), S. 165.
[33] Vgl. Spremann (2003), S. 253. Beike; Schlütz (2005), S. 165.
[34] Vgl. Bruns; Meyer-Bullerdiek (2003), S. 75.
[35] Vgl. Bruns; Meyer-Bullerdiek (2003), S. 76.
[36] Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Bruns; Meyer-Bullerdiek (2003), S. 76.
[37] Vgl. Reilly; Brown (2006), S. 240. Bruns; Meyer-Bullerdiek (2003), S. 77.
[38] Vgl. Reilly; Brown (2006), S. 240. Spremann (2003), S. 256.
[39] Vgl. Beike; Schlütz (2005), S. 167f. Bruns; Meyer-Bullerdiek (2003), S. 78.
[40] Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Brealey; Myers; Marcus (2004), S. 303.
[41] Vgl. Ross (1976), S. 341ff.
[42] Vgl. Garz (2006), S. 74. Aulibauer; Thießen (2002b), S. 109.
[43] Vgl. Reilly; Brown (2006), S. 271. Garz (2006), S. 74.
[44] Vgl. Garz (2006), S. 75. Steiner; Bruns (2002), S. 17.
[45] Vgl. Garz (2006), S. 75ff.
[46] Vgl. Wittrock (2002), S. 956.
[47] Vgl. Wittrock (2002), S. 956. Bruns; Meyer-Bullerdiek (2003), S. 518.
[48] Vgl. Steiner; Bruns (2002), S. 601.
[49] Vgl. Sharpe (1966), S. 119ff.
[50] Vgl. Spremann (2003), S. 316.
[51] Vgl. Kempf; Memmel (2002), S. 914. Steiner; Bruns (2002), S. 604.
[52] Vgl. Bruns; Meyer-Bullerdiek (2003), S. 10. Beike; Schlütz (2005), S. 156.
[53] Vgl. Natenberg (1994), S. 72ff. Beike; Schlütz (2005), S. 157.
[54] Vgl. Hull (2003).
[55] Vgl. Beike; Barckow (1998), S. 11. Beike; Schlütz (2005), S. 458.
[56] Vgl. Black; Scholes (1973), S. 637ff.
[57] Vgl. Rudolph; Schäfer (2005), S. 13. Beike; Schlütz (2005), S. 459.
[58] Vgl. Moriabadi (2006), S. 274. Beike; Barckow (1998), S. 11f.
[59] Vgl. Müller-Möhl (1995), S. 17. Eller (1996), S. 8. Hausmann; Diener; Käsler (2002),
S. 58.
[60] Vgl. Schmidt (2002), S. 3.
[61] Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Beike; Schlütz (2005), S. 460.
[62] Vgl. Müller-Möhl (1995), S. 17f.
[63] Vgl. Müller-Möhl (1995), S. 22. Rudolph; Schäfer (2005), S. 14.
[64] Vgl. Rudolph; Schäfer (2005), S. 14. Beike; Schlütz (2005), S. 531.
[65] Vgl. Hull (2003), S. 1f. Müller-Möhl (1995), S. 29f. Beike; Schlütz (2005), S. 476.
[66] Vgl. Hull (2003), S. 2. Beike; Schlütz (2005), S. 478ff.
[67] Eigene Darstellung, in Anlehnung an: Beike; Schlütz (2005), S. 476.
[68] Vgl. Reilly; Brown (2006), S. 808. Beike; Barckow (1998), S. 2.
[69] Vgl. Brealey; Myers; Marcus (2004), S. 673. Beike; Barckow (1998), S. 11f.
[70] Vgl. Steiner; Bruns (2002), S. 454. Reilly; Brown (2006), S. 808. Brealey; Myers;
Marcus (2004), S. 672.
[71] Vgl. Beike; Schlütz (2005), S. 531, 533f. Hull (2003), S. 41f.
[72] Vgl. Steiner; Bruns (2002), S. 486.
[73] Vgl. Steiner; Bruns (2002), S. 486. Beike; Schlütz (2005), S. 533f.
[74] Vgl. Ebneter (1987), S. 13. Welcker; Kloy; Schindler (1992), S. 24f. Rudolph; Schäfer (2005), S. 22.
[75] In Anlehnung an: Ebneter (1987), S. 13.
[76] Vgl. Reilly; Brown (2006), S. 812.
[77] Vgl. Beike; Schlütz (2005), S. 559, 602.
[78] Vgl. Beike; Schlütz (2005), S. 626. Rudolph; Schäfer (2005), S. 67.
[79] Vgl. Steiner; Bruns (2002), S. 422. Beike; Schlütz (2005), S. 626.
[80] Vgl. Welcker; Kloy; Schindler (1992), S. 53.
- Arbeit zitieren
- Lukas Henatsch (Autor:in), 2007, Optimierungsstrategien für Wertpapierportfolios, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76282
Kostenlos Autor werden

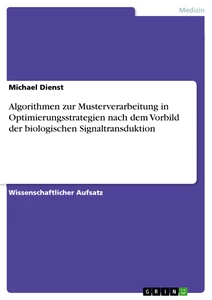



Kommentare