Excerpt
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit
2 Geschäftsprozessmanagement
2.1 Geschäftsprozessmodellierung
2.2 ARIS & ARIS-Konzept
2.3 Ereignisgesteuerte Prozesskette
3 Geschäftsprozessoptimierung „Bereitstellung Hard-/Software für einen Computerarbeitsplatz“
3.1 IST-Analyse
3.2 SOLL-Konzept
3.2.1 Prozesslandkarte
3.2.2 EPK zum Teilprozess „Erstbereitstellung eines CAP“
4 Fazit
Quellenverzeichnis
Anhang A Möglichkeiten zur Konfiguration eines Computers
Anhang B Anforderungen an den SOLL-Prozess
Anhang C Prozesslandkarte: Lifecycle eines Arbeitsplatzsystems
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: ARIS-Haus
Abbildung 2: ARIS EPK-Element - Ereignis
Abbildung 3: ARIS EPK-Element - Funktion / Aktivität
Abbildung 4: ARIS EPK-Element - Logische Operatoren / Konnektoren
Abbildung 5: ARIS EPK-Element - Organisatorische Einheit
Abbildung 6: ARIS EPK-Element - Informationsobjekt
Abbildung 7: ARIS EPK-Element - Anwendungssystem / IT-System
Abbildung 8: Ausschnitt 1/4 der VVK - Bedarfsmeldung durch MA
Abbildung 9: Ausschnitt 2/4 der VVK - Erfassung und Klassifizierung der Meldung
Abbildung 10: Ausschnitt 3/4 der VVK - Ermittlung und Beschaffung der Komponenten
Abbildung 11: Ausschnitt 4/4 der VVK - Bereitstellung der Komponenten
Abbildung 12: Ausschnitt der Prozesslandkarte zum Lifecycle eines CAP
Abbildung 13: Ausschnitt 1/7 der EPK - Bedarfsklärung
Abbildung 14: Ausschnitt 2/7 der EPK - Bedarfsmeldung (Teil 1)
Abbildung 15: Atomarer Prozess zur EPK - Ermittlung des Bereitstellungszeitraums .
Abbildung 16: Ausschnitt 3/7 der EPK - Bedarfsmeldung (Teil 2)
Abbildung 17: Ausschnitt 4/7 der EPK - Beschaffung der Komponenten
Abbildung 18: Ausschnitt 5/7 der EPK - Vorbereitung zur Bereitstellung (Teil 1)
Abbildung 19: Ausschnitt 6/7 der EPK - Vorbereitung zur Bereitstellung (Teil 2)
Abbildung 20: Ausschnitt 7/7 der EPK - Bereitstellung der Komponenten
Abkürzungsverzeichnis
AiO All-in-One-Rechner
AL Abteilungsleiter
ARIS Architektur integrierter Informationssysteme
BPMN Business Process Model and Notation
CAP Computerarbeitsplatz
eEPK erweitere ereignisgesteuerte Prozesskette
EPK ereignisgesteuerte Prozesskette
GPM Geschäftsprozessmanagement
MA Mitarbeiter
VVK vereinfachte Vorgangskette
WT Werktage
1 Einleitung
Der Online-Shop eines deutschen Versandhandels für Unterhaltungselektronik bietet 80 Quadrilliarde1 Möglichkeiten zur Konfiguration eines Computers. Dabei wird die Minimalausstattung betrachtet, die aus den folgenden Komponenten besteht: Gehäuse, Mainboard, Grafikkarte, Festplatte, Betriebssystem, Prozessor, Arbeitsspeicher, Eingabegeräte wie Maus und Tastatur sowie Ausgabegeräte wie Bildschirme und Drucker.
Diese große Anzahl an Möglichkeiten zur Konfiguration eines Computers resultiert in einer heterogenen Hardwarelandschaft. Dies kann zu aufwändigen Vorgängen in der Bestellung, Beschaffung sowie Konfiguration & Wartung der Geräte führen. Zusätzliche Schwierigkeiten oder ggf. Ausfälle können durch verschiedene Treiber- und Softwareinstallationen entstehen. Dadurch können Verluste in den wertschöpfenden Aktivitäten eines Unternehmens resultieren.
Dieser Gefahr kann zum Beispiel durch die Vereinheitlichung der Prozesse und die Verwendung einer Software zur Unterstützung dieser Prozesse entgegengewirkt werden.
1.1 Problemstellung
Die Wir können alles GmbH ist ein größeres Unternehmen und befindet sich aktuell in einer ähnlichen Situation wie der zuvor Beschriebenen. Bedarfsmeldungen für Hard- und Software werden aktuell unregelmäßig und über verschiedene Eingangskanäle durch Mitarbeiter (MA) selbst an die IT-Abteilung gestellt. Nicht nur geeignete Bereitstellungstermine oder unnötige Bedarfsmeldungen, sondern auch eine schwer wartbare heterogene Hardwarelandschaft resultieren aus dieser Situation.
Die Reorganisation und Optimierung dieser Prozesse sollen dem Unternehmen dabei helfen, die Bereitstellung eines Computerarbeitsplatz (CAP) bedarfsorientiert, effizient und zum benötigten Termin sicherzustellen. Durch reibungslose und effiziente SupportProzesse können die MA und somit das Unternehmen selbst auf die wertschöpfenden Aktivitäten fokussieren.
1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit
Diese Arbeit soll zuerst ein Grundverständnis zur Geschäftsprozessmodellierung anhand der ARIS EPK Methode herbeiführen. Fragen wie Was ist Geschäftsprozessmodellierung?, Was ist ARIS? und Was ist eine EPK? sollen dadurch beantwortet werden. Darauf aufbauend soll die Optimierung eines Geschäftsprozesses am Beispiel der Bereitstellung von Hard- und Software auf Basis der zuvor vorgestellten Methode vorgenommen werden, um der Wir können alles GmbH Handlungsempfehlungen bzw. Verbesserungspotentiale aufzuzeigen.
In Kapitel 2 werden die Begriffe Prozess, Geschäftsprozess sowie Geschäftsprozessmanagement (GPM) und Geschäftsprozessmodellierung definiert. Anschließend werden das ARIS-Konzept und die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) sowie deren Bestandteile vorgestellt.
In Kapitel 3 erfolgt die Geschäftsprozessoptimierung zur Bereitstellung von Hard-und Software für einen CAP. In Anlehnung an das Vorgehen zur Geschäftsprozessoptimierung nach Scheer2 wird zuerst eine IST-Analyse durchgeführt, um „eine bessere Einsicht in die Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten der bestehenden Organisation zu erhalten.“3 Anschließend wird das Soll-Konzept entwickelt. Anhand der erstellten EPK wird das „erwünschte, ideale Prozessverhalten“4 beschrieben.
Das Fazit fasst die Erkenntnisse aus der IST-Analyse und die Handlungsempfehlungen aus dem Soll-Konzept an die Wir können alles GmbH zusammengefasst. Abschließend erfolgt eine kritische Betrachtung der Ergebnisse.
2 Geschäftsprozessmanagement
Voraussetzung für die Einordnung des Begriffs Geschäftsprozessmanagements ist die Klärung der Begriffe Prozess und Geschäftsprozess. Die Untersuchung von Hilmer hat gezeigt, dass es keine eindeutige Definition und Abgrenzung dieser beiden Begriffe in der Literatur gibt.5 In der vorliegenden Arbeit werden diese wie folgt definiert:
- Ein Prozess wird als „wiederholbare, zeitlich-logische (sequenzielle bzw. parallele) Abfolge von Aktivitäten [...] zur zielgerichteten Erledigung einer betrieblichen Aufgabe“6 definiert. Dabei sind Anfang und Ende eindeutig erkennbar. Die Transformation des Input zum Output während des Prozessablaufs wird Prozessleistung genannt.7
- Geschäftsprozesse sind betriebliche Prozesse, „die in und zwischen Unternehmen ablaufen können [...] [und die] eigentliche, wertschöpfende Unternehmensleistung [erzeugen]. Sie dienen also dem eigentlichen Geschäftszweck [...] oder sind von strategischer, erfolgskritischer Bedeutung“8.
Geschäftsprozesse weisen somit zusätzliche, spezifische und auf das Unternehmen ausgerichtete Merkmale9 auf. Dennoch sollen im Weiteren die Begriffe Prozess und Geschäftsprozess zur Vereinfachung synonym verwendet werden.
Das Geschäftsprozessmanagement umfasst einfach formuliert die Dokumentation, Analyse bzw. Kontrolle und Restrukturierung von Arbeitsabläufen bzw. Prozessen. Essenziell ist dabei die Ausrichtung auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse, da diese die Prozesse auslösen und Empfänger des Ergebnisses sind. Damit wirkt sich das GPM auf strategische und operative Unternehmensziele aus.10
Das GPM verfolgt die folgenden Ziele:
- Steigerung der Prozesseffizienz, bspw. durch Vereinfachung oder Reduzierung von Prozessschleifen.
- Erhöhung des Kundennutzens, bspw. durch Minimierung der Durchlaufzeit.
- Verstärkung der Prozesstransparenz, insbesondere durch die Geschäftsprozessmodellierung.11
2.1 Geschäftsprozessmodellierung
„Die Geschäftsprozessmodellierung dient der Darstellung von Geschäftsprozessen und Sachverhalten, die für die Gestaltung von Prozessen relevant sind, wie z.B. die Aufbauorganisation oder Datenstrukturen.“12 Zu den in der Praxis häufig vertretenen Modellierungsmethoden gehören bspw. Prozesslandkarten, Prozesssteckbriefe, tabellarische Notationen, Swimlane-Diagramme, EPK und Business Process Model and Notation (BPMN).13 Durch die Erstellung und Verwendung von Modellen können komplexe Geschäftsprozesse, die besonders für Außenstehende nur schwer nachvollziehbar sind, in vereinfachter bzw. abstrahierter Form abgebildet werden.
Insbesondere bei großen Projekten und einer Vielzahl an Beteiligten empfiehlt sich die Festlegung von Modellierungskonventionen. Durch „verbindlich vereinbarte Regeln zur einheitlichen Modellierung“14 können eine bessere Kommunikation sowie ein besseres Verständnis erzielt werden.
Darüber hinaus existieren seit 1995 folgende Grundsätze ordnungsgemäßer Modellierung (GoM):
1. Grundsatz der Richtigkeit
„Ein Modell ist syntaktisch richtig, wenn es alle Regeln, die die Modellierungssprache vorgibt, einhält.“15 Das Modell erfüllt somit alle formalen Ansprüche. Dies gibt keinerlei Auskunft über die Qualität des Inhalts.
„Ein Modell ist dann semantisch richtig, wenn im Diskurs der Gutwilligen und Sachkundigen eine Einigung erzielt worden ist.“16 Das bedeutet, dass mehrere Personen, die eine gewisse Expertise in dem zu dokumentierenden Bereich aufzeigen, ein gemeinsames Verständnis über den Modellinhalt erlangen sollen.
2. Grundsatz der Relevanz
Ein Modell soll nur die Sachverhalte beinhalten, „die für den zugrunde liegenden Modellierungszweck relevant sind.“17 Der Zweck wird anhand Modellierungszielen formuliert, die anschließend zur Bestimmung des geeigneten Abstraktionsniveaus verwendet werden. Ein wesentlicher Bestandteil des Modellierungszwecks ist die Adressatengruppe.
3. Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
Ein Modell soll im Sinne der Wirtschaftlichkeit so erstellt werden, „dass ein gegebenes Modellierungsziel mit minimalem Aufwand erreicht werden“18 kann. Die entstehenden Modellierungskosten müssen in einem angemessenen Verhältnis zu dem aus dem Modell resultierenden Nutzen stehen. Eine Möglichkeit zur Reduzierung der Kosten besteht in der Orientierung an oder sogar der Verwendung von Referenzmodellen: Bereits in der Branche etablierte Modelle können übernommen und entsprechend der unternehmensspezifischen Eigenheiten adaptiert werden.
4. Grundsatz der Klarheit
Ein Modell soll so gestaltet werden, dass es von der Adressatengruppe möglichst intuitiv verstanden wird. Die Wahl eines geeigneten Layouts, die Anordnung der Objekte sowie die einheitliche Gestaltung sollen insbesondere die „leichte Lesbarkeit, Anschaulichkeit und Verständlichkeit“19 sicherstellen. Auch hier variieren die Ausprägungen je nach Adressatengruppe.
5. Grundsatz der Vergleichbarkeit
Ein Modell soll mit anderen Modellen semantisch vergleichbar sein. Das bedeutet für Modelle innerhalb einer Modellierungssprache, dass identische „Abläufe der Realwelt und der Vorstellungswelt [...] im Modell voll identisch“20 abgebildet sind. Modelle in unterschiedlichen Modellierungssprachen müssen ineinander überführbar sein, damit sie miteinander verglichen werden können.21
6. Grundsatz des systematischen Aufbaus
Modelle und deren Objekte sollten in einem System angeordnet werden, damit eine sichtenübergreifende Modellierung möglich ist. Sachverhalte können so aus unterschiedlichen Sichten22, bspw. Organisationssicht und Funktionssicht, beschrieben werden und dieselben Objekte verwenden, wie z.B. eine Organisationseinheit. Dadurch bleibt das Gesamtmodell konsistent.23
2.2 ARIS & ARIS-Konzept
Die Abkürzung ARIS ist im Bereich des GPM wohl geläufiger als die Ausformulierung: Architektur integrierter Informationssysteme. ARIS steht zum einen für das bekannteste Konzept zur Beschreibung und Abbildung von Unternehmen und deren Prozesse, zum anderen für die Software-Platform24 der Software AG.
Kern des ARIS-Konzepts ist die ARIS-Architektur. Diese wird aufgrund des schematischen Aufbaus, siehe Abbildung 1, auch ARIS-Haus genannt. Darin werden die unterschiedlichen Sichten und Modellierungsphasen dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: ARIS-Haus
Quelle: Scheer (2020), S. 73, in Anlehnung an Scheer (2002), S. 37.
Unter einer Sicht wird die “Zusammenfassung von Klassen mit ihren Beziehungen [...] zur Strukturierung und damit zur Vereinfachung des Geschäftsprozessmodells”25 verstanden. Folgende Sichten26 werden im ARIS-Konzept unterschieden27:
- Die Organisationssicht beschreibt die Aufbauorganisation des Unternehmens und besteht somit aus dessen Organisationseinheiten, Personen, Rollen, Stellen oder auch externen Partnern. Zur Abbildung der hierarchischen Strukturen werden Organigramme modelliert.
- Die Datensicht umfasst die Informationsobjekte28 des Unternehmens sowie deren Beziehungen zueinander. Hierzu dienen Entity-Relationship-Diagramme.
- Die Funktionssicht beinhaltet die betrieblichen Aktivitäten bzw. Vorgänge des Unternehmens. Mit Hilfe von Funktionsbäumen werden diese und deren Beziehungen zueinander dargestellt.
- Die Leistungssicht stellt die Produkte des Unternehmens in einem Produktmodell zusammen. Dazu zählen sowohl die materiellen als auch die immateriellen Leistungen.
- Die Steuerungssicht ist zentrale Sicht im ARIS-Konzept und integriert die obigen Teilsichten. Dadurch ist die Beschreibung der Geschäftsprozesse bspw. in Form von erweiterten ereignisgesteuerten Prozessketten29 möglich. Aus diesem Grund wird diese Sicht als Prozesssicht bezeichnet.
In ARIS werden die folgenden Projektphasen zur Geschäftsprozessmodellierung unterschieden30:
1. Im Fachkonzept wird das betriebswirtschaftliche Problem aus AnwenderPerspektive beschrieben. Es dient als Ausgangspunkt für die Gestaltung der IT- Lösungen.
2. Im Design, das häufig in der Literatur auch als IT-Konzept bzw. Datenverarbeitungs-Konzept bezeichnet wird, wird das Fachkonzept an die gestellten Anforderungen zur technischen Umsetzung angepasst.
3. Die Implementierung beinhaltet die Umsetzung des Designs in konkrete IT- Produkte, wie Hard- und Softwarekomponenten.
2.3 Ereignisgesteuerte Prozesskette
Wie bereits zuvor erwähnt, ist die EPK zentraler Teil des ARIS-Konzepts innerhalb der Steuerungssicht. Sie stellt den „zeitlich-logischen Ablauf von Funktionen und eine Verknüpfung der Elemente des Daten- und des Funktionsmodells dar.“31 Die EPK wird als „Entwurfsmodell zur Abbildung von Abläufen und Vorgängen [definiert]. Grundelemente einer ereignisgesteuerten Prozesskette sind Ereignisse und dadurch ausgelöste Funktionen, die durch logische Operatoren miteinander in Beziehung gesetzt werden.“32
Werden zur Modellierung weitere Informationen über Input-/Output-Daten, Organisationseinheiten oder Rollen bzw. Stellen sowie Anwendungssysteme benötigt, kann die EPK um diese ergänzt werden. Dann spricht man von einer erweiterten EPK (eEPK).33
Im Folgenden werden die Elemente der EPK bzw. eEPK, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit zur Geschäftsprozessmodellierung verwendet werden, aufgezeigt und erläutert. Die Darstellung der Elemente hat sich im Laufe der Zeit verändert. Die unten abgebildeten Grafiken sind dem Produkt ARIS Express 2.4d entnommen.
- Ein Ereignis ist ein eingetretener Zustand eines materiellen oder informatorischen Objektes. Die Zustandsbeschreibung sollte als „zeitpunktbezogenes Partizip II des verrichtenden Verbs“34 gebildet werden. Ereignisse gehören der Datensicht an.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: ARIS EPK-Element – Ereignis
Quelle: ARIS Express 2.4d
- Eine Funktion bzw. Aktivität beschreibt die „Durchführung eines betrieblichen Vorgangs, der zur Erfüllung eines Unternehmensziels beiträgt.“35 Sie werden durch bestimmte Ereignisse ausgelöst und enden in einem neuen Ereignis.36 Während der Funktionsausführung können Input-Daten zu Output-Daten verarbeitet werden. Funktionen gehören der Funktionssicht an.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: ARIS EPK-Element - Funktion / Aktivität
Quelle: ARIS Express 2.4d
- Logische Operatoren bzw. Konnektoren werden zur Abbildung von ProzessVerzweigungen und -Zusammenführungen verwendet.37 Sie „beschreiben die logische Verknüpfung von Ereignissen und Funktionen“38. Man unterscheidet dabei zwischen UND, ODER bzw. inklusives ODER und XOR bzw. exklusives O- DER.39
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: ARIS EPK-Element - Logische Operatoren / Konnektoren
Quelle: ARIS Express 2.4d
[...]
1 Eine Quadrilliarde besteht aus einer Eins mit 27 folgenden Nullen. Die Zahl wurde stark vereinfacht berechnet und ist symbolisch zu verstehen. Die Berechnung ist in Anhang A beschrieben.
2 Vgl. Scheer (2002), S: 149 ff.
3 Scheer (2020), S. 77.
4 Scheer (2020), S. 77.
5 Vgl. Hilmer (2016), S.30 ff. und Hilmer (2016), S. 268 ff.
6 Seidlmeier (2019), S. 7.
7 Vgl. Seidlmeier (2019), S. 7.
8 Seidlmeier (2019), S. 8.
9 Eine Zusammenstellung der in verschiedenen Literaturquellen übereinstimmenden Merkmalen von Geschäftsprozessen ist in Staud (2006), S. 7 f. nachzulesen.
10 Vgl. Gadatsch (2020), S. 1 f. und Seidlmeier (2019); S. 4 f.
11 Vgl. Lassmann (2006), S. 299.
12 Allweyer (2005), S. 94.
13 Vgl. Gadatsch (2020), S. 87.
14 Seidlmeier (2019), S. 61.
15 Becker et al. (2012), S. 32.
16 Becker et al. (2012), S. 32 f.
17 Becker et al. (2012), S. 33.
18 Becker et al. (2012), S. 34.
19 Becker et al. (2012), S. 35.
20 Becker et al. (2012), S. 36.
21 Vgl. Becker et al. (2012), S. 36.
22 Eine mögliche Aufteilung der Sichten nach Scheer (2002) wird in Abschnitt 2.2 dargestellt.
23 Vgl. Becker et al. (2012), S. 36.
24 Eine Auflistung der ARIS Produkte ist unter https://www.softwareag.com/corporate/products/az/default . html zu finden. (Zugriff am 03.05.2020)
25 Scheer (2002), S. 33.
26 Anschauliche Modell-Beispiele zu den einzelnen ARIS-Sichten sind Seidlmeier (2019), S. 21-27 zu entnehmen.
27 Vgl. Scheer (2002), S. 36 und Gadatsch (2020), S. 105.
28 Der Begriff Informationsobjekt wird im folgenden Abschnitt 2.3 erläutert.
29 Die Begriffe ereignisgesteuerte Prozesskette und erweiterte ereignisgesteuerte Prozesskette werden im folgenden Abschnitt 2.3 erläutert.
30 Vgl. Gadatsch (2020), S. 104.
31 Keller et al. (1992), S. 15.
32 Lackes/Siepermann.
33 Vgl. Seidlmeier (2019), S. 83.
34 Seidlmeier (2019), S. 82.
35 Keller et al. (1992), S. 10.
36 Vgl. Seidlmeier (2019), S. 81.
37 Vgl. Seidlmeier (2019), S. 93 f.
38 Gadatsch (2020), S. 123.
39 In Seidlmeier (2019), S. 86 f. werden die erlaubten Verknüpfungen von Ereignissen und Funktionen durch logische Operatoren erläutert.
- Quote paper
- Steven Wolter (Author), 2020, Geschäftsprozessoptimierung in Anwendung der Modellierungstechnik "Ereignisgesteuerte Prozessketten", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1001754
Publish now - it's free
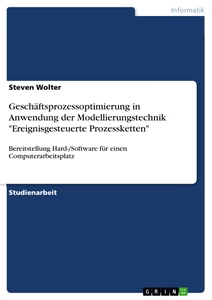
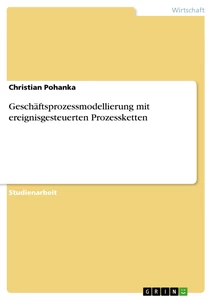
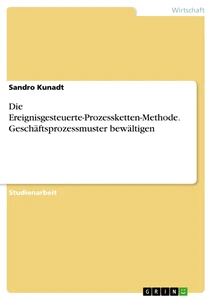
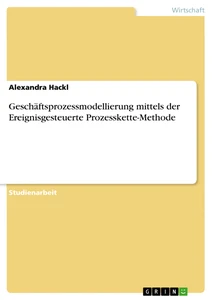
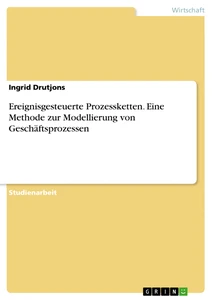

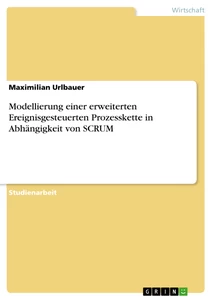
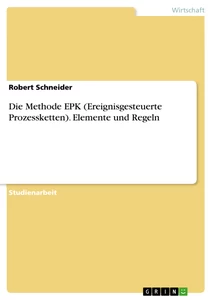
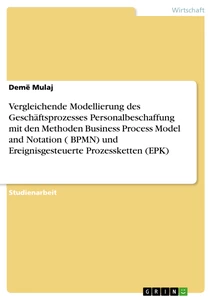



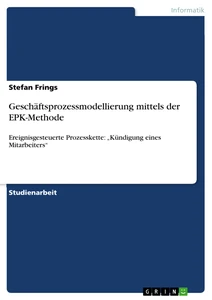
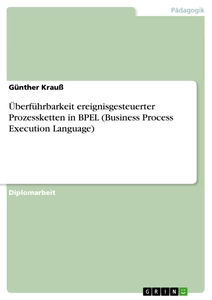

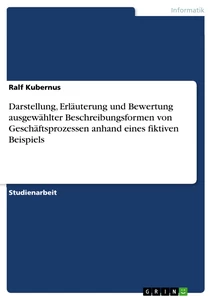
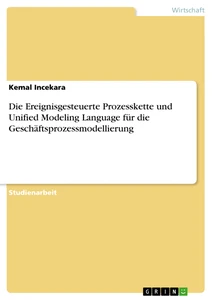


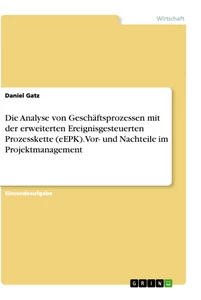
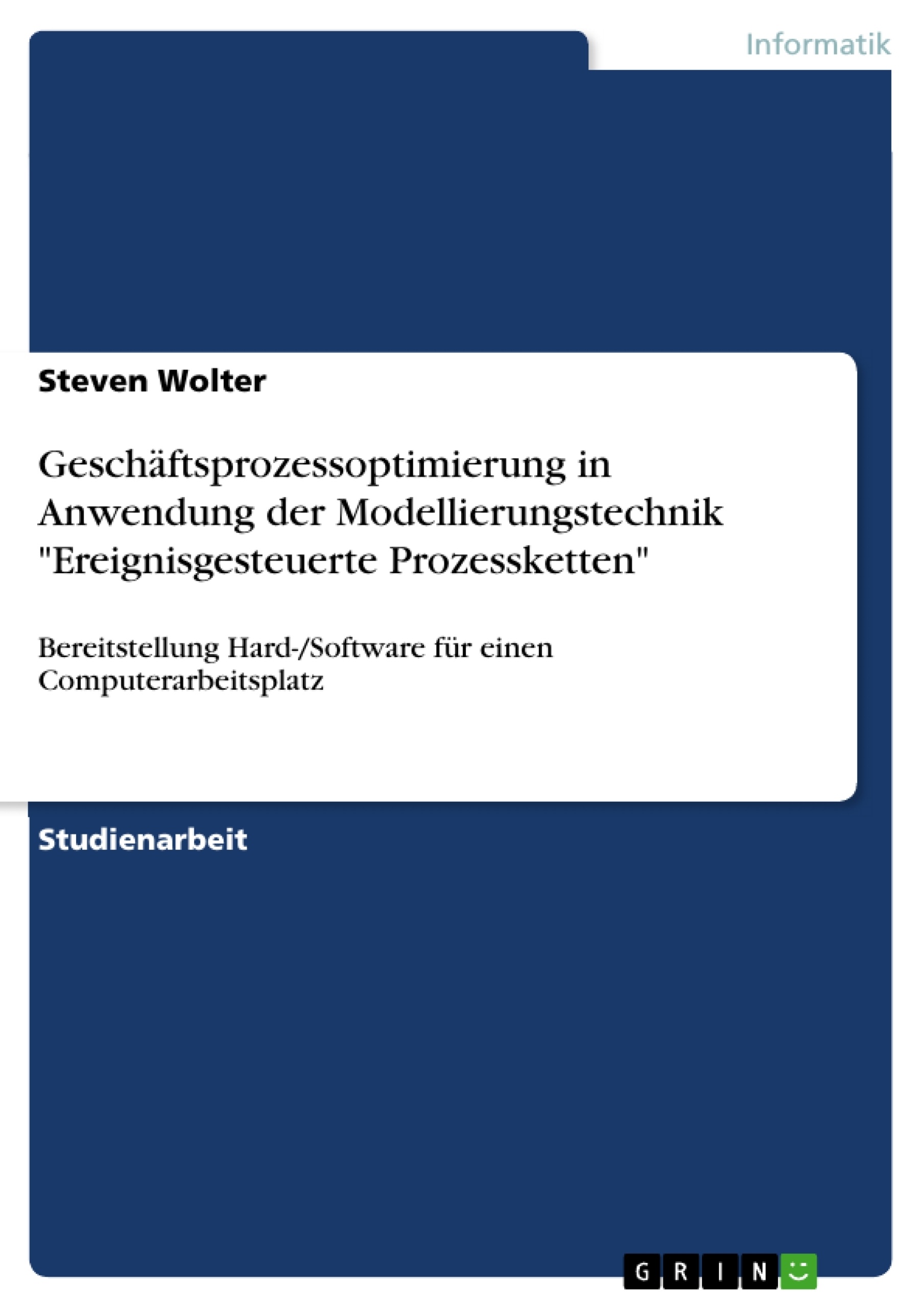

Comments