Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Informationen über das Schloss
2.1 Die ersten Eindrücke über das Schloss
2.2 Der Bau und die Räumlichkeiten
3. Die bürokratischen Strukturen
3.1 Die Arbeit des Beamtenapparats
3.2 Gewährleistung des amtlichen Apparats
4. Die Bewohner des Schlosses
4.1 Die Lichtgestalt Klamm
4.2 Kindlichkeit, Wolllust und Müdigkeit
4.3 Ehemalige Schlossbewohner
5. Der Kontakt zwischen Schloss und Dorf
5.1 Telefonate und Briefe
5.2 Protokolle
5.3 Verhöre im Herrenhof
6. Die Dorfbewohner und das Schloss
6.1 Die Grenze zwischen Dorf und Schloss
6.2 Der besondere Einfluss der Frauen
6.3 Der Bote Barnabas
7. K. und das Schloss
7.1 Der fremde Unruhestifter
7.2 K.s Streben zum Schloss
7.3 Die Macht des Schlosses
7.4 Die Unmöglichkeit ins Schloss zu gelangen
7.5 K.s Ende und sein Aufgenommenwerden
8. Die fremde Welt des Schlosses
8.1 Die Existenz des Schlosses
8.2 Nichteinmischung
8.3 Die Unerreichbarkeit des Schlosses
10. Schluss
11. Literatur
1. Einleitung
Franz Kafkas Romanfragment „Das Schloß“, entstanden im Jahre 1922, liefert eine seltsame Darstellung einer Dorfgemeinschaft, die in einer ungewöhnlichen Abhängigkeit zu einem Schloss steht, welches gleichzeitig für das Dorf unerreichbar scheint. Protagonist des Romans ist K., der als Fremder in diese seltsame Gemeinde eintrifft, und versucht sich in die geschlossene Dorfgemeinschaft zu integrieren. Diese Integration scheitert, denn das Dorf lebt in einer bizarren Abhängigkeit von den im Schloss residierenden Beamten, die K. nie zu verstehen und zu akzeptieren lernt. Das Schloss und die Behörden genießen einen sehr merkwürdigen Status im Dorf, welcher in einer Verstrickung von bürokratischer bis hin zu despotischer Herrschaft besteht. Das Schloss prägt nicht nur seine Bewohner, sondern auch die des Dorfes und vor allem auch K., dessen gesamte Zeit im Dorf im Zeichen des Schlosses steht. Nicht nur die Schlossbewohner stehen im Dienste des Schlosses, sondern auch die Dorfbewohner. Ihr Status im Dorf ist durch das Schloss geprägt, und das Erreichen eben des gleichen wird für K zum Lebensziel. Das Schloss selber bleibt mysteriös. Die Arbeit soll sich auf eben diese Rolle des Schlosses beziehen. Der Behördenapparat, das bürokratische Schaffen und seine Einflüsse zum Dorf und seinen Bewohner, und K.s Streben ins Schloss zu gelangen sollen beleuchtet werden.
2. Informationen über das Schloss
Die Informationen über das Schloss sind sehr vielseitig. Es wird nicht nur deskriptiv von Kafka über das Schloss berichtet, sondern die meisten Informationen stammen von den Dorfbewohnern und den Sekretären. Auch K.s Wahrnehmung ist relevant. Darüber hinaus scheinen die Klänge der Schlossglocke oder sogar „das Riechen und das Schmecken eine wichtige Rolle, z.B. als K. Klamms Kognak zu sich nimmt“[1], zu spielen. K. versucht dementsprechend über alle möglichen Wege Erkenntnisse über das Schloss zu gewinnen, und mit ihm hofft der Leser ein paar weitere Informationen über den mysteriösen Beamtenapparat zu erfahren.
2.1 Die ersten Eindrücke über das Schloss
Der Leser weiß von Anfang an um die Existenz des Schlosses. Bereits bei K.s Ankunft wird vom Schloss gesprochen, und durch den Titel ist von Beginn an klar, dass es ein Schloss gibt, auch wenn K. dies nicht zu wissen vorgibt. Diese Ahnungslosigkeit K.s dürfte jedoch nur gespielt sein, denn bei der angegebenen Größe des Schlosses sollte es unmöglich sein das Dorf zu erreichen ohne das Gebäude in der Ferne erkennen zu können, selbst in der Dunkelheit der Nacht. Demnach ist auch K.s ‚Verirren’ ins Dorf eher unwahrscheinlich, es scheint eher so zu sein, dass das Schloss ihn anlockt.
Bereits die ersten Aussagen vom Sohn des Unterkastellans über das Schloss sind bezeichnend: „Dieses Dorf ist Besitz des Schloßes, wer hier wohnt oder übernachtet, wohnt oder übernachtet gewissermaßen im Schloß. Niemand darf das ohne gräfliche Erlaubnis.“[2] Die Äußerung erinnert an eine Leibeigenschaft. K. bekundet nichts von einem Schloss zu wissen und fragt: „Ist denn hier ein Schloß?“[3] Und die Antwort: „Allerdings“[4], „bedeutet mehr aus als ein bloßes ‚ja’ und heißt so viel wie ‚gewiss’ und ‚vor allen Dingen’.“[5] Die Rolle des Schlosses und seiner Bewohner wird also schnell klar gestellt, und an der höheren Positionierung der Dominierenden gegenüber dem Dorf wird kein Zweifel gelassen. „Das Schloß ist eine jenseits und über dem Dorf thronende Instanz, die sich den Bewohnern in Form einer übermächtigen Behörde präsentiert.“[6] Der Eindruck der Abhängigkeit des Dorfes vom Schloss wird sofort bei K.s Ankunft schon geschürt, auch wenn der Lehrer klar stellt, dass „zwischen den Bauern und dem Schloß“[7] keine Differenz besteht.
2.2 Der Bau und die Räumlichkeiten
Nach den Schilderungen des Sohnes des Unterkastellans und des Wirten hinterlässt das Schloss einen starken, dominierenden, ja schon überirdischen Eindruck. Bei K.s Besichtigung entspricht es aus der Ferne genau seinen Erwartungen. „Es war weder eine alte Ritterburg, noch ein neuer Prunkbau, sondern eine ausgedehnte Anlage, die aus wenigen zweistöckigen, aber aus vielen eng aneinanderstehenden niedrigeren Bauten bestand; hätte man nicht gewußt, dass es ein Schloß ist, hätte man es für ein Städtchen halten können.“[8] Die Beschreibung des Schlosses ist merkwürdig. Es entspricht K.s Erwartungen, aber sicherlich nicht denen des Lesers, der sich unter einem Schloss sicherlich eher den „Prunkbau“ oder die alte „Ritterburg“ vorstellt, als eine Anlage, die einem kleinen Städtchen ähnlich sieht. Diese Darstellung steht im Kontrast zu dem was man sich als Schloss vorstellt.
K. scheint hier zum ersten und vielleicht zum letzten Mal kurze Erkenntnis zu gewinnen. „Nun sah er das Schloß deutlich umrissen in der klaren Luft.“[9] So deutlich wird er das Schloss im Laufe des Romans nie wieder erkennen.
Aber auch K.s anfängliche Erwartungsdeckung verfliegt dann schließlich doch. „Aber im Näherkommen enttäuschte ihn das Schloß, es war doch nur ein recht elendes Städtchen (...)“[10] Aus der Ferne erfüllt das Schloss noch seine Erwartungen, doch je näher er ihm kommt, umso stärker enttäuscht es ihn. Zunächst sieht er „das Schloß deutlich umrissen“, dann wirkt es bloß noch wie ein „Städtchen“, dann sogar als „recht elendes Städtchen“. Am Ende ist es nur ein irdisches Gebäude, das seine Erwartung an das als mächtig beschriebene Schloss enttäuscht. Für K. steht selbst sein Heimatdorf dem Schloss in nichts nach.
Die Frage bleibt jedoch offen, inwiefern K.s Wahrnehmung des Schlosses eine objektive ist. Nach dem Gespräch mit dem Lehrer will K. auch weiter näher an das Schloss heran, muss aber feststellen, dass das nicht so leicht ist, wie es vorher scheint. „Die Straße nämlich, diese Hauptstraße des Dorfes führte nicht zum Schlossberg, sie führte nur nahe heran, dann aber wie absichtlich bog sie ab und wenn sie sich auch vom Schloß nicht entfernte, so kam sie ihm doch auch nicht näher. Immer erwartete K., dass nun endlich die Straße zum Schloß einlenken müsse (...)“.[11] Ein normaler Weg zum Schloss scheint nicht zu existieren.
Die Beamten leben abgeschottet vom Dorf, sie sind nicht ohne weiteres auffindbar, der Weg ins Schloss ist nicht definierbar. „Es gibt mehrere Zufahrten zum Schloß. Einmal ist die eine in Mode, dann fahren sie meistens dort, einmal eine andere, dann drängt sich alles hin. Nach welchen Regeln dieser Wechsel stattfindet, ist noch nicht herausgefunden worden.“[12]
Die Räumlichkeiten des Schlosses werden immer nur aus Erzählungen anderer geschildert. K. wird diese nie besichtigen können. Die geschilderte Darstellung ist überzogen und unrealistisch. Kafka beschreibt die Räume der Behörde nicht wie man sich das Büro von Beamten vorstellt, die Schilderungen erinnern vielmehr an eine Kirche oder eine Klosterschule. Die Kanzleien sollen nicht unterteilt sein, und selbst Olga, die die Räume der Beamten beschreibt, sie selber aber auch nur vom Erzählen kennt, findet die Räume und das Benehmen der Beamten merkwürdig und unverständlich. „Der Länge nach ist dieses Zimmer durch ein einziges, von Seitenwand zu Seitenwand reichendes Stehpult in zwei Teile geteilt, einen schmalen, wo einander zwei Personen nur knapp ausweichen können, das ist der Raum der Beamten, und einen breiten, das ist der Raum der Parteien, der Zuschauer, der Diener, der Boten. Auf dem Pult liegen aufgeschlagene große Bücher, eines neben dem andern und bei den meisten stehen Beamte und lesen darin.“[13] Um ein normales Gebäude, wie man es sich vorstellt, scheint es sich demnach nicht zu handeln.
3. Die bürokratischen Strukturen
3.1 Die Arbeit des Beamtenapparats
Das Schloss ist strikt abgegrenzt vom Dorf, es scheint unerreichbar, und nur die Schlossbeamten haben Zutritt zu ihm. Die Verbindung zwischen den Dorfbewohnern und den Schlossbeamten erfolgt über deren Abgesandte und Sekretäre. Beim Schloss handelt es sich demnach nicht um ein Gebäude, das einem König, Prinzen oder Adligen gehört, sondern um einen Beamtenapparat. Zwar gehört es, wie auch das Dorf dem Grafen Westwest, aber in ihm wohnen nicht dessen Familie, sondern Beamte, die dort arbeiten und auch leben.
„Oberste Spitze der Beamtenhierarchie des Schloßes ist der Graf. Von ihm als Dienstherrn her ist letztlich jedes einzelne Dienstverhältnis begründet. Die niedrigere Stufe der Hierarchie leitet sich jeweils von einer höheren her. Scheinbar ist diese Delegation der Macht von oben über feste Abstufungen nach unten hier festgehalten.“[14] Wie viele Beamte es gibt, ist völlig unklar, und wie viele Kanzleien ebenfalls. Sicher ist nur, dass es mindestens zehn Kanzleien sein müssen, da Klamm Vorstand der zehnten Kanzlei ist.
Noch seltsamer als die Räumlichkeiten es sind, ist das Schaffen der Behörden. Es wirkt eher wie eine Form des Betens oder Meditierens, mit gewöhnlichem Bürobetrieb hat es jedenfalls wenig gemein.
„Vorn eng am Stehpult sind niedrige Tischchen, an denen Schreiber sitzen, welche, wenn die Beamten es wünschen, nach ihrem Diktat schreiben. (...) Es erfolgt kein ausdrücklicher Befehl des Beamten, auch wird nicht laut diktiert, man merkt kaum, daß diktiert wird, vielmehr scheint der Beamte zu lesen wie früher, nur dass er dabei auch noch flüstert und der Schreiber hörts. Oft diktiert der Beamte so leise, daß der Schreiber es sitzend gar nicht hören kann, dann muss er immer aufspringen, das Diktierte auffangen, schnell sich setzen und es aufschreiben (...)“.[15]
Die Beamten arbeiten in verschiedenen Zuständigkeitsbereichen, wobei es vorkommt, dass einer den anderen vertritt. Kafka überzeichnet seine Darstellung dieses Verwaltungsorgans zur Satire. Jede Kontrollbehörde hat wieder eine Kontrollbehörde, die wieder eine übergeordnete Behörde hat. „Es gibt nur Kontrollbehörden“[16] bekundet der Vorsteher.
Bürgel beispielsweise „ist ‚Verbindungssekretär’ zwischen einem vorgesetzten Beamten ‚und dem Dorf’, doch im Grunde nur eine Verbindung zwischen Instanzen, die selbst Verbindungen sind, ‚zwischen Schloß- und Dorfsekretären’“[17]. Dies zeigt wie gewaltig dieser Beamtenapparat ist, wie viele Beamte, Sekretäre, Kontrolleure und Verbindungsleute für ihn arbeiten. Die Strukturen sind völlig unübersichtlich.
Fehler machen die Beamten nicht. Sie sind unfehlbar. „Sie sind nicht dazu bestimmt, Fehler im groben Wortsinn herauszufinden, denn Fehler kommen ja nicht vor und selbst wenn einmal ein Fehler vorkommt, (...) wer darf denn endgiltig sagen, daß es ein Fehler ist.“[18] Die Behörden arbeiten also fehlerfrei, und selbst wenn ein Fehler vorkommen würde, wäre es keiner, da nur sie bestimmen können, was ein Fehler überhaupt wäre.
Die Arbeit der Beamten wird geradezu fragwürdig in den Schilderungen des Vorstehers. „Die Menge der Akten ist so groß, daß sie gar nicht gleichzeitig bearbeitet werden kann. Wenn die Aktenberge ‚immerfort’ einstürzen, so kann man keinen einzelnen Akt mehr anders als durch Zufall finden und bearbeiten.“[19]
Der Gegenstand der bürokratischen Tätigkeiten bleibt größtenteils im Dunkeln. Es scheint auch völlig irrelevant zu sein, denn der Ablauf, das Akten studieren, das Schreiben und die Kontrollbehörden scheinen wichtiger als jegliche Inhalte. Die Bürokratie selber scheint also das wichtige zu sein, nicht der ursprüngliche Grund für den bürokratischen Aufwand. Der behördliche Apparat wirkt so, als ob das Verwaltungswesen sich selber legitimisiert, jedoch sonst nach außen nichts löst. „Die Schloß-Bürokratie ist derart übersteuert, dass sie selbst Routinefälle zu erledigen nicht mehr in der Lage ist“[20]. Jede Kleinigkeit führt zu einem riesigen bürokratischen Aufwand, der jahrelange Besprechungen und Kontrollen erfordert. Die Inhalte der Akten scheinen nicht zu interessieren, die Tätigkeit der Schlossbeamten beschränkt sich scheinbar nur auf die Form.
Kafka überzeichnet einige Vorgänge in seinem Roman, besonders die Darstellung oder besser die Schilderung der bürokratischen Vorgänge scheint völlig überspitzt. Die Tatsache, dass man nicht einmal bemerkt ob eine Angelegenheit noch behandelt wird oder nicht liegt daran, dass alles so langsam voranschreitet, dass es für außenstehende des Schlosses völlig undurchsichtig ist. Wenn nichts passiert kann das bedeuten, „daß die Sache im Amtsgang ist, sie kann aber auch bedeuten, dass der Amtsgang noch gar nicht begonnen hat“[21].
Ein Beispiel für die satirische und überzogene Darstellung des behördlichen Schaffens ist die Szene, in der K. früh morgens im Herrenhof die Verteilung der Akten an die Sekretäre beobachtet und stört. Geradezu ironisch wirkt K.s Wahrnehmung des Verwaltungswesens. Die Arbeit der Beamten wirkt sinnlos und unnötig. Sie erledigen ja nichts, außer die amtliche Tätigkeit selber.
3.2 Gewährleistung des amtlichen Apparats
Der ganze Lebensinhalt der Schlossbewohner scheint die Aufrechterhaltung der Bürokratie zu sein. Und auch bei den Dorfbewohnern scheint dies der Fall zu sein, denn persönliche Anliegen sind nicht wichtig. Individualität wird nicht geschätzt, sondern strikte Unterwürfigkeit dem Schloss gegenüber. Beide Bereiche, sowohl Schloss wie auch Dorf scheinen strikt darauf bedacht zu sein, die bürokratischen Strukturen aufrecht zu erhalten. Ein freies Leben ist weder im Dorf, noch im Schloss möglich. Das ganze Leben ist behördlich geregelt und bestimmt.
Die Schlosswelt ist demnach nur mit sich beschäftigt, wahres Interesse am Dorf findet sich nicht. „Die innere Gliederung des Amtes kehrt sich um und die Mittel, das Amt auszuüben, werden zum Inhalt.“[22]
Das Dorf und seine Bewohner stehen unter der Einflussnahme, beziehungsweise der Bevormundung, der mächtigen Bürokratie des Schlosses. Das Schloss an sich ist für sie ebenso unerreichbar wie für K.. Das Rangverhältnis zwischen dem Dorf und dem Schloss ist demnach ungleichmäßig und heterogen. Die Dorfbewohner können die Beamten und das Schloss in der Regel nicht erreichen, ihr einziger Kontakt zum Schloss besteht im Normalfall durch Protokolle und Verhöre durch die Sekretäre. Und dennoch tut auch die Dorfgemeinschaft alles um die Bürokratie nicht zu stören. Sie erwarten offensichtlich keine Bestrafungen vom Schloss für Amalia, sie erwarten schon gar nicht ins Schloss zu dürfen oder mit einem Beamten kommunizieren zu dürfen. Es wird alles hingenommen, und alles unternommen, damit die Behörden nicht gestört werden, und ihre amtlichen Tätigkeiten ungestört ausüben können.
[...]
[1] Greß, Felix: Die gefährdete Freiheit. Franz Kafkas späte Texte. Königshausen & Neumann. Würzburg 1994. S.169.
[2] Kafka, Franz: Das Schloß. 10. Auflage. Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main 2005. S.9.
[3] ebd. S.10.
[4] ebd. S.10.
[5] Greß, Felix: Die gefährdete Freiheit. Franz Kafkas späte Texte. Königshausen & Neumann. Würzburg 1994. S.170.
[6] ebd. S.170.
[7] Kafka, Franz: Das Schloß. 10. Auflage. Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main 2005. S.19.
[8] ebd. S.16.
[9] Kafka, Franz: Das Schloß. 10. Auflage. Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main 2005. S16.
[10] ebd. S.17.
[11] ebd. S.19.
[12] ebd. S.264.
[13] Kafka, Franz: Das Schloß. 10. Auflage. Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main 2005. S.218.
[14] Philippi, Klaus-Peter: Reflexion und Wirklichkeit. Untersuchungen zu Kafkas Roman Das Schloß. Tübingen 1966. S.180.
[15] Kafka, Franz: Das Schloß. 10. Auflage. Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main 2005. S.218.
[16] ebd. S 82.
[17] Philippi, Klaus-Peter: Reflexion und Wirklichkeit. Untersuchungen zu Kafkas Roman Das Schloß. Tübingen 1966. S.195.
[18] Kafka, Franz: Das Schloß. 10. Auflage. Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main 2005. S.82.
[19] Philippi, Klaus-Peter: Reflexion und Wirklichkeit. Untersuchungen zu Kafkas Roman Das Schloß. Tübingen 1966. S.183.
[20] Dornemann, Axel: Im Labyrinth der Bürokratie. Tolstojs „Auferstehung“ und Kafkas „Schloß“. Carl Winter Universitätsverlag. Heidelberg 1984. S 108.
[21] Kafka, Franz: Das Schloß. 10. Auflage. Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main 2005. S212.
[22] Philippi, Klaus-Peter: Reflexion und Wirklichkeit. Untersuchungen zu Kafkas Roman Das Schloß. Tübingen 1966. S.187.
- Arbeit zitieren
- Luc Wildanger (Autor:in), 2006, Franz Kafkas Schloss: Die Welt des Schlosses, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126971
Kostenlos Autor werden
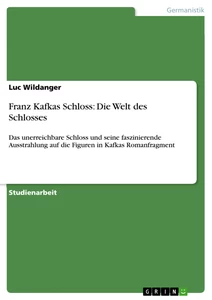
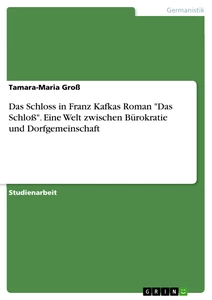





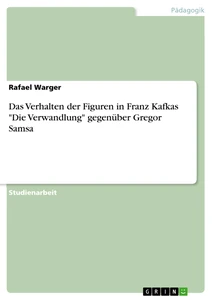
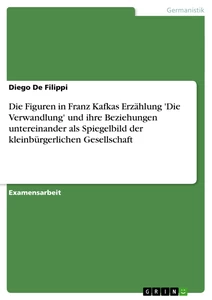






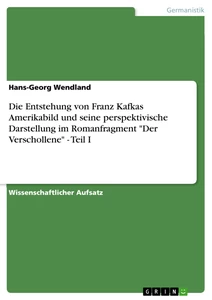
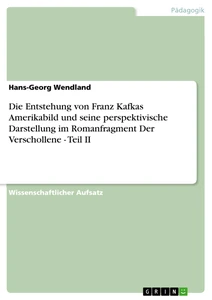



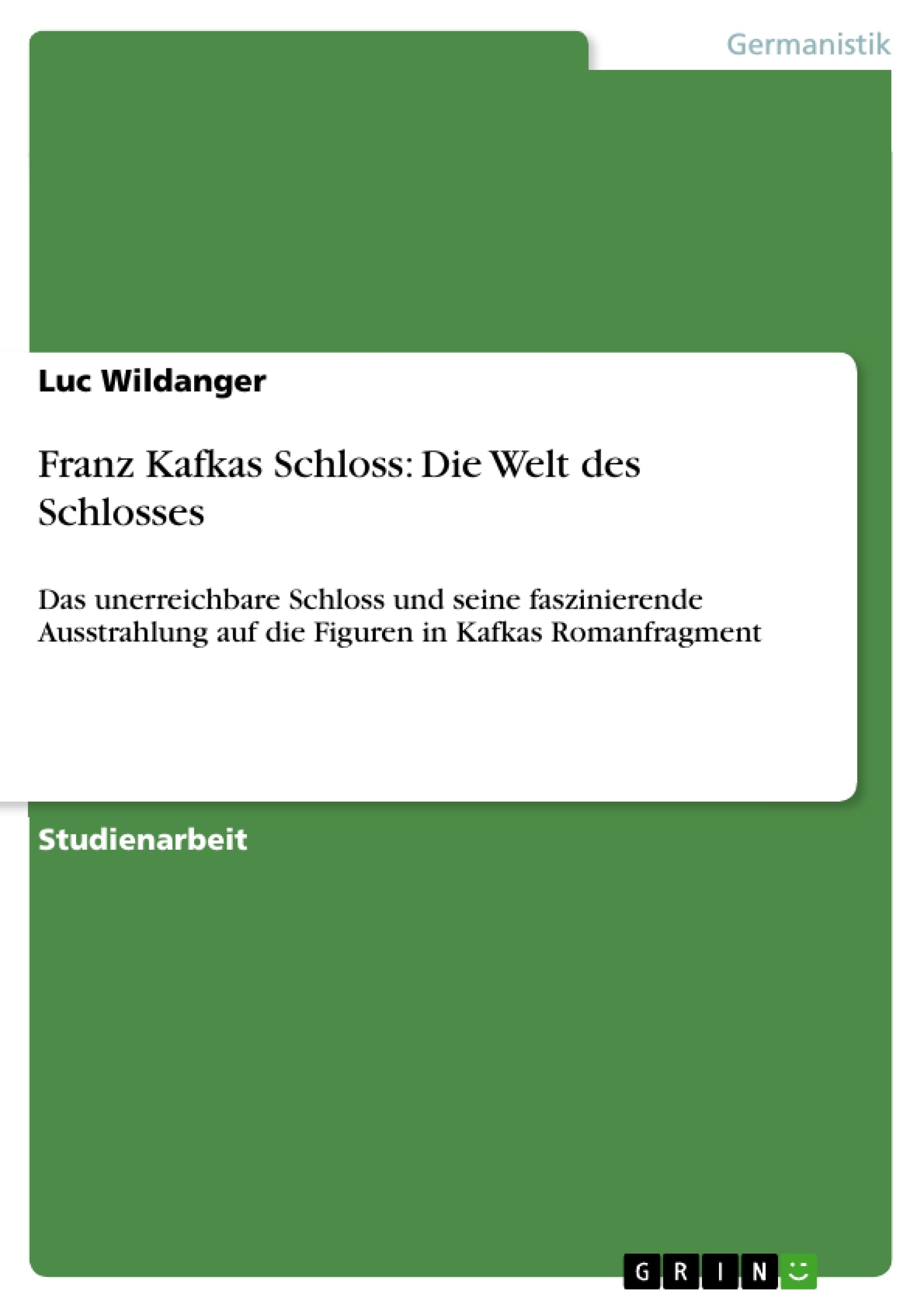

Kommentare