Leseprobe
Inhalt
I. Einleitung
II. Chronologie und Analyse
1. Kohl und die Frage der polnischen Westgrenze
2. Lafontaines Kanzlerkandidatur und die Deutschlandpolitik I
3. Kohl, Gorbatschow und die deutsche Einigung I
4. Lafontaines Kanzlerkandidatur und die Deutschlandpolitik II
5. Volkskammerwahl in der DDR
6. Medienurteile und Demoskopie im Einheitswahlkampf I
7. Kohl, Lafontaine und die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion
8. Lafontaines Kanzlerkandidatur und die Deutschlandpolitik III
9. Medienurteile und Demoskopie im Einheitswahlkampf II
10. Kohl, Gorbatschow und die deutsche Einigung II
11. Beitritt der DDR
12. Der 2+4-Vertrag
13. Lafontaine und der Vereinigungsparteitag der Sozialdemokratie
14. Medienurteile und Demoskopie im Einheitswahlkampf III
15. Wiedervereinigung Deutschlands
16. Landtagswahlen in den fünf neuen Bundesländern
17. Einheitskanzler Kohl im Wahlkampf
18. Einheitsskeptiker Lafontaine im Wahlkampf
19. Medienurteile und Demoskopie im Einheitswahlkampf IV
20. Bundestagswahlen im wiedervereinigten Deutschland
III. Schlußbetrachtung
IV. Literatur & Quellen (-sammlungen)
I. Einleitung
Helmut Kohl und Oskar Lafontaine gehören zu den Politikern, die die Bonner Republik im letzten Drittel ihrer fünfzigjährigen Geschichte geprägt haben: der Christdemokrat Kohl zwischen 1982 und 1998 als Bundeskanzler, Lafontaine als eine der wichtigsten Figuren der sozialdemokratischen Opposition. Im Bundestagswahlkampf 1990 standen die Kontrahenten sich als Kandidaten für das Kanzleramt im wiedervereinigten Deutschland gegenüber.[1]
Ein Wahlkampf, der im Zeichen der politischen Wende in Mittel- und Osteuropa und des daraus resultierenden deutsch-deutschen Vereinigungsprozesses stand. Deutschlandpolitik rangierte spätestens mit dem Mauerfall am 9. November 1989 ganz oben auf der politischen Agenda der Bundesrepublik. Die Kanzlerkandidaten im Bundestagswahlkampf 1990 hatten sich angesichts dessen mit Fragestellungen auseinanderzusetzen, für deren Beantwortung keine vorgefertigten Strategien existierten. Die Themen waren nun gesamtdeutscher Natur: die Bewältigung des Übersiedlerstroms aus der DDR, das Verhältnis zu den politischen Gruppierungen in Ostdeutschland, die Einführung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, die staatsrechtliche Gestaltung der Einheit (Artikel 23 oder 146?), die Bündniszugehörigkeit eines wiedervereinigten Deutschlands, und auch die Frage nach der endgültigen Anerkennung der polnischen Westgrenze wurde wieder diskutiert – dabei immer auch begleitet von taktischen Überlegungen hinsichtlich des für die Kontrahenten jeweils günstigeren Termins für die – bereits gesamtdeutschen – Bundestagswahlen. Ganz eindeutig wurde die politische Debatte in Politik, Publizistik und innerhalb der Bevölkerung im Jahr 1990 dominiert von Vorschlägen und Planungen im Kontext der Vereinigung beider deutscher Staaten.[2]
In der vorliegenden Magisterarbeit wird nicht versucht, eine Geschichte der deutschen Einheit zu erzählen. Vielmehr soll aufgezeigt werden, daß die deutschlandpolitischen Positionen von Bundeskanzler Helmut Kohl und Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine für den Ausgang der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 von letztlich entscheidender Relevanz gewesen sind. In weitgehend chronologischer Form werden analog zu den maßgeblichen Ereignissen im Einheitswahlkampf 1990 die deutschlandpolitischen Positionen der Kandidaten herausgestellt. Um im Sinne der Ausgangsthese deutlich zu machen, daß es das Thema Deutschlandpolitik gewesen ist, durch das die Bundestagswahl entschieden wurde, werden folgende Fragestellungen besonders berücksichtigt: Waren die deutschlandpolitischen Positionen der Kanzlerkandidaten in der jeweils eigenen Partei konsensfähig oder Auslöser für interne Kontroversen? Hatten die Volkskammerwahl in der DDR sowie die diversen Landtagswahlen in alten und neuen Bundesländern bereits den Charakter von Abstimmungen über den deutschlandpolitischen Kurs der Kandidaten auf Bundesebene? Wie wurden die deutschlandpolitischen Vorschläge sowie die damit verbundenen Wahlkampfstrategien der Kandidaten in den publizistischen Leitmedien beurteilt? Und schließlich: Wie haben sich die Zustimmungswerte zu den Kandidaten und ihren Positionen in den Umfragen maßgeblicher Meinungsforschungsinstitute entwickelt?
Die Arbeit basiert auf der zeithistorischen Fachliteratur zum Einigungsprozeß: Die vierteilige Edition „Geschichte der deutschen Einheit“ – mit historischen bzw. politikwissenschaftlichen Analysen von Karl-Rudolf Korte („Deutschlandpolitik in Helmut Kohls Kanzlerschaft“), Dieter Grosser („Das Wagnis der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion“), Wolfgang Jäger („Die Überwindung der Teilung“) und Werner Weidenfeld („Außenpolitik für die deutsche Einheit“) – ist hervorzuheben. Zudem wird auf Erinnerungsberichte der im Einheitswahlkampf handelnden politischen Akteure zurückgegriffen: Neben den Bewertungen von Helmut Kohl und Oskar Lafontaine waren für den Autor die Einschätzungen von Wolfgang Schäuble, Hans-Dietrich Genscher sowie von Hans-Jochen Vogel und Willy Brandt von besonderem Interesse. Darüber hinaus wurde die journalistische und zeithistorische Berichterstattung in renommierten Wochenzeitungen herangezogen, wobei die Urteile des Nachrichtenmagazins Der Spiegel sowie dessen Herausgebers Rudolf Augstein besonders umfangreich berücksichtigt wurden. Hinsichtlich der Analyse der Berichterstattung über die Kandidaten in den publizistischen Leitmedien sowie der Entwicklung der Umfrageergebnisse im Wahlkampf hat sich Klaus Kindelmanns Studie „Kanzlerkandidaten in den Medien“ als hilfreich erwiesen.[3]
II. Chronologie und Analyse
1. Kohl und die Frage der polnischen Westgrenze
Das Wahljahr 1990 begann für den CDU-Chef mit einem Dilemma. Mit der Wende in der DDR waren neben der deutschen Frage auch die Interessen der Vertriebenenverbände wieder auf der politischen Agenda aufgetaucht. Deren Gebiets- und Eigentumsansprüche, formuliert von ihrem Präsidenten (und Unionsabgeordneten im Bundestag) Herbert Czaja, mußten von der CDU ernst genommen werden, wenn das nationalkonservative Wählerpotential nicht in die Arme der nationalistischen „Republikaner“ getrieben werden sollte.[4]
Immerhin konnten sich die Vertriebenenverbände auf ein Zitat des ersten CDU-Kanzlers Konrad Adenauer berufen: „Keine deutsche Regierung wird je in der Lage, die Oder-Neiße-Linie anzuerkennen“, lautete der Ausspruch Adenauers aus dem Jahr 1953. Darüber hinaus argumentierten die Anhänger eines „Großdeutschen Reiches“ vor allem auf der Grundlage des Umstandes, daß das Verfassungsgericht in Karlsruhe bis dato nicht von der juristischen Formel abgewichen war, das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 sei nie untergegangen. Selbst auf den vom SPD-Kanzler Willy Brandt abgeschlossenen Warschauer Vertrag konnten sie sich beziehen, denn auch dieser enthielt nach offizieller juristischer Interpretation keinerlei Verzicht auf die im Zweiten Weltkrieg verlorenen deutschen Ostgebiete.[5]
Auch wenn mit Ausnahme der Vertriebenen und deutschnationalen Kreise die Oder-Neiße-Grenze von niemand mehr ernsthaft in Frage gestellt wurde, konnte sich Kohl lange nicht zu einer eindeutigen Position durchringen. Der Kanzler vermied eine klare Aussage zur polnischen Westgrenze, darauf verweisend, daß er sich als Verfassungsorgan Bundeskanzler an die Rechtsprechung des Verfassungsorgans Bundesverfassungsgericht halten müsse. In Zeiten des Kalten Krieges, die deutsche Einheit in weiter Ferne, konnten die Unionsparteien sich den Vertriebenen zumindest in der Rhetorik als Hüter nationaler Interessen anbiedern. Jetzt fürchtete Kohl, obwohl selbst kein Revanchist, die Vertriebenen mit der Realität konfrontieren zu müssen und bei der Bundestagswahl im Dezember ein sicher geglaubtes Wählerreservoir unter Umständen an die rechtsradikalen Republikaner verlieren zu können. „Während Genscher, in seinem außenpolitischen Handeln ganz der Tradition sozialliberalen Ostpolitik folgend, beispielsweise Wählerschichten im konservativen und rechten Lager, die ihm ohnehin nicht zugänglich waren, vernachlässigen konnte, mußte Kohl hier nicht nur auf allgemeine innenpolitische, sondern auch auf wichtige innerparteiliche Gruppen Rücksicht nehmen“, urteilte Werner Weidenfeld.[6]
Ebenso wie Außenminister Genscher hatten andere Repräsentanten der Bonner Republik weniger Probleme, eindeutige Positionen zu formulieren: Bundespräsident Richard von Weizsäcker ebenso wenig wie Parlamentspräsidentin Rita Süssmuth. Selbst Roman Herzog, oberster Verfassungsrichter, bezog deutlicher Stellung als Kohl: Es gebe keine Rechtsprechung, ließ Herzog zu Jahresbeginn 1990 verlauten, die eine Wiedervereinigung in den Grenzen von 1937 fordere. Und eine Vereinigung von Bundesrepublik und DDR ohne die Gebiete von Oder und Neiße verstoße keineswegs gegen den Wiedervereinigungsauftrag des Grundgesetzes. „Denn die tatsächliche politische Entwicklung kann eine Verfassung nicht endgültig steuern“, so Herzog. In der Endphase des Vereinigungsprozesses wird das Bundesverfassungsgericht folgerichtig die Klage Czajas gegen den Einigungsvertrag, der die Anerkennung der bestehenden Grenzen durch die Streichung des Artikels 23 faktisch beinhaltete, abweisen.[7]
Ungeachtet des negativen Echos, das im Januar 1990 im In- und Ausland auf den Bundeskanzler niederprasselte, nahm Helmut Kohl in der Frage der polnischen Westgrenze bis zu den Volkskammerwahlen im März nicht eindeutig öffentlich Stellung. Noch Ende Februar, Kohl war in Camp David Gast des amerikanischen Präsidenten George Bush, blieb der Bundeskanzler bei der juristischen Interpretation, die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie müsse einem gesamtdeutschen Souverän überlassen werden. Daß Kohl auch bei dieser Gelegenheit dargelegt hatte, daß „niemand die Frage der Einheit der Nation mit der Verschiebung bestehender Grenzen“ verbinden wolle, nahm die beunruhigte Weltöffentlichkeit weit weniger zur Kenntnis.[8]
Die Verunsicherung war bei den polnischen Nachbarn natürlich besonders ausgeprägt: Die Zeitung Gazeta Wyborcza nannte Kohls Politik – exemplarisch für das Unverständnis in den polnischen Medien – „ein unehrliches, zweideutiges Spiel“. Marian Podkowinski, Publizist und einer der renommiertesten Deutschlandexperten, diagnostizierte beim deutschen Kanzler „einen Mangel an Vorstellungskraft“. Dieser vergesse, daß für die meisten Polen auch 45 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein großes Deutschland „immer noch ein Schreckensbild ist, das sie mit Bismarck und Hitler verbinden“.[9]
Die politischen Repräsentanten des Nachbarlandes waren ebenso ungehalten: Ministerpräsident Mazowiecki erklärte die Garantie der Staatsgrenzen zu einer „Frage von Leben und Tod“, und Präsident Jaruzelski verwies auf das internationale Unverständnis über Kohls unklare Äußerungen: „Noch nie haben wir von Washington über London und von Paris bis Moskau eine so einhellige und intensive Unterstützung unserer Wünsche erfahren wie in der Sache der Westgrenze.“ Anders herum gesagt: Selten hat sich Helmut Kohl in der Außenpolitik stärker in die Isolation manövriert als durch die zögerliche Haltung in der Frage der Oder-Neiße-Grenze.[10]
Dabei war Kohls Lamento um die Anerkennung der polnischen Westgrenze nicht das erste diplomatische Mißverständnis in der Kanzlerschaft des Pfälzers: Bei einem Israel-Besuch 1984 hatte der Historiker Kohl die Gastgeber mit seinem Ausspruch von der „Gnade der späten Geburt“ irritiert, 1986 sorgte er für Unverständnis, als er den sowjetischen Generalsekretär Michail Gorbatschow in einem autorisierten Newsweek -Interview mit NS-Propagandaminister Joseph Goebbels verglich, und auch die Tatsache, daß er 1985 den US-Präsidenten Ronald Reagan bei dessen Deutschland-Besuch auf den Soldatenfriedhof von Bitburg, auf dem auch frühere SS-Mitglieder begraben liegen, geführt hatte, wurde als mißlungener Akt politischer Aussöhnungssymbolik gedeutet. Peinlichkeiten wie diese schienen ein Urteil des langjährigen Rivalen Franz Josef Strauß zu bestätigen, der Helmut Kohl nach dessen knapper Niederlage gegen Helmut Schmidt bei den Bundestagswahlen 1976 attestiert hatte, er werde angesichts seiner Unzulänglichkeiten nie Kanzler werden: „Er ist total unfähig, ihm fehlen die charakterlichen Voraussetzungen. Ihm fehlt alles dafür.“[11]
Strauß, der vier Jahre später als Kanzlerkandidat vier Prozent unter Kohls Ergebnis von 1976 blieb, sollte sich geirrt haben: Der provinziell wirkende Pfälzer zog im Oktober 1982 durch den Seitenwechsel der FDP und ein konstruktives Mißtrauensvotum gegen Helmut Schmidt ins Kanzleramt ein. Dies war der vorläufige Höhepunkt einer bis dato schon langen politischen Karriere, die Kohl 1947 als Mitbegründer der Jungen Union in Ludwigshafen begonnen hatte. Ein Jahr später trat er in die CDU ein, wurde 1953 Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes der CDU Pfalz, 1955 Mitglied des Landesvorstandes Rheinland-Pfalz, 1959 Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der CDU Ludwigshafen, 1966 Landesvorsitzender der rheinland-pfälzischen Union und im selben Jahr Mitglied des Bundesvorstandes. Von 1969 bis zu seiner Kanzlerkandidatur 1976 amtiert Kohl als Ministerpräsident seines Bundeslandes, um anschließend für sechs Jahre den Fraktionsvorsitz der CDU/CSU im Bundestag zu übernehmen. Bereits 1973 hatte er Rainer Barzel als Vorsitzenden der Bundes-CDU abgelöst.[12]
„Kein Parteimann hat so geduldig und so zielstrebig auf das politische Spitzenamt Deutschlands hingearbeitet. Keiner hat dafür so viele Enttäuschungen hingenommen wie er“, urteilte Rudolf Augstein in der Endphase der Kanzlerschaft Kohl rückblickend über den „Passionsweg“ eines Politikers. Andererseits hat Helmut Kohl in den vielen Parteiämtern seiner langen Politikerkarriere viel Zeit gehabt, seine Partei gründlich zu studieren, Abhängigkeiten entstehen zu lassen und ein gefestigtes Machtsystem aufzubauen.[13]
Im Spätsommer 1989 geriet Kohls Machtbasis zwischenzeitlich ins Bröckeln: Verluste bei Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen sowie verheerende Umfragewerte ließen in Teilen der Union Zweifel aufkommen, ob die nächsten Bundestagswahlen mit dem Pfälzer zu gewinnen seien. Die Gruppe seiner Kritiker – angeführt von Heiner Geißler, Kurt Biedenkopf, Rita Süssmuth und Lothar Späth, der als Alternative gehandelt wurde – hätte den Bundeskanzler auf dem Bremer Parteitag Anfang September 1989 wahrscheinlich in erhebliche Schwierigkeiten gebracht, wenn Helmut Kohl nicht die Weltgeschichte zur Hilfe gekommen wäre: Immer mehr DDR-Bürger suchten über Ungarn und andere Länder die Flucht in den Westen, ließen die Agonie des SED-Staates immer deutlicher zu Tage treten und rückten die deutsche Frage unerwartet wieder auf die Tagesordnung. Just für die Nacht vom 10. auf den 11. September hatte die ungarische Regierung die Ausreise der Flüchtlinge aus Ostdeutschland vorgesehen und damit ein Loch in den „eisernen Vorhang“ geschnitten. Am selben Abend fand der traditionelle Presseempfang vor Beginn des CDU-Parteitages statt. Für den angeschlagenen Kanzler bot sich die Gelegenheit, den überraschten Journalisten die historische Nachricht bekannt zu geben und die Aufmerksamkeit von der innerparteilichen Kontroverse auf seine Rolle als westdeutscher Regierungschef inmitten einer sich abzeichnenden welt- und deutschlandpolitischen Umbruchphase zu lenken. „Wer wollte da noch von Putsch reden, als über die Monitore Bilder von glücklichen Menschen flimmerten, die gerade in den Genuß der sehnlichst erwarteten Freiheit gekommen waren? Kohl schien in dieser weltpolitischen Situation unentbehrlich zu sein, und dieser Eindruck war beabsichtigt. So verdankte der Kanzler auch den ersten Keimen der Vereinigung das Comeback von Bremen“, urteilt Guido Knopp.[14]
Aus den „ersten Keimen der Vereinigung“ wurde in wenigen Wochen eine reale politische Option: Der Flüchtlingsstrom aus der DDR entwickelte sich zum Massenexodus, die friedlichen Demonstrationen zum Massenprotest gegen das System und seine Führung. Die nervös gewordenen Hardliner um Erich Honecker im Politbüro, vom reformorientierten sowjetischen Staatschef Gorbatschow längst nicht mehr gestützt, gaben dem Einigungsprozeß ungewollt eine zusätzliche Dynamik: Der Entwurf einer neuen Reiseverordnung wurde am 9. November von ZK-Mitglied Günther Schabowski mißverständlich vorgetragen und von vielen DDR-Bürgern als sofortige Reiseerlaubnis interpretiert. Zehntausende DDR-Bürger machten die Probe aufs Exempel, der Druck an den Ost-Berliner Grenzübergängen nahm zu, und die schlecht informierten und überraschten Beamten öffneten in ihrer Verunsicherung die Grenzen. Die Berliner Mauer, seit 1961 Symbol der deutschen Teilung, war gefallen.[15]
Helmut Kohl befand sich zu diesem Zeitpunkt auf Polenreise, die im Zeichen der Versöhnung beider Völker stehen sollte. Die Frage nach der definitiven Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze stellte bereits zu diesem Zeitpunkt für Kohl einen heiklen Tagesordnungspunkt dar, zumal es zwischen dem FDP-Außenminister Genscher und der CSU, die die Anliegen der in Süddeutschland stark vertretenen Vertriebenen stets vehement unterstützt hatte, unterschiedliche Auffassungen gab. Vor dem Hintergrund der Ereignisse an der Berliner Mauer, wo sich tags zuvor Hunderttausende Ost- und Westdeutsche in den Armen gelegen hatten, faßte der Bundeskanzler den Entschluß, die Polenreise zu unterbrechen, um direkt nach Berlin zu fliegen, wo am 10. November zwei Kundgebungen – vor der Gedächtniskirche sowie vor dem Schöneberger Rathaus – stattfinden sollten, bei denen Kohl das Feld nicht der Konkurrenz überlassen wollte. „Angesichts der Ereignisse in Ost-Berlin, so sein Eindruck, war er in Warschau am falschen Ort. Daß Konrad Adenauer nach dem Mauerbau am 13. August 1961 nicht sogleich nach Berlin geflogen war, sondern in Augsburg seinen Wahlkampf fortgesetzt hatte, war ihm angesichts der Niederlage bei der darauffolgenden Bundestagswahl immer wieder vorgehalten worden. Einen derartigen Fehler wollte der ebenso geschichts- wie machtbewußte Helmut Kohl keinesfalls wiederholen, zumal er auch aus dem Kreis seiner Mitarbeiter zur Rückkehr nach Bonn aufgefordert wurde“, so Weidenfeld.[16]
Der polnische Ministerpräsident wollte eine Unterbrechung des Staatsbesuchs verhindern. Dementsprechend verärgert war Tadeusz Masowiecki, als der Bundeskanzler sich von seinem Vorhaben nicht abhalten ließ. Der Unmut des polnischen Ministerpräsidenten sollte sich in den nächsten Monaten noch steigern: Kohl würde – wie eingangs ausgeführt – im weiteren Verlauf des deutsch-deutschen Einigungsprozesses die Frage nach der endgültigen völkerrechtlichen Anerkennung der polnischen Westgrenze lange unbeantwortet lassen.[17]
Helmut Kohl hat, ungeachtet des negativen Presseechos im In- und Ausland, eine andere Erinnerung an seine Polenreise: Ihm sei es bei seinem „erfolgreichen“ Besuch gelungen, „die Sorgen und Befürchtungen Warschaus hinsichtlich der Oder-Neiße-Grenze abzubauen“. Die negative Bewertung seiner Äußerungen im Kontext der polnischen Westgrenze stellt sich in der Rückschau Kohls als Erfindung der sozialdemokratischen Opposition und ihr nahestehender Medien dar, denen ein Erfolg seiner Polenreise nicht gelegen gewesen sei: „Anders konnte ich mir damals nicht erklären, weshalb sie ständig die Behauptung verbreiteten, ich stelle die Westgrenze Polens in Frage. Für die Bundesrepublik galt der Warschauer Vertrag von 1970, und darin hieß es unzweideutig, daß wir keine Gebietsansprüche gegenüber Polen hatten. Es stand ebenso eindeutig fest, daß die Bundesregierung und der Bundeskanzler nicht legitimiert waren, eine endgültige Anerkennung der polnischen Westgrenze auszusprechen, solange es keinen handlungsfähigen gesamtdeutschen Souverän gab.“[18]
An anderer Stelle räumt Helmut Kohl ein, daß es sich bei der Frage der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze um eine Gratwanderung gehandelt habe, weil sowohl den „polnischen Sorgen und Ängsten“ als auch den Gefühlen der „Millionen Menschen in der Bundesrepublik“, die „aus den Gebieten östlich von Oder und Neiße vertrieben worden sind“, Rechnung getragen werden mußte:
„Natürlich war mir in jenen Tagen ganz deutlich, daß eine wesentliche Voraussetzung für die Zustimmung der Vier Mächte und unserer Nachbarn zur deutschen Einheit die endgültige völkerrechtliche Anerkennung der Oder-Neiße Linie als polnische Westgrenze sein würde. In den früheren Ostgebieten lebten ja schon in zweiter und dritter Generation Polen, denen dieses Land zur neuen Heimat geworden war. Andererseits schuldeten wir es den Millionen deutscher Heimatvertriebener und Flüchtlinge, diese Anerkennung, die laut Grundgesetz erst von einem gesamtdeutschen Souverän ausgesprochen werden durfte, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern deutlich zu machen, daß hier ein für viele Menschen schmerzhafter Preis für die deutsche Einheit entrichtet wurde. Mit ‚Revisionismus’ oder gar Revanchismus hatte dies wahrlich nichts zu tun. Im übrigen war es auch unsere Pflicht, sicherzustellen, daß im Gegenzug zur Grenzanerkennung die Rechte der deutschen Minderheit, deren Existenz von den kommunistischen Machthabern und von nationalistischen Kreisen in Polen jahrzehntelang geleugnet worden war, in völkerrechtlich verbindlicher Form gesichert werden würde.“[19]
2. Lafontaines Kanzlerkandidatur und die Deutschlandpolitik I
Der SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel, 1983 selbst als Kanzlerkandidat gegen Helmut Kohl unterlegen, wollte klare Verhältnisse: Direkt nach der Landtagswahl im Saarland am 28. Januar sollte Oskar Lafontaine, einen Wahlsieg des amtierenden Ministerpräsidenten vorausgesetzt, zum Kanzlerkandidaten und Herausforderer Kohls gekürt werden. Vogel selber wollte, nachdem schon nach der Rede Lafontaines auf dem Berliner Parteitag eine große Mehrheit der Delegierten ihre Sympathien für diesen bekundet hatte, nicht mehr länger selbst als möglicher Kandidat gehandelt werden. Vogel hatte im Berliner Kongreßzentrum Ende 1989 zur Kenntnis genommen, daß der Hoffnungsträger Lafontaine und der Ehrenvorsitzende und Altkanzler Willy Brandt die Partei begeisterten, während er als Vorsitzender zwar respektiert, gelegentlich aber auch als pedantischer Oberlehrer etikettiert wurde.[20]
Dreißig Jahre nach Godesberg hatte sich die SPD auf dem Berliner Parteitag ein neues Grundsatzprogramm gegeben. Angesichts der Entwicklungen in der DDR wurde die Diskussion über die Verabschiedung des Programms vom Thema Deutschlandpolitik überlagert. Präsidium, Vorstand, Parteirat und Antragskommission hatten die Vorlage der „Berliner Erklärung“, einer grundsätzlichen Stellungnahme zur Deutschlandpolitik mit dem Titel „Die Deutschen in Europa“, kurz vor Beginn des Parteitages noch überarbeitet. Während im Entwurf nicht präzisiert worden war, „ob und wann die Deutschen in beiden Staaten in einer Friedensordnung zu institutioneller Gemeinschaft finden“, wurde nun die Einbettung der deutschen Einheit im Rahmen eines europäischen Integrationsprozesses stärker betont. Im Dezember 1989 deutete sich bereits an, daß die Verfechter der Zweistaatlichkeit, zu denen Lafontaine gehörte, zunehmend in die Defensive gerieten. Bei dem Versuch, in einem Änderungsantrag die Konföderation als Ziel festzuschreiben, aus der „vielleicht auch eine bundesstaatliche Einheit“ entstehen könne, erlitten die „Zweistaatler“ eine Abstimmungsniederlage. Weil in der Berliner Erklärung schließlich – durch die Initiative des Landesverbandes Baden-Württemberg – die Formulierung gewählt wurde, die Konföderation sei die „derzeit realistischste Verfassungsordnung, die dem Wunsch der Menschen in beiden deutschen Teilstaaten nach Einheit institutionellen Ausdruck verleiht“, schien das Manifest eine programmatische Grundlage in der Deutschlandpolitik zu sein, die von einer Mehrheit getragen würde. Geschlossenheit im Wahljahr 1990 schien hergestellt.[21]
Bemerkenswerterweise wurden auf dem Berliner Parteitag sowohl der Ehrenvorsitzende Willy Brandt als auch der potentielle Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine mit stehenden Ovationen gefeiert, obwohl sie in ihren Reden deutlich unterschiedliche deutschlandpolitische Akzente gesetzt hatten: Lafontaines Rede war ein Kontrapunkt zum Patriotismus Willy Brandts. Zur Erleichterung der postnational orientierten Generation der „Enkel“ betonte der saarländische Ministerpräsident die Freiheit des Einzelnen, eingebettet in die „international zu verwirklichende Idee der sozialen Gerechtigkeit“ und verbunden mit der ökologischen Modernisierung der Industriegesellschaft. Als Lafontaine in einer Passage hervorhob, daß das Thema soziale Gerechtigkeit den Menschen in Ost- und Westdeutschland wichtiger sei als eine Debatte über deutschlandpolitische Rechtskonstruktionen, erntete er besonders kräftigen Beifall der Delegierten. „Tatsächlich entschied Lafontaine mit seiner mitreißenden, immer wieder von begeistertem Applaus unterbrochenen Rede im Urteil von Delegierten und Beobachtern die Frage der Kanzlerkandidatur vorzeitig für sich. Umfragen bescheinigten ihm ohnehin seit längerem bessere Chancen als Hans-Jochen Vogel, den Kanzler zu schlagen. Lediglich eine Niederlage bei der bevorstehenden Landtagswahl im Saarland hätte Lafontaines Kandidatur noch einmal gefährden können“, urteilt Wolfgang Jäger.[22]
Anfang Januar 1990 sagte Hans-Jochen Vogel nun auch öffentlich, was ohnehin für jeden Bonner Beobachter offensichtlich war – nämlich, daß die Kandidatur auf Oskar Lafontaine zuliefe. „Er sah darin, wie er mich wissen ließ, eine Gefährdung seines saarländischen Wahlkampfes. Wie das Ergebnis am 28. Januar 1990 zeigte ... hielt sich die Gefährdung, wenn es den wirklich eine war, in Grenzen“, so Hans-Jochen Vogel in seinen Memoiren.[23]
Die Hoffnung der Sozialdemokraten: Gegen den vergleichsweise jungen, eloquenten, gescheiten und populistischen Volkstribun würde der mitunter provinziell wirkende und ungeschickt agierende Pfälzer wie ein verbrauchter Amtsinhaber ohne Visionen erscheinen. In der Tat wäre Lafontaine für Kohl wohl zu einem unbequemen Gegner geworden, wenn dieser nicht von der deutschlandpolitischen Entwicklung Aufwind bekommen hätte. Die guten Wirtschaftsdaten, auf die die christlich-liberale Regierungskoalition verweisen konnte, hätten für eine Wiederwahl unter Umständen nicht ausgereicht.[24]
Hans-Jochen Vogel schildert rückblickend die Gründe, die für einen Kanzlerkandidaten Lafontaine sprachen:
„Erstmals war Lafontaines Name für diese Kandidatur von mir schon im Februar 1987 genannt worden, als Willy Brandt Oskar Lafontaine als denkbaren Nachfolger für sich selbst ins Gespräch gebracht hatte. Im Laufe des Jahres 1989 wurde er immer öfter als derjenige genannt, der für diese Aufgabe am geeignetsten sei. Die Übernahme des Vorsitzes in der Arbeitsgruppe ‚Fortschritt 90’, die de facto das Wahlprogramm vorbereiten sollte, sowie des geschäftsführenden Vorsitzes der Grundsatzprogramm-Kommission durch ihn ließen vermuten, daß er selbst in eine ähnliche Richtung dachte. Sein Engagement und sein Auftreten insgesamt sprachen jedenfalls nicht dagegen ... An für einen Herausforderer wünschenswerten Eigenschaften mangelte es ihm nicht. Er war deutlich jünger als der, gegen den er antreten sollte. Er hatte Kampfeswillen und Durchsetzungsfähigkeit in seinem bisherigen politischen Leben mehr als einmal unter Beweis gestellt, besonders erfolgreich im Saarland. Er verfügte über Erfahrungen in unterschiedlichen Funktionen. Seine sozialdemokratische Grundeinstellung war trotz gelegentlicher Eigenwilligkeiten nicht zweifelhaft. Und wo er eigenwillig war, verstand er es jedenfalls, lebhafte und öffentlichkeitswirksame Diskussionen auszulösen. Mitunter geradezu bestechend war seine Eloquenz, vor allem seine Fähigkeit, im Parlament und auch sonst in der Öffentlichkeit aus dem Stand frei zu reden ...“[25]
Lafontaines unbestrittene Fähigkeiten waren die Grundlage für seinen rasanten Aufstieg innerhalb der Sozialdemokratie: Im Januar 1966 war Lafontaine in die SPD eingetreten und bereits kurze Zeit später Vorsitzender der Jungsozialisten in Saarbrücken geworden. 1969 wird das politische Talent in seinem Wahlkreis für den saarländischen Landtag nominiert, in den er direkt einzieht. 1976 lockt bereits ein Amt, in dem er Regierungsfähigkeit unter Beweis stellen kann: Lafontaine wird Oberbürgermeister von Saarbrücken. Ein Jahr später folgt mit der Wahl zum Landesvorsitzenden der SPD der nächste Karrieresprung. 1980 wird die Saar-SPD unter Lafontaines Führung stärkste Fraktion im Landtag, bleibt aber in der Oppositionsrolle. Unterdessen schwingt sich ihr Hoffnungsträger zu einem der wichtigsten innerparteilichen Kritiker des sozialdemokratischen Bundeskanzlers Helmut Schmidt auf. Neben grundsätzlichen Divergenzen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik nimmt der Parteilinke Lafontaine vor allem den von Schmidt initiierten Nato-Doppelbeschluß zum Anlaß, den Nachfolger Willy Brandts im Kanzleramt unter Beschuß zu nehmen und wird in der SPD zum Wortführer gegen Schmidts Sicherheitspolitik und Galionsfigur einer nachwachsenden Parteigeneration, die – ähnlich wie die entstandene Alternativbewegung der Grünen – von Inhalten der 68er-Studentenrevolte beeinflußt war und stark auf Umverteilung, Ökologie und Pazifismus setzte. In einem Stern -Interview versteigt sich Lafontaine 1982 zu dem Ausspruch, mit Helmut Schmidts „Sekundärtugenden“ wie Pflichtgefühl und Standhaftigkeit könne „man auch ein KZ betreiben“. Im selben Jahr wird Helmut Kohl Bundeskanzler, und innerhalb der Sozialdemokratie befindet sich die zuvor regierungstreue Parteirechte mit Schmidts Abschied von der aktiven Parteipolitik auf dem Rückzug. Der Stern Oskar Lafontaines geht nun vollends auf: 1985 wird der Saarländer Ministerpräsident, gestützt von einer absoluten Mehrheit der SPD im Landtag. Spätestens jetzt verbinden viele Sozialdemokraten ihre Hoffnungen, die Regierung Kohl wieder abzulösen, mit dem Saarländer. Dieser lehnt nach Willy Brandts Rücktritt 1987 zum ersten Mal den ihm angetragenen Parteivorsitz ab und profiliert sich auch sonst nicht als Integrationsfigur: Seine kurz darauf folgenden Vorstöße für flexiblere Arbeitszeiten und Arbeitszeitverkürzung ohne vollen Lohnausgleich bringen ihm nicht nur den Disput mit den Gewerkschaften, sondern auch eine heftige innerparteiliche Kontroverse ein. Nichtsdestotrotz führt Ende der 1980er Jahre bei der Frage, wer beim ersten Bundestagswahlkampf des neuen Jahrzehnts gegen Amtsinhaber Kohl antreten solle, kein Weg mehr an Lafontaine vorbei.[26]
Wenngleich der deutsche Einigungsprozeß im Zuge des politischen Umbruchs von 1989 dem Amtsinhaber Gelegenheit bieten würde, als möglicher Wiedervereinigungs-Kanzler mit historischen Auftritten Punkte zu sammeln, durfte sich Oskar Lafontaine im Falle einer Kanzlerkandidatur gute Chance ausrechnen. Zunächst jedoch hielt Lafontaine die Entscheidung, ob er als Kandidat antreten wolle, offen. Nur wenn er bei den anstehenden Saar-Wahlen die absolute Mehrheit der Mandate verteidigen könne, würde er kandidieren.[27]
Der saarländische Wahlkampf, bereits ein Testlauf für Bonn, schien Lafontaine zu bestätigen, daß er die richtigen Themen gewählt hatte. Während Kanzler Kohl auf Patriotismus im beginnenden Einigungsprozeß setzte, legte Lafontaine den Schwerpunkt auf soziale Themen, wobei er – ganz Populist – durchaus die Ängste eines Teils der westdeutschen Bevölkerung bediente, die von dem täglich anwachsenden Übersiedlerstrom aus der DDR verunsichert war und ihre ostdeutschen Landsleute teilweise auch als soziale Bedrohung empfanden: als Konkurrenten um Wohnungen, Arbeitsplätze, Kindergartenplätze, Renten und Sozialleistungen. Für Lafontaine war das Thema soziale Gerechtigkeit die Achillesferse der Regierungskoalition: „Hier können wir sie jagen, hier haben wir ein Instrument, allen Übersteigerungen des Nationalismus, die jetzt wieder hochgekommen sind, zu widerstehen“, versuchte der potentielle Kandidat seinen Genossen einzutrichtern.[28]
Kohl hielt im saarländischen Wahlkampf dagegen: Lafontaines sei ein „schrankenloser Opportunist“, der „jedem Stammtisch nach dem Munde“ rede. Der Kanzler, vor wenigen Monaten noch innerparteilich angeschlagen, hatte aus den historischen Wendeereignissen neue Kraft geschöpft. Die Perspektive, das „Wunder der Einheit“ zu gestalten, gar als „Kanzler der Einheit“ in die Historie einzugehen, war Motivation genug. Kohl war sich sicher, daß die patriotische Freude über die Einheit Deutschlands „über den Neid“, seiner Auffassung nach vom Populisten Lafontaine noch angeheizt, siegen würde.[29]
Daß der nicht abreißende Übersiedlerstrom (Woche für Woche kamen Tausende Ostdeutsche in den Westen) viele Menschen in der Bundesrepublik verunsicherte, war angesichts eindeutiger Umfrageergebnisse offensichtlich: Bis zu achtzig Prozent der Westdeutschen empfanden die ostdeutschen Landsleute, die Überbrückungsgeld und Eingliederungshilfen in Anspruch nehmen konnten, zunehmend als Belastung. Nicht zuletzt die verantwortlichen Kommunalpolitiker, die kaum mehr wußten, wo sie die Übersiedler unterbringen sollten, kritisierten die Eingliederungshilfen und finanziellen Anreize. Oskar Lafontaine hatte die Stimmung erkannt und das Thema besetzt, indem er das Ende des bisherigen Aufnahmeverfahrens forderte. Auch in der Union begann die Stimmung zu kippen, wie Wolfgang Schäuble in „Der Vertrag“ schildert:
„Die Sorge wuchs, die Wiedervereinigung könnte von einer nationalen zu einer sozialen Frage werden. Man fühlte sich im Hintertreffen – in einem Wahljahr dieser Größenordnung ein schwer erträglicher Gedanke. Unter dem Einfluß elektronischer Medien erlebten wir einmal mehr den viel schnelleren Wechsel von Stimmungen, stärkere Schwankungen der öffentlichen Meinung als in früheren Zeiten, Hysterie und Freudenstürme. Die Tränen der Rührung nach dem 9. November haben Oskar Lafontaine schon zwei Wochen danach nicht mehr daran gehindert, sehr erfolgreich Ressentiments gegen die Übersiedler zu schüren. So schnell geht das. Ich habe die Meinung vertreten, das Anliegen – der Wiedergewinnung der Einheit und der Freiheit für sechzehn Millionen Deutsche in der DDR – sei von so überragender Bedeutung, daß die sicherlich auch wichtigen sozialen Themen darüber nicht dominieren könnten. Mit dem Anliegen der Einheit würden wir die Wahlen gewinnen – eine Ansicht, die auch Helmut Kohl teilte ...“[30]
Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt, fast ein Jahr noch bis zum Bundestagswahltermin, waren die Strategien der Kontrahenten im Ansatz deutlich geworden: Lafontaine zielte auf den Westen Deutschlands, auf das sozial verunsicherte untere Drittel der bundesrepublikanischen Gesellschaft, auf das linksliberale Bildungsbürgertum und auf friedensbewegte Linksalternative mit Sorge um die ökologische Entwicklung und wenig Verständnis für patriotische Aufwallungen. Helmut Kohl dagegen setzte auf die etablierten Ober- und Mittelschichten, die durchaus patriotisch gestimmt waren und wenig Angst vor ostdeutscher Konkurrenz in Westdeutschland und maßvollen Sozialtransfers nach Ostdeutschland hatten, sowie auf das nationalkonservative Wählerreservoire. Und schließlich: Er machte Politik im Interesse einer Mehrheit der Menschen in der DDR, die im Frühjahr eine neue Regierung wählen sollten.[31]
Was die Menschen in der Noch-DDR betraf, hatten allerdings auch die Sozialdemokraten einen populären Sympathieträger: Altkanzler Willy Brandt, mittlerweile 76 Jahre alt. In den Wochen und Monaten nach dem Mauerfall hatte Brandt mehrfach auf Großkundgebungen in der DDR gesprochen, wo ihm, wie z.B. in Magdeburg, bis zu 70 000 Menschen einen überwältigenden Empfang bereiteten. Die „vielen deutschen Fahnen um uns herum“ waren für den Altkanzler ein deutliches Indiz dafür, daß die Ostdeutschen auf die Einheit setzten. „Wir müssen aufpassen, daß nicht eine Grundwelle in unserem Volk uns wegspült“, warnte Brandt in diesen Tagen seine sozialdemokratischen Parteifreunde. Die von ihm gewählte Ansprache „Liebe Landsleute“ wurde von den Magdeburgern mit einem langgezogenen „Jaaa“ aufgenommen. Für den SPD-Ehrenvorsitzenden wurde immer deutlicher, daß nun, da die Einheit „von unten“ möglich zu werden schien, die Menschen in der DDR selbstbestimmt über das zukünftige Verhältnis der beiden deutschen Staaten zueinander entscheiden müßten. Nichtsdestotrotz: Noch war Willy Brandt bereit, seinen politischen Enkel und Einheitsskeptiker Oskar Lafontaine im anstehenden Bundestagswahlkampf zu unterstützen. „Daß ich einem Kandidaten mit meinem Rat zur Verfügung stehe, davon kann man ausgehen. Ich sperre mich nicht“, hatte Brandt zu erkennen gegeben.[32]
Wenige Wochen später konnte der potentielle Kandidat Lafontaine bei den Landtagswahlen im Saarland am 28. Januar 1990 erwartungsgemäß einen eindrucksvollen Erfolg verbuchen: 54,4 Prozent der wahlberechtigten Saarländer votierten für die SPD, die Union (mit Spitzenkandidat Klaus Töpfer) landete abgeschlagen bei 33,4 %, die FDP übersprang mit einem Wert von 5,6 die 5-Prozent-Hürde und Republikaner (3,3 %) sowie Grüne (2,7 %) verpaßten den Sprung in den Landtag. Mit Lafontaines Triumph waren die Zweifel ausgeräumt, wer als Herausforderer Helmut Kohls antreten würde. Alles lief auf den bestätigten saarländischen Ministerpräsidenten zu, der am 29. Januar, einen Tag nach der Landtagswahl, dann auch von Hans-Jochen Vogel als Kanzlerkandidat der SPD im Bundestagswahlkampf 1990 ausgerufen wurde.[33]
Hans-Jochen Vogel räumt in seinen Memoiren allerdings ein, daß es – nicht nur angesichts der deutschlandpolitischen Entwicklungen – auch Zweifel an einer Kandidatur Lafontaines gegeben habe:
„Etwa, daß er sehr stark auf seine eigene Person bezogen sei, oder eine Neigung zu unabgestimmten, zum Teil sogar vorherige Abreden und Beschlüsse außer acht lassende Vorstößen und auch seine Eigenart, andere seine Überlegenheit oder seine recht bestimmende Meinung über sie durchaus merken zu lassen. Aber gerade die jüngeren Führungspersonen sahen darin eher zusätzliche Qualifikationen und waren ziemlich einhellig für ihn ... Davon ganz abgesehen war eine andere zur Kandidatur geeignete und bereite Führungsperson nicht zu sehen. Johannes Rau und ich hatten gute Gründe, nicht ein zweites Mal anzutreten ... Angesichts der Haltung, die Oskar Lafontaine im Zuge des in Gang gekommenen Änderungsprozesses in der DDR an verschiedenen Stellen einnahm, und des Umstandes, daß die Deutschen in der DDR möglicherweise schon an der nächsten Bundestagswahl teilnehmen würden, war es Pflicht aller Beteiligten, die Kandidatenfrage noch einmal zu überdenken. Ich verschweige nicht, daß mir gewisse Zweifel über die Reaktion der DDR-Bürger- und Bürgerinnen nicht unberechtigt erschienen. Aber das Ergebnis meiner Überlegungen war das gleiche wie zuvor. Dabei spielte die Resonanz, die er auf dem Berliner Parteitag ausgelöst hatte, eine Rolle. Außerdem war ich zuversichtlich, daß er den DDR-Deutschen nicht – oder besser nicht mehr – vor den Kopf stoßen würde
... Und er mußte wissen, daß ein Sieg ohne ausreichende Zahl von Stimmen aus der – dann ehemaligen – DDR nicht zu erringen war. Nur um in diesem Zusammenhang eine Legende ... auszuräumen, füge ich hinzu: Willy Brandt hat mir gegenüber nicht die leiseste Andeutung gemacht, daß er angesichts des Umbruchs in der DDR noch einmal selber antreten wolle ...“[34]
3. Kohl, Gorbatschow und die deutsche Einigung I
Die Bild -Zeitung wartete angesichts des zu erwartenden historischen Ereignisses mit einer an Pathos kaum zu übertreffenden Schlagzeile auf: „Betet – morgen machen sie Deutschland“, titelte das Boulevardblatt. Gemeint waren Michail Gorbatschow und Helmut Kohl. Die Bonner Delegation um den Bundeskanzler sollte am 10. Februar in Moskau ankommen.[35]
Gesprächsstoff hatten die Regierungen von Sowjetunion und Bundesrepublik mehr als genug: Die DDR war dem Staatsbankrott nahe, der Strom an DDR-Übersiedlern intensivierte sich, und die amtierende DDR-Regierung unter Hans Modrow war nahezu handlungsunfähig. Angesichts der Erosion des ostdeutschen Staates war für Helmut Kohl „nunmehr unumgänglich, daß die beiden deutschen Staaten sich untereinander über den einzuschlagenden Weg zur Vereinigung verständigen“. Ohne Moskaus Einverständnis war die Deutsche Einheit jedoch nicht vorstellbar, und der Kreml hatte nach Kohls Zehn-Punkte-Plan im November 1989, mit dem der Kanzler eine Konföderation beider deutscher Staaten als Perspektive aufgezeigt hatte, die bilateralen Beziehungen aus Verärgerung nahezu eingefroren.[36]
Weil Kohl mit besagtem Plan die Initiative ergriffen hatte, konnte er sich nicht sicher sein, ob das mühsam aufgebaute Verhältnis zu Gorbatschow nicht nachhaltig getrübt sein würde. Immerhin hatte Kohl in der Anfangsphase seiner Kanzlerschaft mit seinem Goebbels-Gorbatschow-Vergleich zunächst viel Porzellan zerschlagen. Erst im Juli 1989 waren die Staatsmänner sich im Rahmen des Bonn-Besuchs Gorbatschows persönlich näher gekommen. Bei einem intensiven Gespräch am Rheinufer scheint eine Charaktereigenschaft Kohls zum Tragen gekommen zu sein, die ihm bei aller unterstellten Provinzialität zunehmend auch von politischen Gegnern nicht mehr abgesprochen wurde und im Einigungsprozeß nicht ohne Relevanz blieb: Ihm gelang offensichtlich auch bei Michail Gorbatschow, dessen politischer Werdegang und Hintergrund nicht anders hätten sein können, der Sprung auf eine persönliche, freundschaftliche Ebene. Werner Weidenfeld erkennt darin ein Prinzip der Kohlschen Politik: „Gute persönliche Beziehungen über strukturelle Einzelaspekte zu stellen, war ... ein Charakteristikum von Kohls Verhandlungsstil. Sein Bestreben, enge, ja pseudo-private Kontakte zu möglichst vielen ausländischen Staats- und Regierungschefs aufzubauen, war dabei nicht nur Selbstzweck; Immer wieder warf der Bundeskanzler 1989/90 sein persönliches Ansehen in die Waagschale, indem er sich nach dem Motto ‚Vertrauen gegen Vertrauen’ als personifizierten Garanten für eine berechenbare Politik anbot.“[37]
Gorbatschows Erinnerung an den Juli 1989 bestätigt dies: „Ich teile wirklich die Auffassung des Bundeskanzlers, daß dieses Treffen aus uns nicht nur Partner, sondern auch Freunde gemacht hat. Und das hatte eine riesige Bedeutung – vor allem dann, als wir dann von diesem Haufen von Problemen überrollt wurden, die für unsere beiden Staaten wichtig waren, aber auch für die DDR, für Europa und die ganze Welt.“ Nachdem die beiden Staatschefs über ihre persönlichen Biographien gesprochen hatten, sagte Helmut Kohl, auf den Rhein deutend, den bildhaften Satz: „Schauen Sie sich den Fluß an, der an uns vorbeiströmt. Er symbolisiert die Geschichte; sie ist nichts Statisches. Sie können diesen Fluß stauen, technisch ist das möglich. Doch dann wird er über die Ufer treten und sich auf andere Weise den Weg zum Meer bahnen. So ist es auch mit der deutschen Einheit. Sie können ihr Zustandekommen zu verhindern suchen. Dann erleben wir sie beide vielleicht nicht mehr. Aber so sicher wie der Rhein zum Meer fließt, so sicher wird die deutsche Einheit kommen – und auch die europäische Einheit ...“ Die Frage sei nur, so der Bundeskanzler zu Gorbatschow, „machen wir es in unserer Generation, oder warten wir weiter – mit all den Problemen, die damit verbunden sind?“ Noch einmal habe er bekräftigt, daß die Deutschen sich mit der Teilung nicht abfinden würden. Gorbatschow habe sich seine Überlegungen angehört und nun nicht mehr widersprochen, schildert Kohl in „Ich wollte die deutsche Einheit“.[38]
Zunächst konnte bei den deutsch-sowjetischen Konsultationen im Februar 1990 von einer derart beschaulichen Atmosphäre nicht die Rede sein. Der Empfang, den Gorbatschow und sein Außenminister Schewardnadse der Bonner Delegation bereiteten, war unterkühlt. Wahrscheinlich war es die begleitend zugesagte Wirtschaftshilfe Bonns (Nahrungsmittel im Wert von 220 Millionen Mark für die Bevölkerung in der UdSSR), die dafür sorgte, daß „die frostige Atmosphäre auftaute“, wie sich Horst Teltschik erinnert. Für den Kanzlerberater war der Gesprächsverlauf in zwei wichtigen Punkten sensationell: Gorbatschow hatte zunächst erklärt, daß es seiner Meinung nach „keine Meinungsverschiedenheiten über die Einheit“ zwischen der Sowjetunion, der Bundesrepublik und der DDR gebe. Es sei das Recht der Menschen in Deutschland, die Einheit in Selbstbestimmung anzustreben. Dann folgte der vielleicht noch wichtigere Teil: Gorbatschow legte sich auch in der Frage der Bündniszugehörigkeit eines wiedervereinigten Deutschlands nicht endgültig fest, machte gegenüber Kohl aber gleichwohl deutlich, daß er ein vereintes Deutschland lieber außerhalb der Bündnisse sehen würde, „mit nationalen Streitkräften, die für die nationale Verteidigung ausreichten. Überlegungen, ein Teil Deutschlands solle der NATO, der andere Teil dem Warschauer Pakt angehören, nehme er nicht ernst“, erinnert sich Kohl später an die Ausführungen Gorbatschows.[39]
Daß der Generalsekretär dem Bundeskanzler zu diesem Zeitpunkt noch keine definitive Zusage über die sowjetische Zustimmung zur Mitgliedschaft eines vereinten Deutschlands in der NATO geben würde, war nicht überraschend, zumal der sowjetische Außenminister Schewardnadse noch am Morgen vor dem Beginn der Konsultationen bei einer vorgeschalteten Pressekonferenz den Eindruck hinterlassen hatte, Moskau bestünde auf einer Neutralisierung Deutschlands als Gegenleistung für die sowjetische Zustimmung zur Wiedervereinigung: „Die Idee der Neutralisierung ist nicht neu. Es ist eine gute Idee. Sie wurde gleich nach dem Krieg vorgebracht. Ich möchte es noch genauer sagen: Wir sind von Anfang an für die Einheit der deutschen Nation gewesen, aber wir waren für ein neutralisiertes und entmilitarisiertes Deutschland. Das war unser Grundsatz. Wie wollen wir künftig verfahren? Bundeskanzler Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher treffen heute in Moskau ein. Wir werden miteinander sprechen, und es gibt ein Treffen mit Michail Gorbatschow. Wir werden versuchen, alle diese Probleme zu diskutieren, die nun Europa, die beiden deutschen Staaten und, ich glaube, die ganze Welt so bewegen.“[40]
Der Bundeskanzler hatte im Verlauf der Gespräche deutlich gemacht, daß eine Blockfreiheit eines vereinigten Deutschlands für die Bundesregierung „nicht in Frage kommt“, wenngleich die deutsche Position nicht in derart simpler Form formuliert, sondern von Kohl und Genscher eingebettet wurde in ein Bündel von sicherheitspolitischen Zugeständnissen an die sowjetische Führung.[41]
Hans-Dietrich Genscher:
„Im Verlauf der Entwicklungen zeigte sich, daß eine vorsichtige Gangart, die der Sowjetunion den Willen zur vollen Mitgliedschaft in der NATO, aber auch die Rücksichtnahme auf sowjetische Sicherheitsinteressen signalisierte, aussichtsreicher erschien als die in der Sache richtige, aber nackte Forderung: ‚Deutschland muß Mitglied der NATO sein’. Alle Rechte und Pflichten einer Mitgliedschaft für ganz Deutschland, einschließlich der Schutz- und Verteidigungsgarantien der Artikel 5 und 6 aus dem NATO-Vertrag, mußten gesichert werden. Eine solche Regelung verlangte eine Einbettung in neue Rahmenbedingungen, die Moskau die Zustimmung erleichterten: so die Reduzierung der deutschen Streitkräfte, der deutsche Verzicht auf ABC-Waffen, die Nichtstationierung alliierter Streitkräfte auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, die ‚Entfeindung’ der Bündnisse und anderes mehr.“[42]
Trotz aller Zugeständnisse an die Sicherheitsinteressen Moskaus: Daß Gorbatschow, ungeachtet der deutschen Position, eine Neutralisierung nicht in Betracht zu ziehen, das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen, also eine mögliche Wiedervereinigung, nicht in Frage stellte, mußte die Weltöffentlichkeit überraschen und ließ noch am selben Tag das Wort vom „Durchbruch“ in der Deutschlandfrage kursieren.[43]
Bevor auf dem Rückflug der deutschen Delegation vor laufenden Kameras die Sektkorken knallten, erklärte Helmut Kohl vor der internationalen Presse um 22 Uhr Moskauer Zeit:
„Ich habe heute abend an alle Deutschen eine einzige Botschaft zu übermitteln. Generalsekretär Gorbatschow und ich stimmen darin überein, daß es das alleinige Recht des deutschen Volkes ist, die Entscheidung zu treffen, ob es in einem Staat zusammenleben will. Generalsekretär Gorbatschow hat mir unmißverständlich zugesagt, daß die Sowjetunion die Entscheidung der Deutschen, in einem Staat zu leben, respektieren wird und daß es Sache der Deutschen ist, den Zeitpunkt und den Weg der Einigung selbst zu bestimmen. Ich danke Generalsekretär Gorbatschow, daß er dieses historische Ergebnis ermöglicht hat ... Meine Damen und Herren, dies ist ein guter Tag für Deutschland, und ein glücklicher Tag für mich persönlich.“[44]
In Moskau waren nicht nur die Weichen in Richtung Einheit gestellt worden, auch Helmut Kohls Wiederwahl als Bundeskanzler wurde wahrscheinlicher, da nun bei den anstehenden historischen Ereignissen das Bild vom „Kanzler der Einheit“ gezeichnet werden konnte, dem es durch Verhandlungsgeschick und persönliche Bindungen gelingt, den außenpolitischen Partnern Zugeständnisse abzuringen. Helmut Kohl hat, von seinem zögerlichen und späten Bekenntnis zur Oder-Neiße-Grenze abgesehen, keine diplomatischen Fehler im Einigungsprozeß gemacht und sicherlich auch von gewachsenen außenpolitischen Partnerschaften profitiert. Herbeigeführt hat er die Einheit nicht. Vielmehr war es der Druck einer ostdeutschen Bevölkerung, die – „wie das Wasser zum Meer“ – in Richtung Freiheit und westlichem Wohlstand drängte und in einer schnellen Wiedervereinigung den direkten Weg dorthin erkannte. Immerhin zählte man alleine im Januar 55 000 Übersiedler aus der DDR. Und vor allem: Die deutsche Regierung traf auf einen sowjetischen Verhandlungspartner, der vor dem Hintergrund riesiger politischer und ökonomischer Probleme nicht aus einer Position der Stärke heraus argumentieren konnte.[45]
Auf diesen Punkt wies damals auch Welt -Journalist Joachim Neander hin:
„Der Schlüssel zur deutschen Einheit, so lautete jahrzehntelang eine fast schon zur Binsenweisheit erstarrte Floskel, liege in Moskau. Und hätte vor fünf oder zehn Jahren jemand die Vision einer Wiedervereinigung entworfen, er hätte sie vermutlich genauso geschildert: Irgendwann, vielleicht in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts, reist der Kanzler der Bundesrepublik nach Moskau, um sich dort den Schlüssel zur deutschen Einheit aushändigen zu lassen. Doch gerade dies ist jetzt nicht geschehen. Nicht Michail Gorbatschow hat das Tor geöffnet. Es war bereits offen ... Gorbatschow hat im eigenen Lande gewaltige Probleme. Er muß alles tun, um sie an der Westgrenze seines Machtbereiches nicht noch größer werden zu lassen. Im eigenen Interesse durfte er sich einer Entwicklung, die längst seinem Einfluß entglitten war, nicht entgegenstemmen. Er war gezwungen, auf Schadensbegrenzung, auf Stabilisierung des noch Intakten auszugehen. Dies hat er auf eine vernünftige Art und Weise getan. Und dennoch hat die Moskaureise von Helmut Kohl historische Bedeutung. Jetzt erst, nach dem vierstündigen Gespräch mit Gorbatschow und dessen offizieller Zustimmung zur allein deutschen Zuständigkeit, befindet sich der denkwürdige, in seiner Beschleunigung und Dramatik nicht ungefährliche Prozeß zur deutschen Einheit auf der richtigen Schiene.“[46]
Als Helmut Kohl von Michail Gorbatschow den „Schlüssel zur deutschen Frage“ überreicht bekam, wie auch die Süddeutsche Zeitung in diesen Tagen schrieb, war der Gesprächsverlauf des Moskauer Treffens wohl schon weitgehend vom Kreml vorgezeichnet. Aus Gorbatschows engstem Beraterkreis wurde später rückblickend kolportiert, daß dieser spätestens nach dem Besuch von DDR-Ministerpräsident Hans Modrow am 30. Januar überzeugt gewesen sei, daß der Satellitenstaat DDR nicht mehr zu halten sein würde. In eine ähnliche Richtung wie im Rahmen der Gespräche mit der Kohl-Delegation hatte sich Gorbatschow auch schon nach dem Modrow-Besuch geäußert, wenngleich rhetorisch noch nicht so deutlich. Aber bereits öffentliche Äußerungen nach der Modrow-Visite („Die Vereinigung der Deutschen wird niemals und von niemandem prinzipiell in Zweifel gezogen“, die Frage der deutschen Einigung stehe auf der Tagesordnung, müsse aber „vertrauensvoll entschieden, nicht auf der Straße gelöst“ werden) lösten in der Bundesrepublik euphorische Kommentare aus: Mit „Einheit in diesem Jahr“ war die Titelgeschichte des Spiegel am 5. Februar überschrieben, und während Herausgeber Rudolf Augstein seinen Kommentar freudig aber zurückhaltend mit „Es bewegt sich was“ überschrieb und noch auf Gorbatschows sprachliche Einschränkungen („prinzipiell“, „ein gewisses Einverständnis“) verwies, war die Sache für Altkanzler Willy Brandt („Die Einheit ist gelaufen“) im Spiegel -Interview bereits entschieden.[47]
Wenn es Amtsinhaber Helmut Kohl gelingen würde, die staatliche Einheit nach Verhandlungen mit den vier Siegermächten des Zweiten Weltkriegs und einer bald neu gewählten DDR-Regierung noch vor dem Bundestagswahltermin am 2. Dezember zu vollziehen, wäre ihm der Wahlsieg nicht mehr zu nehmen. Oskar Lafontaine wird sich dessen bewußt gewesen sein. Die Forderung des Saarländers, die Einheit Deutschlands müsse der europäischen Einigung untergeordnet, sozialpolitisch abgefedert sein und vor allem langsamer vollzogen werden, muß ungeachtet der inhaltlichen Überzeugungen Lafontaines auch im machtpolitischen Kontext gesehen werden. Kleine, langsame Schritte zur Einheit würden ihm, der seinen Wahlkampf ganz auf Westdeutschland zugeschnitten hatte, zugute kommen, falls die Wahlen lediglich im Gebiet der alten Bundesrepublik stattfinden würden.[48]
Im Spiegel -Interview machte unterdessen SPD-Patriarch Willy Brandt, lange wohlwollender Förderer Oskar Lafontaines, verklausuliert deutlich, daß ein erfolgreicher Einigungsprozeß für ihn Vorrang vor der Wahlkampfstrategie des Kandidaten habe. Frage des Nachrichtenmagazins: „Haben Sie vor, in den kommenden Wahlkämpfen an der Seite Lafontaines mit verteilten Rollen für die SPD zu werben: Brandt stärker für das Gemüt der Deutschen, Oskar Lafontaine für die scharfen Rechner, die ihren Wohlstand verteidigen?“ Antwort des Altkanzlers: „Ich lese mit Interesse, was da hineininterpretiert wird, und ich halte es nicht für lohnend, dagegen jetzt zu opponieren. Nur ich sage Ihnen auch: Ich spiele keine von irgend jemanden mir zugedachte Rolle, sondern ich sage in dieser Phase der Entwicklung und meines eigenen Lebens das, was ich für richtig halte, egal, ob es in ein Parteikonzept hineinpaßt oder nicht.“[49]
4. Lafontaines Kanzlerkandidatur und die Deutschlandpolitik II
Der Ehrenvorsitzende Willy Brandt war nicht der einzige sozialdemokratische Spitzenpolitiker, der, wie der Spiegel formulierte, „den Schnellzug in Richtung deutsche Einheit“ bestiegen hatte: Neben dem Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel, der Lafontaine bereits nach der Saar-Wahl zum SPD-Kanzlerkandidaten erklärt hatte, bekräftigte nun auch Ingrid Matthäus-Maier ihren Vorschlag, stufenweise eine Wirtschafts- und Währungsunion mit der DDR einzugehen. Den Menschen in Ostdeutschland, argumentierte Matthäus-Maier in mehreren Zeitungsartikeln sowie in der Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion am 6. Februar, müsse eine Perspektive eröffnet werden, nicht zuletzt um den anhaltenden Übersiedlerstrom einzudämmen. Die D-Mark sollte als offizielles Zahlungsmittel in der DDR zugelassen und die Ostwährung schrittweise aus dem Verkehr gezogen werden. Unterstützung fand die SPD-Finanzexpertin bei Parteichef Vogel sowie u.a. bei Hans Büchler, Klaus von Dohnanyi sowie dem wirtschaftspolitischen Sprecher Wolfgang Roth. Damit schien sich ein Konsens mit der Bundesregierung abzuzeichnen, die ebenfalls eine Währungsunion mit der DDR in Erwägung gezogen hatte.[50]
Eine Entwicklung, die der potentielle Kandidat nicht unbeantwortet ließ: Lafontaine, der sich nach seinem fulminanten Sieg im Saarland zwei Wochen in Spanien erholte, stellte nun Bedingungen auf, ohne deren Erfüllung er nicht bereit sei, als Herausforderer Kohls in den Ring zu steigen. Die wohl wichtigste Voraussetzung war, daß die Sozialdemokraten nicht wie die Union den schnellen Beitritt der DDR noch vor dem Wahltermin am 2. Dezember forderten. In einem solchem Fall müsse er seine Entscheidung revidieren. Die im Spiegel zitierte Begründung: Er sei keinesfalls bereit, den „Kopf für ein Chaos hinzuhalten, das andere unter Führung von Kohl angerichtet haben“. Lafontaine kündigte an, daß er am Tag nach der Volkskammerwahl am 18. März seine Bereitschaft zur Kanzlerkandidatur nur zu bestimmten Konditionen erklären wolle, darunter die Absage an eine schnelle Währungsunion ohne Abstimmung mit allen EG-Ländern und nicht zuletzt erschwerte Bedingung für DDR-Übersiedler, die zumindest eine Wohnung und einen festen Arbeitsplatz als Voraussetzung nachweisen müßten. Überhaupt habe sich die deutsche Einheit der europäischen Einigung unterzuordnen, der Einigungsprozeß müsse sozialpolitisch besser abgefedert und stärker mit den Nachbarn abgestimmt werden.[51]
Oskar Lafontaine, der sich und seine Strategie durch den Triumph an der Saar bestätigt sah, wollte Helmut Kohl bei den in Westdeutschland anstehenden Landtagswahlen in Niedersachsen und NRW mit derselben Marschroute in Bedrängnis bringen. Schließlich hatte dieser hohe Erwartung geweckt, als er in einer Regierungserklärung vor Besorgnis in der Bundesrepublik angesichts des Übersiedlerstroms warnte: „Unser soziales Netz bleibt dicht geknüpft. Kein Rentner, kein Kranker, kein Arbeitsloser, kein Kriegsopfer braucht Leistungskürzungen zu befürchten.“ Versprechung, die „dem Kanzler noch aufstoßen“ würden, diagnostizierte Lafontaine in diesen Februar-Wochen. Jeder DDR-Bürger, der dies gehört habe, ließ Lafontaine durchblicken, müsse „bekloppt“ sein, wenn er sich nicht schnellstens in den Westen absetze. Die möglichen Folgen eines ungehemmten Übersiedlerstroms schilderte der Saarländer einmal mehr eindringlich: Irgendwann werde „hier der Kessel überkochen. Dann will ich sehen, wo wir mit Deutschland, einig Kohl oder Deutschland, einig Unverstand hinkommen. Dann kriegen die Republikaner 15 Prozent.“[52]
Unterdessen mußte der Kohl-Kontrahent zur Kenntnis nehmen, daß neben einer ganzen Reihe westdeutscher Parteifreunde vor allem Stimmen in der Ost-SPD lauter wurden, die von Lafontaine ein stärkeres Bekenntnis zur deutschen Einigung einforderten. Bereits am 14. Januar hatten die ostdeutschen Sozialdemokraten auf ihrer Delegiertenkonferenz eine Erklärung verabschiedet, die sich auf das Ziel eines geeinten Deutschlands festlegte. Wenngleich der westdeutsche SPD-Hoffnungsträger auf dem folgenden Parteitag der DDR-SPD am 25. Februar in Leipzig standesgemäß umjubelt wurde, entging den Delegierten doch keineswegs, daß Oskar Lafontaine, wie der spätere DDR-Außenminister Markus Meckel zum Ausdruck brachte, „das Interesse der Bundesbürger formuliert“ hatte. Verglichen mit den einfachen, griffigen und für DDR-Bürger reizvollen Slogans der von Kohl gestützten „Allianz für Deutschland“ („Wohlstand statt Sozialismus“) waren Lafontaines Thesen auf dem Leipziger Parteitag wenig populär in ostdeutschen Ohren: „Die D-Mark ist nicht alles“, so Lafontaine, „bruchartige Lösungen“ bei der Einführung der Währungsunion für ihn nicht tragbar und Helmut Kohls „unverantwortliche Versprechungen“ Beispiele für „Einfalt und Unverstand“, die sich in den nächsten Monaten in Deutschland nicht durchsetzen dürften.[53]
5. Volkskammerwahl in der DDR
Wenn man der Argumentation Oskar Lafontaines folgen will, haben sich bei den Volkskammerwahlen am 18. März „Einfalt und Unverstand“ durchgesetzt: Die erste freie Wahl in der DDR endete mit einem Traumergebnis für Helmut Kohls politische Partner, die konservative „Allianz für Deutschland“, bestehend aus DDR-CDU, Demokratischem Aufbruch (DA) und Deutscher Sozialer Union (DSU). Das von der West-CDU massiv unterstütze Bündnis verpaßte mit 48,15 Prozent nur knapp die absolute Mehrheit in der Volkskammer. Die Ost-SPD, in nahezu allen Umfragen als der sichere Sieger gehandelt, mußte sich abgeschlagen mit 21,8 Prozent begnügen; nur knapp vor der PDS, die – als Nachfolgepartei der SED – noch auf 16,3 Prozent kam. Die Liberalen, angetreten als „Bund freier Demokraten“, landeten bei 5,2 Prozent.[54]
Im Vorfeld der Volkskammerwahl war sich Helmut Kohl lange nicht schlüssig, welche Gruppierung er unterstützen sollte, da aus seiner Perspektive die Gefahr bestand, daß die Ost-CDU angesichts ihrer Vergangenheit als Blockpartei im SED-System beim ostdeutschen Wähler diskreditiert sein könnte. Auch daß der Vorsitzende der Ost-CDU, Lothar de Maizière, noch Anfang 1990 von gewissen „Errungenschaften des Sozialismus“, die es zu bewahren gelte, sprach und zudem nicht eindeutig einzuschätzen war, welche Rolle er als stellvertretender Ministerpräsident in der Regierung Hans Modrows spielte, ließ den Bundeskanzler in seiner Beurteilung der Ost-CDU schwanken. Die Ergebnisse der Meinungsforschungsinstitute, fast durchgängig prognostizierten sie einen Wahlsieg der SPD, schienen die Vorbehalte Kohls zu bestätigen. Der Vorsitzende der West-CDU kam nach langem Zögern zu der Einsicht, „daß es gelingen müsse, die verschiedenen neuen oppositionellen Gruppierungen möglichst mit der Ost-CDU zusammenzubringen“, schreibt Wolfgang Schäuble:
„Nur durch eine Konzentration der Potentiale aus der Ost-CDU und neuer revolutionärer Gruppen sah er eine hinreichende Wahlchance für gegeben an. Zudem konnte die Ost-CDU durch solche Bündnisse über die Erneuerung ihres Führungspersonals und -programms hinaus ein Stück von dem Ballast ihrer Vergangenheit als Blockpartei abwerfen. Zwischen dieser Einsicht und der Verwirklichung des Ziels indes lagen beinahe Welten: Die verschiedenen Beteiligten in der DDR zeigten zunächst nicht die geringste Neigung, miteinander zusammenzugehen ... Aber mit jedem Tag, an dem die Wahl am 18. März näher rückte, wurde den Beteiligten klarer, daß alle Gruppierungen auf Unterstützung aus dem Westen angewiesen waren ... In der ersten freien Wahl in der DDR würden die politischen Gruppierungen aus der Bundesrepublik Deutschland eine maßgebliche Rolle spielen, und ohne Unterstützung aus dem Westen würden die Wahlchancen in der DDR für die meisten gering sein Mit diesem Pfund, daß die Unterstützung der CDU Deutschlands für denjenigen, die sie in der DDR bekommen würde, eine wesentliche Bedeutung haben würde, wucherte Helmut Kohl, und schließlich gelang es ihm in einer Besprechung am 5. Februar in Berlin, die Vorsitzenden de Maizière, Ebeling (DSU) und Schnur (DA) zur Gründung des Wahlbündnisses ‚Allianz für Deutschland’ zu veranlassen. Welche Leistung von ihm persönlich dahintersteckte, dieses Bündnis zustande gebracht zu haben, wird allein daran deutlich, daß sich die Beteiligten aus der DDR bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal persönlich kennenlernten.“[55]
Helmut Kohl hatte, indem er das von der West-CDU protegierte konservative Wahlbündnis „Allianz für Deutschland“ schmiedete, eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg bei der Volkskammerwahl geschaffen. Schließlich waren sein persönlicher Einsatz im DDR-Wahlkampf und die dort gemachten Versprechungen auf fruchtbaren Boden gefallen. Die Mehrheit der DDR-Bürger wollte den schnellen Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes (nach Artikel 23), eine freie Wirtschaft und vor allem die zügige Währungsunion. Der Glaube, mit Einführung der D-Mark würde auch Wohlstand nach westlichem Muster einkehren, war in Ostdeutschland weit verbreitet. Ebenso groß die Erwartungen an Kohl, der im Wahlkampf mit dem Versprechen geworben hatte, daß die noch-DDR „in etwa fünf Jahren ein blühendes Land“ sein werde.[56]
Es liegt in der Tat nahe, daß ein Großteil der Wähler, die sich für die Allianz entschieden hatten, sich nicht ausschließlich aufgrund von Überzeugung, sondern auch von einer guten Portion Pragmatismus hatte leiten lassen. Der aus dem Westen importierte SPD-Wahlkampfmanager Rudi Arndt formulierte nach der Wahl zugespitzt: „Es hat doch Wahlreden der Union gegeben, die klipp und klar gesagt haben: Wenn ihr SPD wählt, gibt’s kein Geld.“ Eine Einschätzung, die bis hin zum Bundespräsidenten (und Christdemokraten) Richard von Weizsäcker geteilt wurde: Die DDR-Bürger hätten jene gewählt, die sie in Bonn an den Hebeln sehen; wären andere an den Hebeln, wären die gewählt worden, lautete Weizsäckers treffende Interpretation des Wahlergebnisses. Die Ostdeutschen wollten mehrheitlich die politische und wirtschaftliche Einheit lieber heute als morgen, ein christdemokratischer DDR-Regierungschef als Verhandlungspartner des Bundeskanzlers schien auf dem Weg dorthin die klügere Wahl zu sein. „Nun können Kohl und Waigel im wesentlichen die Kriterien für eine Vereinigung Deutschlands bestimmen. Aber natürlich nicht allein; die neue Ostberliner Regierung muß ihrerseits die Voraussetzung schaffen – ein gemischtes Doppel mit einem SPD-Ministerpräsidenten in der DDR an der Spitze, zudem im hiesigen Bundestagswahlkampf, hätte den Prozeß der Vereinigung zumindest verkompliziert“, zeichnete der Journalist Manfred Schell in der Welt einen Gedankengang nach, der für viele DDR-Bürger ausschlaggebend für ihre Wahlentscheidung gewesen sein dürfte.[57]
Nicht zuletzt hatte die Wahlkampfmaschine der West-CDU, Helmut Kohl an der Spitze, einmal mehr in der Geschichte der Bonner Republik nahezu perfekt funktioniert. Die ideologischen Zuspitzungen („Freiheit statt Sozialismus“), die in den Jahrzehnten des Kalten Krieges schon in Westdeutschland viele Anhänger und meistens auch Mehrheiten gefunden hatten, fielen in der noch-DDR auf einen fruchtbaren Boden. Tausende von Flugblättern, die im Konrad-Adenauer-Haus für die ostdeutschen Wahlkämpfer hergestellt wurden, sollten dem ostdeutschen Wähler vor allem suggerieren, daß zwischen der SED-PDS und der Sozialdemokratie – wenn überhaupt – nur marginale Unterschiede bestünden. Die CDU-Wahlkampfstrategen setzten mit Erfolg darauf, daß der Begriff Sozialismus nach vierzig Jahren Zwangsherrschaft hochgradig diskreditiert war und die West-SPD – unabhängig von ihrem klaren Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft im Godesberger Programm 1959 – den Sozialismus-Begriff schließlich in der politischen Rhetorik auch noch nicht gänzlich abgelegt hatte. Mit Vergnügen griffen die Manager im Adenauer-Haus in die ideologische Mottenkiste: „STOP PDSPDSEDSPDPDS“, „Mit Böhme in den Abgrund“, „Sozialismus? Nein Danke!“ lauteten die Slogans. Die SPD habe „mit der sozialen Marktwirtschaft nichts im Sinn“ und träume „gemeinsam mit der SED vom demokratischen Sozialismus“, hieß es in Argumentationspapieren der CDU für den DDR-Wahlkampf. Die ostdeutschen Wahlkämpfer lernten schnell: Lothar de Maizière, immerhin Vorsitzender der langjährigen Blockpartei DDR-CDU, schreckte nicht davor zurück, der Ost-SPD „einen ganz erheblichen Teil Verantwortung für die vergangenen 40 Jahre“ zuzuweisen, weil die Sozialdemokraten 1946 „freiwillig in die SED eingetreten“ seien. Eine Geschichtsfälschung, die von Bundestagspräsidentin und Parteifreundin Rita Süssmuth als „Legendenbildung“ bezeichnet wurde, nachdem auch prominente Westpolitiker der Union ähnlich wie de Maizière argumentiert hatten.[58]
Erfolgreich konstruierten die Christdemokraten Freund-Feind-Lager: Auf der einen Seite PDS und SPD, sogar letztere unter Sozialismus-Verdacht, auf der anderen Seite Einheitskanzler Helmut Kohl in einem Meer von schwarz-rot-goldenen Fahnen und Wahlkampfbroschüren. Daß die aufwendige Inszenierung seiner Auftritte im Einheitswahlkampf teilweise aus Mitteln illegaler Parteienfinanzierung, die Kohl zehn Jahre später beinahe um seine Reputation bringen würde, bezahlt wurde, ist aus heutiger Perspektive wahrscheinlich. Im Zuge des CDU-Parteispendenskandals 1999/2000 hat Kohl u.a. in einem Focus -Interview eingeräumt, daß er und die Union auch im Zeitraum 1989-1992 zirka 9,4 Millionen Mark an Parteispenden erhalten hätten, die nicht in den Rechenschaftsberichten der CDU aufgeführt wurden und damit einen Verstoß gegen die Parteienfinanzierungsgesetzgebung darstellten: „Ich will gar nicht ausschließen, daß damals auch Barspenden eingegangen sind. Soweit es mich betrifft, erinnere ich mich aber daran, daß im Superwahlkampf 1990 – ich habe damals in über 50 Kundgebungen vor mehr als zwei Millionen Menschen bei der ersten freien Wahl in der DDR, der Bundestagswahl und neun Landtagswahlen gesprochen – uns auch Barspenden zur Unterstützung des Wahlkampfs der CDU gegeben wurden. In diesem Wahljahr gab es eine breite Unterstützung der Bevölkerung mit dem Ziel, daß ich und die Union die Wahl gewinnen“, erinnerte sich der Einheitskanzler zehn Jahre später.[59]
Kurz zuvor, im Februar 2000, die CDU-Spendenaffäre hatte durch immer neue Veröffentlichungen über das Finanzgebaren der Union (jetzt häufig als wesentlicher Bestandteil des Machtsystems Helmut Kohl thematisiert) ihren Höhepunkt erreicht, greift auch das SPD-Parteimagazin Vorwärts die illegale Wahlkampffinanzierung im Einheitswahlkampf auf und stellte damit auch die Rechtmäßigkeit der Unions-Wahlsiege im Jahr 1990 in Frage:
„... Woher kamen die satten Millionen für den Einheitswahlkampf 1990? ... Aufmerksame Beobachter der Demonstrationen in der damaligen DDR vor und nach dem Fall der Mauer und des Wahlkampfes zu den ersten freien Wahlen zur Volkskammer am 18.3.1990 haben sich damals gewundert, woher das viele Geld plötzlich kam. Woher kamen die schwarz-rot-goldenen Fahnen? Und die Aufkleber, Plakate und Sticker mit ‚Wir sind ein Volk’? ... Und woher kam das Geld für die vielen teuren Plakate mit ‚STOP PDSPDSPD ...’ für die ersten freien Wahlen 1990? Dennoch kommt kaum jemand auf die Idee, daß die Wahlsiege im Osten Kohls schwarzem Geld zu verdanken sein könnten. Kohl hat selbst den Weg gewiesen, als er ... sagte, man habe das Geld wegen der PDS gebraucht: ‚Wir standen gegenüber der PDS, die ungeheures Geld hatte.’ Das ist zum Teil wiederum eine Lüge, weil Kohl ... mit der üblichen üblen Vermischung von SPD mit SED und PDS die SPD und nicht die PDS bekämpft hat. Wer hat die Fahnen für die Demo in Leipzig bezahlt? Ist es richtig, daß sie zum Teil in Bonn genäht wurden? Woher kam das Geld für den CDU-Wahlkampf im März 1990 in den neuen Bundesländern? Hat der Demokratische Aufbruch, haben Funktionäre des Aufbruchs wie der frühere Stasi-IM Wolfgang Schnur ... Geld für den Wahlkampf bekommen? Wurde das Aufbrechen der Bürgerrechtsbewegung und ihre teilweise und überraschende Vereinnahmung durch Kohl finanziell unterstützt? ...“[60]
Wenn man in Rechnung stellt, welche suggestiven Wirkungen bei einem modernen und dementsprechend finanziell aufwendig geführten Wahlkampf bei den potentiellen Wählern vor Ort und an den Fernsehbildschirmen ausgelöst werden können, ist der Vorwurf, es habe sich beim Einheitswahlkampf 1990 um eine Auseinandersetzung mit ungleichen Wahlkampfmitteln gehandelt, sicherlich nicht abwegig. Die Frage, ob ohne die illegale Wahlkampffinanzierung das Ergebnis der Volkskammer-, Landtags- und Bundestagswahlen ein anderes gewesen wäre, muß allerdings hypothetisch bleiben. Die Geschichte der deutschen Einheit, bei der die Wahlergebnisse 1990 ein wichtiges Kapitel darstellen, nun allerdings primär vor dem Hintergrund illegaler Wahlkampffinanzierung darzustellen, scheint doch eher eine historisch verzerrende Herangehensweise zu sein. Viel mehr spricht dafür, daß es in erster Linie die deutschlandpolitischen Positionen der politischen Akteure gewesen sind, die bei den Wahlentscheidungen im Einheitsjahr eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten, daß die in Westdeutschland regierende CDU nicht nur über die Haushaltsgelder im Bonner Etat verfügte und somit den Wählern in der DDR suggerieren konnte, daß es massive Wirtschaftshilfe für ihren marodierenden Staat eben nur bei Wahlsiegen der Union geben würde, die Partei Helmut Kohls verfügte wohl auch im Wahlkampf über größere finanzielle Mittel als die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Lafontaine.[61]
Zurück in den März 1990: Die Sozialdemokraten hatten mit einer Niederlage bei den Volkskammerwahlen nicht gerechnet, schon gar nicht in dieser Höhe. Ibrahim Böhme, bis dato Hoffnungsträger der Ost-SPD und aussichtsreicher Kandidat für das Amt des DDR-Ministerpräsidenten, zog noch am Abend des 18. März Konsequenzen. Der Vorsitzende der DDR-Sozialdemokraten kündigte an, einer großen Koalition unter de Maizière nicht als Minister angehören zu wollen. Seiner Partei riet er aber gleichwohl zu einem Bündnis mit den konservativen Wahlsiegern. Die Wahlkämpfer in Deutschland-West waren nicht weniger konsterniert. Die Hoffnung der Sozialdemokraten, mit Lafontaine als „kühlen Kalkulator der Kosten des geschichtlichen Ereignisse“ und Willy Brandt „als Symbolträger für die Einheit“ (Der Spiegel) ein möglichst großes Wählerspektrum beim entscheidenden Thema Deutschlandpolitik abzudecken, sie hatte sich in der DDR nicht erfüllt.[62]
Ein nüchternes Fazit zum Ausgang der Volkskammerwahlen zog Willy Brandt, der sich selber im ostdeutschen Wahlkampf engagiert hatte:
„Der Erfolg der CDU bzw. der ‚Allianz’ beruht in erster Linie darauf, daß sie als diejenige Gruppierung erschien, von der – stellvertretend für die Regierungsspitze in Bonn – umgehend die staatliche Einheit und noch im Verlauf eine wirtschaftliche Belebung mit Angleichung des Lebensstandards zu erwarten sei. Daß damit manche Probleme erst beginnen und zumal Fragen nach der sozialen Sicherung offenbleiben, blieb weitgehend unbeantwortet und wurde auch nicht für so wichtig gehalten. Die CDU verfügte, anders als die SPD, über einen funktionierenden Parteiapparat ... Die generalstabsmäßig eingesetzten Parteiapparate in Bonn, München, Wiesbaden und anderswo traten mit ihren Propagandamitteln, Kampagnentrupps etc. massiv hinzu und ließen eine Situation entstehen, als stünden Steckenpferde gegen motorisierte Verbände. Zum wahlentscheidenden Argument wurde, daß das Geld aus Bonn nur fließen werde, wenn sich die Wähler Bonn-konform verhielten. Hinzu kam die hundsföttisch geschichtsklittende ... Gleichsetzung von freiheitlicher Sozialdemokratie und totalitärem Kommunismus ... Die SPD (DDR) hat angesichts der Tatsache, daß sie erst im Herbst ’89 mit einer kleinen Gruppe auf der Bildfläche erschien, Erstaunliches geleistet ... Die Unterstützung durch lokale und regionale Gliederungen der bundesdeutschen SPD war beachtlich und bleibt lobenswert ... Unterschiedliche Auffassungen zur staatlichen Einheit ließen sich nicht im Handumdrehen auf einen Nenner bringen. Mein Bemühen, verschiedene Aspekte des historischen Vorgangs als einander ergänzend zu verstehen, erwies sich als nicht ausreichend erfolgreich ...“[63]
Ob etwa „Kohl wegen der Kohle“ gewählt worden sei, wurde der Bundeskanzler nach der Volkskammerwahl in einem Welt -Interview gefragt. Seine Interpretation des Wahlergebnisses liest sich etwas anders als die Analysen von Willy Brandt oder Richard von Weizsäcker. Helmut Kohl nutzt statt dessen die Gelegenheit für eine generelle Abrechnung mit der Sozialdemokratie und ihrem Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine:
„Ich finde, das gehört zu den perfidesten und absurdesten Parolen, die wir in den letzten Wochen gehört haben ... Man braucht sich einen Teil dieser kommentierenden Gestalten doch nur anzusehen, wie sie im Wohlstand der Bundesrepublik leben, vielleicht in einer besonders schönen Gegend Europas auch noch einen sonstigen gepflegten Aufenthaltsort haben und jetzt den Leuten in der DDR sagen, es dürfe ihnen nicht um den Wohlstand gehen. Ich weiß, was die Leute in meiner Heimatstadt Ludwigshafen in dem dort ansässigen Großunternehmen der chemischen Industrie verdienen. Sie verdienen es im wahrsten Sinne des Wortes ... Aber es ist nicht ihr Verdienst, daß sie in diesem Teil Deutschlands leben. Andere, die früher einmal in Ludwigshafen waren, sind vielleicht durch die Kriegsverhältnisse in die heutige DDR – zum Beispiel nach Leuna – verschlagen worden. Deren Kinder arbeiten jetzt dort. Warum sollen diese Leute denn nicht auch den Wunsch haben dürfen, in den Ferien einmal nach Paris oder nach Rom zu fahren ... Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn auch bei einer gesamtdeutschen Wahl die Leute in der DDR sagen, wenn man die CDU und den Kohl wählt, dann wählt man den Wohlstand. Wohlstand für alle, das war ein hervorragendes Motto von Ludwig Erhard. Ich dachte oft in letzter Zeit, welch eine Genugtuung wäre es für Ludwig Erhard, wenn er heute miterleben dürfte, wie seine Idee sich jetzt weltweit durchsetzt. Das ist doch eine großartige Sache. Wir machen eine Politik für Freiheit, für Frieden, für soziale Gerechtigkeit und Wohlstand, und unsere politischen Gegner sollen ruhig die Neidkomplexe pflegen. So sieht doch die Arbeitsteilung bei uns aus. Und ich habe nichts dagegen, daß wir die Stimmen bekommen und die anderen die Wahlen verlieren.“[64]
Für den damaligen Innenminister Schäuble haben die Sozialdemokraten 1990 auf eine falsche Strategie gesetzt und sich mit Lafontaine – mit Blick auf die Wähler in Ostdeutschland – für den falschen Kanzlerkandidaten entschieden:
„Die Sozialdemokraten haben meines Erachtens in diesem Wahlkampf wie im ganzen Jahr 1990, dem Jahr der deutschen Einheit, nicht begriffen, daß die Deutschen in ihrer großen Mehrheit die Einheit wollten. Die Bürger in Mitteldeutschland wollten bei allen kritischen Fragestellungen natürlich viel lieber so leben wie wir im Westen. Deshalb mußte bei der Bevölkerung der DDR derjenige gewinnen, der Einheit, Freiheit, soziale Marktwirtschaft und solidarische Hilfe glaubwürdig vertrat. Ich hatte deshalb nach der Öffnung der Mauer vermutet, daß die SPD ihre sich abzeichnende Entscheidung für den Kanzler-Kandidaten Oskar Lafontaine noch einmal korrigieren würde, weil ich mir zu keinem Zeitpunkt vorstellen konnte, daß Lafontaine in einem solchen Jahr ein erfolgversprechender Kanzler-Kandidat war ... Das Wahlergebnis belegte zunächst, daß die Union, entgegen vielen Legenden seit der Adenauer-Zeit, auch in der DDR unter günstigen Vorzeichen wie in der Bundesrepublik in die Größenordnung von bis zu fünfzig Prozent der Wählerstimmen vordringen konnte. Es belegte zum zweiten, daß die Sozialdemokraten unter Oskar Lafontaine keine für die Menschen in der DDR nachvollziehbare Konzeption für die Problem der Menschen und das Anliegen der deutschen Einheit hatten; sie mußten bei dem Versuch, Ängste und Neid ... für sich zu nutzen, die Stimmen mit der SED-Nachfolgerin PDS teilen. Und drittens zeigte das Wahlergebnis, daß die Wähler der ‚Allianz für Deutschland’ im wesentlichen die CDU nach westdeutschem Vorbild und den Bundeskanzler Helmut Kohl wollten ...“[65]
Lafontaine zog aus der Niederlage bei der Volkskammerwahl nicht den Schluß, seine deutschlandpolitischen Positionen zu überdenken. Kohl sitze nach seinem Erfolg jetzt „in der Falle“, weil er seine Wahlkampfversprechen nun einlösen müsse, redete sich Lafontaine ein. Seine Überzeugung: „Wer in der DDR die erste Wahl gewinnt, der muß sich sehr anstrengen, wenn er die zweite nicht verlieren will.“ Schließlich gingen die meisten Sachverständigen nicht davon aus, daß die schnelle Einheit ohne soziale Härten im Osten und zusätzliche Steuerbelastungen im Westen realisierbar sei. Lothar de Maizière, der designierte DDR-Ministerpräsident, war sich der Ausgangslage bewußt: Noch in der Wahlnacht forderte er neben der Wirtschafts- zusätzlich auch eine Sozialunion zwischen BRD und DDR und plädierte dafür, die Ost-SPD angemessen in die Regierungsverantwortung einzubeziehen. Nur so ließe sich verhindern, daß Lafontaine im Bundestagswahlkampf mit den sozialen Ängsten der Westdeutschen Stimmung mache. „Dann kriegt Kohl Dresche von der West-SPD, weil er angeblich den ganzen Reichtum der Bundesrepublik verschenkt. Und Lafontaine kann seine Nummer weiterspielen.“[66]
Andere sahen eher den sozialdemokratischen Herausforderer in der Defensive: „Das innenpolitische Tableau hat sich verändert, standen die Bewerber Kohl und Lafontaine bisher bestenfalls gleich, so hat Kohl die SPD, die wieder einmal zerstritten war, plattgewalzt. Er bewies aufs neue seinen Machtinstinkt, er vertrat die richtige Sache. Um den Artikel 23 des Grundgesetzes wird man nun schwerlich herumkommen“, urteilte Rudolf Augstein. Der Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes wurde in diesen Tagen nicht nur von der Mehrheit der Ostdeutschen als der unkomplizierteste Weg zur staatlichen Einheit betrachtet, auch in der Bundesrepublik mehrten sich die Stimmen, die den Artikel 23 für den besten und schnellsten Weg zur Einheit hielten. Robert Leicht schrieb in der Zeit: „Im Grunde ist die Lage einfacher, als sie sich manchem darstellt. Entweder würde eine neue Verfassung das Grundgesetz kopieren – dann lohnte sich der Aufwand nicht ..., oder aber die neue Verfassung bliebe hinter dem Grundgesetz zurück – dann hätten zumindest die Westdeutschen sich zu fragen, ob ihnen eigentlich die Einheit mehr wert ist als ihre freiheitlich optimierte Verfassung. Schließlich sind wir Verfassungspatrioten und nicht bloße Nationalpatrioten“, so seine Argumentation.[67]
Oskar Lafontaine ließ sich durch das SPD-Debakel bei den Volkskammerwahlen nicht von seiner Strategie abbringen: Der Kandidat wollte im Bundestagswahlkampf auf soziale Themen setzen und keinesfalls auf der nationalen Welle schwimmen, von der Amtsinhaber Helmut Kohl wieder hochgespült worden war. Lafontaines Optimismus schien ungebrochen. In der ersten Vorstandssitzung nach der verlorenen Wahl in Ostdeutschland verkündete der Saarländer: „Wir haben gute Chancen, nicht nur die nächsten Landtagswahlen zu gewinnen, sondern auch die Bundestagswahl – gerade jetzt.“ Oskar Lafontaine mußte von seinen Präsidiumskollegen, anders als manche erwartet hatten, nicht erst zur Kandidatur überredet werden, demonstrierte unbeirrt Selbstbewußtsein und gewann der SPD-Blamage in der DDR sogar positive Seiten ab: Wäre ein sozialdemokratischer Ministerpräsident nicht von der Gunst Helmut Kohls abhängig gewesen, hätte er nicht nach Belieben entweder von den Geldgebern in Bonn als Bittsteller degradiert der als Kronzeuge gegen Lafontaines deutschlandpolitische Positionen instrumentalisiert werden können?[68]
Nach dem Sieg der Konservativen bei der Volkskammerwahl waren nun in beiden Teilen Deutschlands Christdemokraten für die Gestaltung des Einigungsprozesses verantwortlich. Und Lafontaine setzte darauf, daß die Einheit mit weitaus mehr ökonomischen Problemen verbunden sein würde, als Kohl dies im Wahlkampf vorausgesagt hatte. Der Kanzler sitze „in der Falle“, sei gefangen von gesamtdeutschen Wahlversprechen: schnelle Währungsunion mit dem Umtauschkurs 1:1, keine Kürzung der Sozialleistungen und ebenso wenig eine Erhöhung der Steuern zur Finanzierung der deutschen Einheit. Der SPD-Kandidat war sich sicher, daß die Wähler noch vor der Bundestagswahl die Versprechungen und Prognosen des Bundeskanzlers als Wahllügen erkannt haben würden. „Die Wahlen in der Bundesrepublik werden nicht deutsch-national entschieden, sondern nach der Idee der sozialen Gerechtigkeit. Ich bleibe unerschütterlich bei dieser Auffassung und werde spätestens im Herbst recht bekommen. Dann schlage ich zurück, weil der Kohl die Leute belogen und betrogen hat“, hoffte Lafontaine.[69]
Wenngleich der saarländische Ministerpräsidentin in der Vorstandssitzung vom 19. März 1990 mit 30:0-Stimmen als Kanzlerkandidat vorgeschlagen wurde und am 27. März auch vom Parteirat nominiert wurde, konfrontierten ihn prominente Spitzengenossen bereits mit Kritik an seinem deutschlandpolitischen Kurs: Willy Brandt, lange Vorbild Lafontaines, vertrat die Auffassung, dieser habe zu wenig dem Gefühlsbedarf nach der Einheit Rechnung getragen und zu stark die sozialen Folgen der Vereinigung betont. Ähnlich argumentierte der ehemalige Hamburger Bürgermeister Klaus von Dohnanyi. Selbst Erhard Eppler, eigentlich von den Wahlkampfthemen soziale Gerechtigkeit und Ökologie überzeugt, rügte Lafontaines deutschlandpolitischen Kurs: „Bisher verbinden die Menschen mit Oskar allenfalls ihre gesamtdeutschen Befürchtungen, sie verbinden mit ihm nicht ihre gesamtdeutschen Hoffnungen.“[70]
Tatsächlich hatte Lafontaine für die nationalen Emotionen kein Verständnis. Mehrfach hatte er deutlich werden lassen, daß es ihm in erster Linie um einheitliche Lebensverhältnisse in Ost und West gehe, weniger um die staatliche Einheit. Der oft zitierte Satz, er wolle, daß es den Menschen am Ende „so gut geht wie mir und meinen Freunden in Wien und anderswo“, mußte den Eindruck verstärken, er wolle an der Zweistaatlichkeit festhalten. Ähnliches suggerierten seine Positionen zum Übersiedlerstrom. Dieser müsse gestoppt werden, wenn es nicht in der BRD zu schweren sozialen Verwerfungen und in der DDR zum Zusammenbruch der Produktion kommen solle. Daß die Bundesregierung, die den Saarländer für dessen Thesen zunächst heftig attackiert hatte, direkt nach der Volkskammerwahl beschloß, die Notaufnahmeverfahren zum 1. Juli auslaufen zu lassen und jeden DDR-Übersiedler einem westdeutschen Arbeitslosen gleichzustellen, der aus freien Stücken seine Beschäftigung aufgegeben hatte, mußte Lafontaine in seiner Annahme bestärken, den richtigen Kurs eingeschlagen zu haben.[71]
Bereits im Vorfeld der Volkskammerwahlen hatte sich in der Union langsam die Haltung durchgesetzt, das Aufnahmeverfahren für DDR-Übersiedler einzustellen. Diese Position, von der kommunalpolitischen Basis ausgehend, wurde insbesondere von zwei Landesverbänden vertreten, die im Laufe des Jahres Landtagswahlen zu bestehen hatten: Während Norbert Blüms CDU in NRW, wo – wie in Niedersachsen – im Mai der Landtag gewählt wurde, sich für die Beibehaltung aussprach, wurde die Abschaffung von der bayrischen CSU und der niedersächsischen CDU vehement gefordert. Vor allem der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht mußte um seine Wiederwahl bangen und führte die wenig berauschenden Umfragewerte nicht zuletzt auf die Politik der Bundesregierung in der Übersiedlerproblematik zurück. Die Bewältigung des Übersiedlerstroms sollte sich angesichts dessen zu einem Thema entwickeln, das, im Gegensatz zu fast allen anderen Aspekten der Deutschlandpolitik Helmut Kohls, in der westdeutschen CDU wirklich kontrovers diskutiert wurde. Wolfgang Schäuble, als Innenminister in dieser Frage zuständig und ein Befürworter der Beibehaltung des Aufnahmeverfahren, beschreibt die Problemlage, mit der sich der Bundeskanzler konfrontiert sah, folgendermaßen:
„In nicht unerhebliche Schwierigkeiten brachte die Auseinandersetzung den Bundeskanzler ... Am Anfang eines ungewöhnlich schwierigen Wahljahres voller Unwägbarkeiten mußte er in einer zentralen Frage der politischen Auseinandersetzung eine von nicht einmal zwanzig Prozent der Bevölkerung geteilte Position gegen den sozialdemokratischen Herausforderer halten. Zugleich wußte er, daß die große Mehrheit auch der eigenen Partei bis in die Reihen des Präsidiums die von der Regierung vertretene Position nicht teilte. Das erfordert von einem Parteivorsitzenden und Regierungschef schon ungewöhnlich viel Überzeugung in der Sache und zugleich Zuversicht, die politischen Schwierigkeiten auch überwinden zu können.“[72]
Bis zu den Volkskammerwahlen hielt Helmut Kohl gegen die Widerstände in Bevölkerung und eigener Partei an der Beibehaltung des bisherigen Aufnahmeverfahrens fest. Der Kanzler rückblickend:
„Lafontaine hatte im Saarland mit Hilfe seiner Angstkampagne die meisten Republikaner-Sympathisanten für sich eingenommen und nicht zuletzt deshalb die saarländischen Landtagswahlen gewonnen. Aber auch in meiner eigenen Partei wuchs die Sorge vor den Folgen des Übersiedlerstroms und mehrten sich die ängstlichen Fragen: Wie lange die Solidarität der Bürger mit den Übersiedlern bei zunehmender Belastung noch halten werde? Ob denn die Unterbringung überhaupt noch gewährleistet werden könne, wenn die Menschen weiterhin aus der DDR zu uns kämen? Ob aus der nationalen jetzt eine soziale Frage werde? Es war schon eigenartig, daß nun, da das Tor offenstand, so viele offenbar Angst bekamen. Im CDU-Bundesvorstand erklärte ich daher: Wenn wir zuließen, daß unser Land in dieser Schicksalsstunde aus finanziellen Gründen vor der Einheit zurückweiche, dann habe die Bundesrepublik vor der Geschichte abgedankt.“[73]
Auch wenn Wolfgang Schäuble später die Behauptung aufrecht erhalten sollte, der Beschluß über die Abschaffung des Notaufnahmeverfahrens zwei Tage nach der Volkskammerwahl am 18. März stehe nicht in Zusammenhang mit dem Wahltermin in Ostdeutschland, liegt die Vermutung nahe, daß besagtes Thema in der Unionsspitze vor allem auch unter Berücksichtigung der diversen Wahltermine diskutiert wurde: Bis zu den Volkskammerwahlen hielt Kohl am Aufnahmeverfahren fest, um die Wählerschaft in der DDR nicht zu brüskieren. Nach dem Sieg der von ihm geschmiedeten Allianz für Deutschland richtete sich der Blick auf die im Mai anstehenden Landtagswahlen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sowie auf den Wahlkampf, den die bayrische CSU zu führen hatte. Kohl mußte den Landesverbänden entgegenkommen, durfte jedoch gleichzeitig nicht außer acht lassen, daß der anhaltende Übersiedlerstrom und der in diesem Zusammenhang zu erwartende Kollaps der DDR ein gewichtiges Argument für die schnelle Vollendung der staatlichen Einheit darstellte, das die Bundesregierung im Rahmen der beginnenden Zwei-plus-Vier-Gespräche einzubringen gedachte, um den Weg zur Einheit außenpolitisch abzusichern. Hinsichtlich dieser Kausalität waren sich Schäuble und Außenminister Genscher, dessen FDP die bisherige Haltung des Innenministers zur Übersiedlerfrage unterstützte, einig. Schäuble machte einen Kompromißvorschlag, der in der Regierungskoalition und im CDU-Präsidium mehrheitsfähig war und innen- wie außenpolitische Zusammenhänge berücksichtigte:
„Ich hatte vorgeschlagen, die baldmögliche Schaffung einer Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion anzukündigen und für den Zeitpunkt dieser Einführung dann die Abschaffung des Aufnahmeverfahrens. Auch der Bundeskanzler trat für die Festlegung eines konkreten Termins ein. Daraufhin schlug ich vor, ein Datum zu nennen, das zugleich die Einführung der Währungsunion und die Abschaffung des Aufnahmeverfahrens bedeutete. Zu meiner Überraschung war das die Lösung. Die Bonner Koalition verständigte sich zwei Tage nach der Volkskammerwahl auf einen ‚Fahrplan zur deutschen Einheit’. Am 1. Juli sollte die Wirtschafts- und Währungsunion eingeführt werden ... An diesem Tag sollten die Notaufnahmelager für DDR-Übersiedler ... geschlossen und die wenigen noch verbleibenden Sonderhilfen gestrichen werden. Das war eine mutige Entscheidung, weil man herkömmlicherweise Währungsreformen nicht mehr als drei Monate vorher verbindlich ankündigt und weil im übrigen zu jenem Zeitpunkt in der Führung der Koalition noch nicht die gemeinsame Erwartung bestand, daß es schon 1990 gelingen würde, die staatliche Einheit zu vollenden. Daß eine Wirtschafts- und Währungsunion ohne alsbald folgende staatliche Einheit ein schwer zu übersehendes Risiko war, muß auf der anderen Seite den Beteiligten klar gewesen sein. Jedenfalls hatte Helmut Kohl im Koalitionsgespräch einen Weg gefunden, den Frieden in den eigenen Reihen wieder herzustellen. Ernst Albrecht und Wolfgang Bötsch konnten endlich auf einen Termin für die Abschaffung des Aufnahmeverfahrens verweisen ... Zugleich hatten wir Wort gehalten, daß wir nicht über eine Beseitigung des Aufnahmeverfahrens irgendwelche ... Barrieren für die Freizügigkeit der Menschen in der DDR aufbauen würden ...“[74]
6. Medienurteile und Demoskopie im Einheitswahlkampf I
Der Wahlsieg Oskar Lafontaines bei den Landtagswahlen im Saarland ließ Medien und Bevölkerung nicht unbeeindruckt. Selbst die konservative FAZ schrieb in der Ausgabe vom 30. Januar 1990 vom „intelligenten”, „wirkungsvollen” und „populären” Ministerpräsidenten und attestierte dem Kandidaten, ein „hochbegabter Redner” zu sein. Vier Wochen nach dem Urnengang im Stammland Lafontaines würdigt die Frankfurter Allgemeine den Saarländer als „Internationalisten”, der einen „grandiosen Wahlsieg” errungen habe. Die eher linksliberale Presse neigte bereits im Vorfeld der Wahl zu überschwenglich positiven Urteilen: Der Spiegel ließ den Kandidaten als „Oskar Lafontaine Superstar” hochleben. Für das Nachrichtenmagazin, bekannt für seine ausgeprägte Geringschätzung für Helmut Kohl, war der Herausforderer des Kanzlers ein „eloquenter, gescheiter und bissiger Volkstribun”, der seine „Geschäfte in der Staatskanzlei mit links” erledige und als „Bonvivant” und „Feinschmecker” auch den schönen Künsten zugeneigt sei. Gleichzeitig, so wurde in derselben Ausgabe vom 22. Januar geschrieben, sei Lafontaine aber auch ein „Kämpfer unter Kumpeln geblieben”. Als saarländischer Regierungschef habe Lafontaine „alles unter Kontrolle“, seine „souveräne Machtposition“ habe er sich „in den ersten Regierungsjahren mit Fleiß erarbeitet“. Jetzt sei er „der Dompteur, der den Zirkus zu Höchstleistungen antreibt“. Die zu diesem Zeitpunkt äußerst positive Berichterstattung im Spiegel deckte sich in etwa mit den Urteilen der Frankfurter Rundschau, die dem „überragenden Gewinner” der Saarland-Wahl am 30. Januar attestierte, als „bodenständiger” und „populärer” Ministerpräsident gut gerüstet in das Wahljahr 1990 zu gehen.[75]
Lediglich die Welt greift den sozialdemokratischen Hoffnungsträger schon zu diesem frühen Zeitpunkt scharf an und charakterisiert Lafontaine als einen „Populisten”, der „viel mehr als andere polarisiert”. Ähnlich „unwirsche Reaktionen” wie die ihm zugeneigte Welt soll nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung vom 30. Januar auch Helmut Kohl nach Lafontaines Triumph im Saarland an den Tag gelegt haben. Ansonsten gab es im Kontext der Landtagswahl verhältnismäßig wenige Urteile über den amtierenden Kanzler. Über Helmut Kohl wurde statt dessen in außenpolitischen Zusammenhängen geurteilt, und zwar im ersten Quartal des Jahres zunächst vornehmlich negativ. Insbesondere das zwischenzeitlich getrübte Verhältnis zu Polen nahmen verschiedene Zeitungen zum Anlaß, den Kanzler zu kritisieren. Vor allem die USA-Reise Kohls Anfang März, bei der er gegenüber Präsident George Bush die Anerkennung der polnischen Westgrenze offen ließ und einer späteren gesamtdeutschen Regierung eine diesbezügliche Entscheidung vorbehalten wollte, stieß auf heftige Kritik. Als Kohl seinen Standpunkt auch bei einer Sitzung des Außenministerrates in Brüssel bekräftigte, kommentierte der Spiegel in seiner Ausgabe vom 12. März 1990: Kohl habe „durch seine wechsel- und tölpelhaften Erklärungen zur Oder-Neiße-Grenze und seine nationalen Alleingänge das latente Mißtrauen gegen die Deutschen im europäischen Ausland erst richtig angefacht”. „Er kann es wirklich nicht“, kommentierte Spiegel -Herausgeber Rudolf Augstein, dem Kanzler sei gelungen, „alle Welt gegen sich aufzubringen, indem er in Sachen Oder-Neiße-Grenze das deutsche Wesen und den deutschen Tolpatsch hervorkehrte“. Nun werde, so Augsteins damalige Einschätzung, Kohl wieder als außenpolitischer Trümpel herumgereicht. Ein Urteil, das von der Süddeutschen Zeitung geteilt wurde. In Kommentaren vom 1.3. bzw. 6.3. wurde dem Kanzler vorgeworfen, er habe den starken Mann spielen wollen, einen „außenpolitischen Scherbenhaufen” verursacht und sei durch seine ausweichende Haltung zur deutschen Ostgrenze in die „außenpolitische Isolation” geraten. Die rechtskonservative Welt brachte hingegen Verständnis für die Außenpolitik des Kanzlers auf: „Innenpolitischer Sinn für rechtsextreme Wähler” wurde ihm attestiert. Entsprechend wenig Gegenliebe brachte die Zeitung für die Empörung in linksliberaler Presse und Öffentlichkeit auf, die in der Welt als ungerechtfertigt deklariert wurde. Diese redaktionelle Linie entsprach der Berichterstattung über Helmut Kohl während des gesamten Wahljahres. Schon im Januar hatte man sich in der Springer-Zeitung mit überschwenglichen Urteilen über Kohls Politik kaum zurückgehalten: Er sei „eine international gefragte, befragte und beobachtete Figur”, „Kanzler, Hauptaußenminister und erster Deutschlandpolitiker, wie Adenauer es war” und für die Ostdeutschen „die Hoffnung schlechthin”, um nur einige der euphorischen Bewertungen zu zitieren.[76]
[...]
[1] Der Spiegel, Nr. 49/1990, S. 6-16.
[2] Siehe: Der Spiegel, Nr. 1-52/1990, diverse Beiträge.
[3] Die M.A.-Arbeit wurde am 31. August 2000 bei der Fakultät für Geschichtswissenschaft der Ruhr-Universität Bochum eingereicht und mit der Note 2,3 bewertet. Die hier veröffentlichte Fassung wurde vom Autor nachträglich marginal gekürzt und mit Blick auf formale Aspekte geringfügig überarbeitet. Darüber hinausgehende Veränderungen am Text oder Ergänzungen wurden nicht vorgenommen. Als eine „Chronologie und Analyse“ des Bundestagswahlkampfs 1990 zeigt die Arbeit in erster Linie die deutschlandpolitischen Positionen der Kanzlerkandidaten auf und beleuchtet darüber hinaus ihre Resonanz und Bewertung in der überregionalen Presseberichterstattung sowie in Meinungsumfragen. Angesichts des vorgegebenen Rahmens wurde in dieser geschichtswissenschaftlichen Magisterarbeit auf eine vertiefte Auseinandersetzung mit medien- bzw. sozialwissenschaftlichen Theorien (etwa hinsichtlich der Wechselwirkungen zwischen massenmedialer Berichterstattung und öffentlicher Meinung) verzichtet
[4] Siehe: Der Spiegel, Nr. 1/1990, S. 21.
[5] Ebenda.
[6] Weidenfeld, 1998, S. 636; siehe auch: Der Spiegel, Nr. 1/1990, S. 23.
[7] Vgl. Schäuble, 1991, S. 262ff.; Zitat: Der Spiegel, Nr. 1/1990, S. 21.
[8] Siehe: Der Spiegel, Nr. 10/1990, S. 20, 23ff.
[9] Ebenda, S. 23ff.
[10] Ebenda, S. 25.
[11] Siehe Korte, 1998b, S. 34; Dönhoff, 1999, S. 291ff.; Augstein, 1996, S. 48-65.
[12] Vgl. Filmer / Schwan, 1985, S. 475ff.
[13] Augstein, 1996, S. 48.
[14] Siehe Knopp, 1999, S. 367-371.
[15] Vgl. Weidenfeld, 1998, S. 9-13; Knopp, 1999, S. 374-380.
[16] Weidenfeld, 1998, S. 10; vgl. auch Kohl, 1996, S. 130; Knopp, 1999, S. 378ff.
[17] Vgl. Knopp, 1999, S. 376-380.
[18] Kohl, 1996, S. 121, 148.
[19] Ebenda, S. 245.
[20] Siehe: Der Spiegel, Nr. 4/1990, S. 16.
[21] Siehe Jäger, 1998, S. 154ff.
[22] Ebenda, S. 159.
[23] Vogel, 1996, S. 46.
[24] Siehe: Der Spiegel, Nr. 4/1990, S. 16.
[25] Vogel, 1996, S. 46.
[26] Vgl. Leinemann, 1999, S. 34ff.
[27] Siehe: Der Spiegel, Nr. 4/1990, S. 17.
[28] Ebenda.
[29] Ebenda.
[30] Schäuble, 1991, S. 22.
[31] Siehe: Der Spiegel, Nr. 4/1990, S. 19.
[32] Siehe Jäger, 1998, S. 159ff.; Der Spiegel, Nr. 4/1990, S. 19.
[33] Vgl. Lafontaine, 1999, S. 17; Der Spiegel, Nr. 6/1990, S. 34ff.
[34] Vogel, 1996, S. 46.
[35] Zitiert nach Knopp, 1999, S. 400.
[36] Ebenda.
[37] Weidenfeld, 1998, S. 639; vgl. auch Knopp, 1999, S. 401.
[38] Kohl, 1996, S. 44; vgl. auch Knopp, 1999, S. 401.
[39] Kohl, 1996, S. 273ff.; siehe auch Knopp, 1999, S. 401; Rowold, 1990, S. 149ff.
[40] Zitiert nach Rowold, 1990, S. 49.
[41] Vgl. Genscher, 1995, S. 722; Rowold, 1990, S. 149.
[42] Genscher, 1995, S. 722.
[43] Vgl. Rowold, 1990, S. 151.
[44] Zitiert nach Knopp, 1999, S. 402; Rowold, 1990, S. 149.
[45] Vgl. Neander, 1990, S. 152; Rowold, 1990, S. 151ff.
[46] Neander, 1990, S. 152.
[47] Siehe Knopp, 1999, S. 404; Der Spiegel, Nr. 6/1990, S. 14-28.
[48] Siehe: Der Spiegel, Nr. 6/1990, S. 23f.
[49] Ebenda, S. 28.
[50] Vgl. Jäger, 19998, S. 162; Der Spiegel, Nr. 9/1990, S. 16.
[51] Der Spiegel, Nr. 9/1990, S. 16ff.
[52] Zitat: Der Spiegel, Nr. 9/1990, S. 17.
[53] Vgl. Jäger, 1998, S. 161ff.; Zitate: Der Spiegel, Nr. 9/1990, S. 18f.
[54] Siehe: Der Spiegel, Nr. 12/1990, S. 20-29.
[55] Schäuble, 1991, S. 39-45.
[56] Siehe: Der Spiegel, Nr. 12/1990, S. 20-25.
[57] Schell, 1990a, S. 182; siehe auch: Der Spiegel, Nr. 12/1990, S. 23.
[58] Siehe: Der Spiegel, Nr. 10/1990, S. 18ff.
[59] Siehe: Focus, Nr. 13/2000, S. 26.
[60] Suplie / Dohrn, 2000, S. 5.
[61] Siehe auch: Der Spiegel, Nr. 12/1990, S. 20-33; Nr. 47/1990, S. 22-35; Nr. 48/1990, S. 32-53.
[62] Der Spiegel, Nr. 12/1990, S. 23.
[63] Brandt, 1990, S. 152f.
[64] Zitiert nach Fritzsche, 1990, S. 189.
[65] Schäuble, 1991, S. 50f.
[66] Siehe: Der Spiegel, Nr. 12/1990, S. 24.
[67] Leicht, 1999, S. 696; Der Spiegel, Nr. 12/1990, S. 22.
[68] Siehe: Der Spiegel, Nr. 13/1990, S. 21.
[69] Ebenda, S. 22.
[70] Vgl. Jäger, 1998, S. 165; siehe auch: Der Spiegel, Nr. 13/1990, S. 22.
[71] Siehe: Der Spiegel, Nr. 13/1990, S. 22.
[72] Schäuble, 1991, S. 73.
[73] Kohl, 1996, S. 261.
[74] Schäuble, 1991, S. 70-77.
[75] Zitiert nach Kindelmann, 1994, S. 120ff.; siehe auch: Der Spiegel, Nr. 4/1990, S. 16-19.
[76] Zitiert nach Kindelmann, 1994, S. 121f.; siehe auch: Der Spiegel, Nr. 11/1990, S. 27.
- Arbeit zitieren
- Christian Chmel (Autor:in), 2000, Die deutschlandpolitischen Positionen von Helmut Kohl und Oskar Lafontaine im Bundestagswahlkampf 1990, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116842
Kostenlos Autor werden
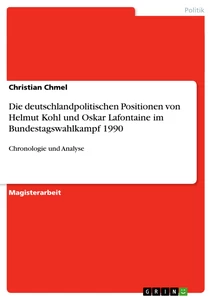




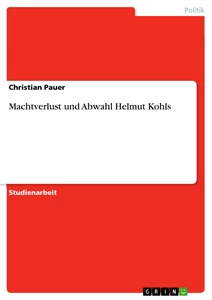














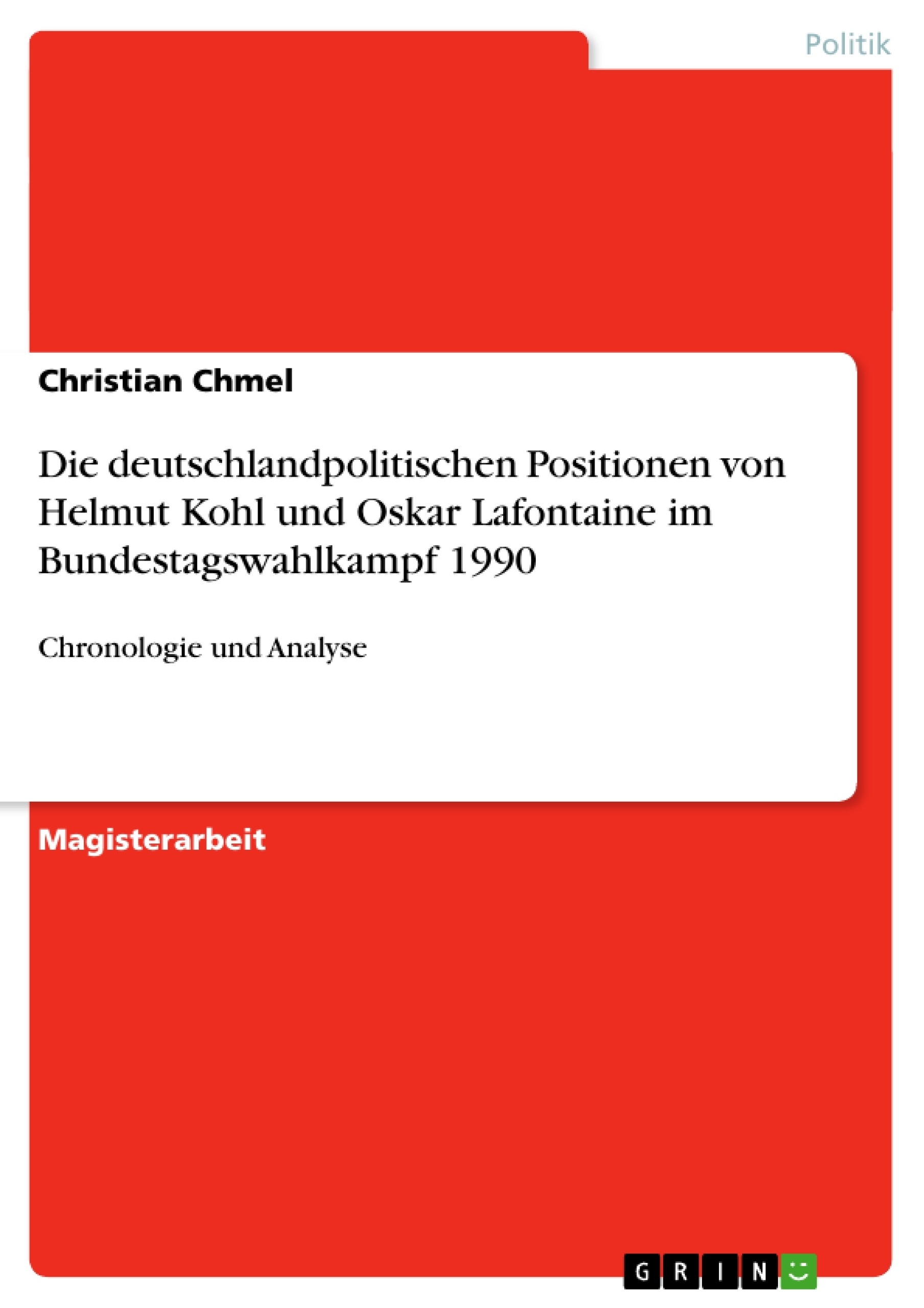

Kommentare