Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kindheit
Jugend, Lehrzeit und Wehrdienst
Bergbau und Seefahrt
Studium und Wissenschaft
Die Übernahme der DDR und die Zeit danach
Reiseeindrücke
Arbeitsbeschaffungsmassnahmen (ABM)
Ausflug in die indische Yoga-Mystik
Umzug nach Schweinfurt
Erneut schwere Zeiten
Geistheiler-Diagnosen
Heiraten in China
Nachwort
Buchpublikationen und Patenthinweise
Vorwort
Von einem Vorwort darf der Leser zu recht erwarten, das er in angenehmer Weise vom Inhalt des Buches einen ersten Eindruck über den Autor gewinnen kann. Eine Auswahl von Begebenheiten und Anschauungen, zusammengefügt wie die Gedanken der Menschen selbst in aller Buntheit und Vielfalt. Neben Abenteuerlichkeit und Spannung steht die gewonnene Weisheit des Erlebten Pate. Eine schicksalsschwere Kindheit, eine entbehrungsreiche Jugend, als Soldat in einem Raketeninstandsetzungswerk, als Bergmann im Uranbergbau der Wismut, als Fischverarbeiter in orkanaufgewühlter See, gefährliche Abenteuer im Dunkel unzugänglicher Höhlen, Fernstudium und Forschungsarbeit, Patententwicklungen, STASI-Überwachung, Ehescheidung, spirituelle Erlebnisse, Tod gesagt, HARTZ 4 bezogen, Heirat in China und unendliches mehr. Wen würde so ein Lebenslauf nicht interessieren? Aber ist es nicht ebenso wertvoll seine Beobachtungen auf die Veränderungen und Geschehnisse unserer bewegten Zeit zu richten? Den fokussierenden Blick Dingen des Lebens zuzuwenden, die uns zu entgleiten drohen. Auf Menschen im Alter. Auf das entfremdende Leben in den Großstädten dieser Welt. Auf verlorene Träume. Meine Biografie schärft den Blick für die Dinge, die es wert sind gesehen zu werden und sollten meinen Lesern Kurzweil und ein möglichst großes Spektrum an gedanklichen Freiräumen und Konformität in der eigenen Anschauung freisetzen. Ich wurde in eine Zeit hineingeboren, die man mit Recht als nicht beneidenswert bezeichnen darf. Der zweite Weltkrieg tobte noch ein Jahr. Mein Vater war drei Wochen vor meiner Geburt in der Normandie gefallen, meine Mutter riss mich fast jede Nacht aus dem Schlaf und flüchtete mit mir vor den Bomben der Alliierten in den Keller. Zu essen hatten wir kaum etwas, meine Mutter tauschte die Eheringe und die geschenkte Bettwäsche aus der Kriegshochzeit von 1940 gegen Kartoffeln, etwas Wurst, Butter, Eier oder Fleisch beim Bauern. Ich konnte die fette Milch nicht vertragen und erbrach all die „guten Sachen“ wieder. Am besten bekam mir klares Wasser und frisches knuspriges Brot. Das ist mir bis heute geblieben. Nach 1945 suchten uns erst die Russen heim, dann die Amerikaner. Die Amis ordneten an, dass die Bewohner meiner Heimatstadt allen Schmuck, Uhren, Fotoapparate, Radios und eventuelle Waffen auf den Marktplatz zu bringen hatten, wo diese auf einen Haufen geworfen wurden und dann fuhren sie mit einem Panzer darüber. Mein Heimatort lag genau in der Demarkationslinie, die uns später in West- und Ostdeutschland trennte. In Rodewisch standen die Russen und in Plauen die Amerikaner. Als meine Mutter mit mir im Sportwagen und in einem alten Bus nach dem völlig zerstörten Plauen fuhr, um in der zerbombten Stadt nach der Frau ihres Bruders zu suchen, wurde ich beinahe auch ein Opfer. Einer der unerwarteten Bombenangriffe begann aus heiterem Himmel, und als meine Mutter mit den Kinderwagen in einen Hausflur flüchten wollte, da flog ein noch heißer Granatsplitter in meinen stabilen Korbkinderwagen. Zum Glück ohne Schaden für mich. Jedenfalls gab es niemand der unsere traumatischen Erlebnisse später psychologisch behandeln musste und trotzdem ist gerade meine Generation, der Jahrgang 44, besonders kreativ geworden. Aus meiner Jahrgangsklasse wurden alle Schüler ordentliche und fleißige Menschen. Meine Biografie entstand aus dem Grund, meinen von mir getrennten Kindern und vielleicht meinen Enkeln etwas aus meinen Leben, meinen Denken, meinen Fühlen, meinen Problemen und meinen Hoffnungen nahe zu bringen. Dinge zu schreiben, die ich persönlich auszusprechen, keine Gelegenheit hatte. Ich schilderte mein Leben wie es war und wie ich es empfand. Dabei hatte ich stets das Wohl anderer im Auge, denn die Wirklichkeit war noch viel schlimmer, als ich es hier schilderte. Man muss sein Leben annehmen, ob man es will oder nicht. Meine Biografie wurde notgedrungen auch eine Reflexion der inneren und äußeren Bedingungen in Deutschland, in einem Zeitraum von 1944 bis in das Jahr 2010 und es zeigte sich, dass die deutsche Geschichte seit Otto von Bismarck bis Jetzt eine Zeit der Drangsal für uns Deutsche war, und es wohl auch weiterhin noch bleiben wird. Ich wurde in diese Zeit hineingeworfen, und keiner fragte mich ob es mir passte. Ich machte das Beste daraus. Möge Gott entscheiden, was entschuldbar in meinem Leben und entschuldbar an denjenigen Menschen ist, die meinen Lebensweg kreuzten und durchkreuzten. Ich selbst will es auffassen, als ein vor-übergehendes Ereignis mit einer Anzahl von Lernlektionen. Im praktischen Leben zeigt sich der Wahrheitsgehalt, oder die Richtigkeit aller aufgestellten Theorien und sogenannter "Gesetzmäßigkeiten" in aller Deutlichkeit, aber auch die Tatsache, dass diese leider gar nicht gesetzmäßig sind. Wir müssen feststellen, dass es stets anders kommt und anders läuft als angenommen. Das Leben bewegt sich wohl in einer unendlichen Abfolge von Ereignissen, die ein ETWAS in Variationen, Permutationen und Kombinationen mit uns durchspielt. Und dieses gigantische kosmische Programm läuft unabhängig von unserem Willen ab. Wir werden von den Zwängen dieses Willens gelebt, und der formlose Geist, der da sprach: ICH BIN, DER ICH BIN, wird uns wohl noch lange ein Geheimnis, aber auch eine Geisel bleiben. Und nun will ich Sie mitnehmen auf die Reise in mein ungewöhnliches Leben.
Geschrieben im Jahr 2010
Kindheit
Meine Vorfahrenkenntnis reicht, dank meiner jahrelangen und umfänglichen Ahnensuche bis ins Jahr 1535 zurück. Meine direkten Vorfahren lebten seit dieser Zeit im Thüringer Raum, in Altenburg, Ölsen, Niederhain, Garbus, Rasephas, Dobitschen, Groß-Stöbnitz, Leipa und an weiteren Orten. Sie waren bis ins 18. Jahrhundert Mühlenbesitzer und hatten Berufe wie Obermüller, Gärtner, Schneider, Zimmermann, Musiker, Holzbildhauer und Bäcker. Mein Vater war der jüngste Sohn von drei Söhnen meiner Großeltern, sein Name war Walter Gottfried Staudte. Es war mir nicht vergönnt in der Geborgenheit einer vollständigen Familie aufzuwachsen, denn mein Vater fiel im Juni 1944 in der Normandie einer Granate der Alliierten zum Opfer. Der Krieg machte meine Mutter im Alter von vierundzwanzig Jahren zur Witwe und mich schon drei Wochen vor meiner Geburt zur Halbwaise. Mein Vater ist mir von Fotos und Schilderungen der Zeitgenossen, als ein Mann mit ansprechenden Gesichtszügen bekannt. In seinen Feldpostbriefen an meine Mutter, seine Mutter und seine beiden älteren Brüder erfuhr ich mehr über seine menschliche Denkweise und seinen Charakter, aber auch über seine Einstellung gegen den Krieg und jegliche Ungerechtigkeiten. Er nannte das „schlachten“ an der Front „barbarisch und abscheulich“. Mein Großvater, namens Walter Staudte, war sowohl ein praktischer, aber vor allem ein künstlerischer Mensch, welcher den Beruf eines Holzbildhauers erlernte und die meiste Zeit seines Lebens diesen in meiner Heimatstadt Treuen und später, nach der Scheidung von meiner Großmutter, wieder in seiner Geburtsstadt Altenburg ausübte. Er litt, wie aus Briefen an seine Schwester Johanna von Nordheim offenbar wurde, sehr unter der Diskrepanz seiner künstlerischen Begabungen und den Möglichkeiten zur Verwirklichung derselben in einer Kleinstadt von etwa 9.000 Einwohnern mit einer mittelmäßigen Denkart. In seinen besten Jahren war er bis zu seinem Rentenalter Angestellter in der Sparkasse in Altenburg. Man fand ihn im Jahr 1954 nachmittags auf einer Parkbank sitzend in Altenburg tot. Er wurde 68 Jahre und starb an Herzversagen. Obwohl ich meinen Großvater nie persönlich kennen lernen konnte, was ich meiner Mutter anlasten muss, hat er mir als Andenken und in Liebe an seinen ihm unbekannten Enkel, ein schön geschnitztes Holzkästchen in Form eines Schreins mit meinen Initialen hinterlassen, welches mir viele Jahre später von meinem Onkel Erhard übergeben wurde. Meine Mutter behauptete immer ich hätte „denselben Charakter wie mein Großvater“ und müsse zwangsläufig genauso vieles erleiden wie er, da er sich nicht an die faulen Kompromisse, welche unser Leben zum größten Teil ausmachen, anpassen ließ. In diesem Sinne sollte sie wohl recht behalten. Das Rufbild meiner Vorfahren war ohne Tadel. Sie galten als zuverlässig, fleißig und unbestechlich. Soweit meine Vorfahrenerkundungen es hergaben, sollte es auch einen früheren Verwandten im Vogtland, einen gewissen Klaus Staude mit historischem Hintergrund gegeben haben. Die Filmgesellschaft DEFA der ehemaligen DDR drehte in den 80-iger Jahren einen Film mit dem Titel „Ritter, Rächer und Rebell“ oder so ähnlich, indem ein besagter Klaus Staude als Rebell gegen die Obrigkeit geschichtlich dokumentiert wurde. Der Schauspieler der diese Rolle spielte wurde bekannt durch die Gestaltung des Karl Marx als Hauptdarsteller, und spielte auch in dem Film „Lotte in Weimar“ mit Kurt Böwe, den Sohn Goethes, August. Dieser Schauspieler hieß, wenn ich mich nicht irre, Reuter. Ein weiterer Staudte war der Regisseur und Filmemacher Wolfgang Staudte, bekannt geworden durch seine Filme wie „ Die Mörder sind unter uns“, „Du und mancher Kamerad“, „Rosen für den Staatsanwalt“, „Kirmes“, „Alter Kahn und junge Liebe“, sowie „Der Untertan“. Hier war das humanistische und gesellschaftskritische Anliegen in seinen Werken gleichwohl anzumerken. Wenn man über seine Kindheit schreibt, so ist es sicher gut an den Anfang des Geschehens etwas über die Herkunft und seine Wurzeln zu schreiben. Ich beginne mit der Beschreibung meiner Kindheit an dem Punkt, wo meine ersten eigenen Erinnerungen einsetzen und in meinem Geist und meiner Seele Markierungen hinterlassen haben, die man ein Leben lang mit sich herumträgt. Ich erinnere mich sehr gut daran, als ich mit den wenigen Überbleibseln meines Vaters, einer Schirmmütze der Panzertruppen und einigen Orden als dreijähriger Knabe, es war 1947, vor der Haustüre in der Bahnhofstraße 2a meines Geburtsortes Treuen stand und auf der anderen Seite der Straße zwei Russen in Uniform daherkamen. Sie hatten große Pakete mit Stoffen unter den Armen. Als sie mich mit den Uniformteilen des Drittes Reiches sahen steuerten sie auf mich zu. Instinktiv fühlte ich die Gefahr und rannte nicht in unsere Wohnung, wo meine Mutter war, sondern durch das Haus in den Hinterhof und dort in das Waschhaus. Ich kletterte in den großen Waschkessel, der ohne Wasser war und zog den Deckel über den Kopf. Die Russen durchsuchten, wie mir meine Mutter später sagte, das ganz Haus nach mir. Als ich mich nach einer langen Zeit wieder aus dem Kessel heraustraute und vorsichtig lauschend in unsere Wohnung ging, waren die beiden Russen wieder abgezogen. Meine Mutter hatte große Angst um mich ausgestanden und verbrannte sogleich dieses letzte Uniformstück meines Vaters. Des weiteren bleibt mir unvergessen, dass meine Mutter häufig weinte und viel von meinem Vater sprach, den sie nicht vergessen konnte. Er wurde zu meinem Heldensymbol. Aufgrund der Arbeitslosigkeit in den dreißiger Jahren blieb meinem Vater nicht viel mehr übrig als der Militärdienst auf Zeit, wenn er nicht auf der Straße liegen wollte. So verpflichtete er sich 1936 für zwölf Jahre bei den Panzern. 1939 begann der Krieg und er war vom ersten Tage mit seinem Panzer an vorderster Front. Er war erst Unteroffizier, dann Feldwebel, danach Oberfeldwebel und sollte im Juli 1944 zum Leutnant befördert werden. Er machte alle Feldzüge an der Ostfront und der Westfront mit. Er wurde mehrfach schwer verwundet. Durchschuss im linken Unterarm, Steckschuss im Oberarm, Splitter über dem rechten Auge, zweidrittel im Hirn steckend und dann im Mai 1944 in der Normandie der tödliche Granatsplitter, der die Schädeldecke zertrümmerte. Seinem Vorgesetzten, einem Leutnant Hahn, der etwas größer als mein Vater war, riss es den Kopf ab. Seit dieser Zeit liegt mein Vater auf einem Soldatenfriedhof in der Normandie. Nach 1989 hatte ich erstmalig die Chance einen Blumenschmuck über den Kriegsgräberhilfsdienst Kassel an das Grab stellen lassen. Sehr lebhaft erinnere ich mich an die Besuche beim Vater und der Stiefmutter meiner Mutter in Wernesgrün. Der Vater meiner Mutter hieß Hans Fügert und war Maler. Die Stiefmutter war Köchin auf einem Gutshof in Wernesgrün. Diese hatten ein kleines Grundstück mit einem roten Ziegelhäuschen, welches in der Gabelung zweier zusammenführender Dorfstraßen direkt am Kirchplatz stand. Auf diesem Kirchplatz fanden alle Festlichkeiten des Dorfes statt. Einmal, ich glaube es war Dorfkirmes und es gab Heidelbeerkuchen, da war große Aufregung auf dem Platz. Zwei betrunkene russische Soldaten hatten zwei kleine Schaukeln von den vier Gondeln belegt. Der eine schwang derart hoch, dass er mit Wucht kopfüber hängend, oben an den Anschlag knallte und aus der Gondel katapultiert wurde. Er krachte auf den Metallabsperrzaun, welcher die Anlage gegen unbefugtes Betreten schützen sollte. Dabei brach er sich wohl die Wirbelsäule. Mich interessierten auch die beiden aus gelben und roten Ziegeln erbauten und in der Welt bekannten Wernesgrüner Brauereien, die damals noch Männel&Günnel KG hießen. Sie hatten das Braurecht seit 1436 und gelten als die ältesten Brauereien der Welt. Überhaupt war der Ort Wernesgrün in mehrfacher Hinsicht interessant. Fuhr man aus dem Ort Rodewisch mit dem alten Nachkriegsbus hinauf nach Wernesgrün, so zog sich die gepflasterte Straße zwischen starken Fichtenwälder in vielen Biegungen stetig bergauf. Kam man im Ort an, so gewann man einen herrlichen Blick zu dem rechts in der Ferne liegenden Aussichtsturm „Kuhberg“ und links, diesem etwa fünf Kilometer gegenüber, lag der „Steinberg“ mit ebenfalls einem Aussichtsturm. Hier wanderten wir des öfteren zu diesen Türmen, was für mich als Kind sehr anstrengend war. Im Dorf selbst und in den benachbarten Dörfern, wie Stützengrün und Hundsübel hatte ich noch entfernte Verwandte aus der Linie meiner Mutter, die aus Stützengrün stammte. Wernesgrün ist bereits die Grenze zum Erzgebirge und war nach Kriegsende bis hinauf nach Schneeberg eine Art Enklave. Die Russen befanden sich in Rodewisch und die Amerikaner waren bis nach Schwarzenberg gekommen. Das dazwischen liegende Stück wurde von beiden Besatzungen zum Sperrbezirk erklärt. Wir brauchten immer Passierscheine, wenn meine Mutter mit mir dorthin zu Verwandten fuhr. Mit knapp fünf Jahren war ich das erstemal im Kino. Wir gingen in Treuen spazieren und kamen am Kino vorbei. Ich bettelte meine Mutter sehr, dass sie mir 25 Deutsche Reichspfennige gab, die damals noch galten und ich damit in die Nachmittagsvorstellung gehen konnte. Der Film hieß „Unser tägliches Brot“ und der Hauptdarsteller hieß Harry Hindemith. Es war der erste Film meines Lebens und ich habe nichts vergessen, da ich über ein ausgezeichnetes Gedächtnis verfüge. Das ganze Milieu, der Gong, das langsam ausgehende Licht, die sich öffnenden dunkelroten Samtvorhänge und die bewegten Bilder hatten mich sehr beeindruckt. Ich war später fast jedes Wochenende im Kino. Zwischenzeitlich hatte meine Mutter den gröbsten Schmerz am Verlust meines Vaters hinter sich gebracht. Die Menschen versuchten zu vergessen und sich eine neue Zukunft aufzubauen. Man schrieb das Jahr 1948. Eines Tages sagte meine Mutter zu mir: „Komm Bernd, ich zeige dir mal einen Mann und du sagst mir, ob du ihn als Vater haben möchtest.“ Wir gingen dann zu einem Schuhmacher namens Pieper in der Bahnhofstraße und dieser rief den „Mann“ heraus. Der sprach mich an und wollte mir die Maße für ein Paar Schuhe abnehmen. Jedenfalls bemerkte ich, dass er etwas hinkte und ich flüsterte meiner Mutter zu: „Den will ich aber nicht.“ Er wurde dennoch mein Stiefvater, denn meine Mutter und er heirateten noch 1948. Er drängte sie wohl auch ziemlich und schließlich gab sie nach. Mein Stiefvater hieß Georg und kam mit seiner Schwester und seiner Mutter auf der Flucht vor den Russen aus Schlesien zu uns nach Treuen. Hier stellte ihn die Schuhmacherwerkstatt Pieper ein und gab ihnen eine kleine Wohnung unter dem Dach des eigenen Hauses zur Miete. Er war ein ausgezeichneter Schuhmachermeister, hatte sein Meisterdiplom mit „Sehr gut“ abgeschlossen und war auch ein sehr geschickter Handwerker. Es gab fast nichts, was er nicht reparieren konnte und er baute wunderschöne Vogelkäfige. Dennoch, das Bild meines Vaters war in meinem Gedächtnis sehr verhaftet und es fiel mir anfangs nicht leicht einen unbeschwerten Umgang mit ihm zu haben. Nach der Heirat wurde 1949 mein Stiefbruder Joachim geboren. Meine Mutter beantwortete meine Fragen nach ihrem dicken Bauch damit, dass sie sagte es käme bald der Storch, der würde sie beißen und mir ein Brüderchen oder Schwesterchen bringen. Eines nachts weckte man mich. Ich musste kurz vor der Geburt im Wohnzimmer schlafen und führte mich in das eheliche Schlafzimmer, wo mir erklärt wurde, dass das Baby im Arm meiner Mutter von nun an mein kleiner Bruder sei. Ich weinte und rannte wieder aus dem Zimmer. Am nächsten Tag wollte ich sehen, wo der Storch meine Mutter gebissen hätte und diese zeigte mir eine Narbe an ihrer Fußsohle, wo sie als Kind in eine Scherbe getreten war. Ich war sehr beeindruckt von dieser Art der menschlichen Fortpflanzung. Nach und nach gewöhnte ich mich an das neue Familienmitglied und schenkte ihm meine ganze Aufmerksamkeit und meinen Schutz als älterer Bruder. Ich bemerkte natürlich auch sehr schnell, dass es zwischen meiner Mutter und meinem Stiefvater öfters Wortwechsel gab, zum Beispiel wenn er mich allzu hart anpackte. Dann stellte sich meine Mutter stets dazwischen. Wenn der „Kleine“ etwas anstellte war ich fast immer der Schuldige. So ruhig mein Stiefvater auch nach außen hin war, er konnte jedoch urplötzlich explodieren, denn ich denke er war etwas cholerisch und seine chronische Erkrankung, von der wir damals noch nichts wussten, verschlimmerte dieses noch. Er verpasste mir einige Packpfeifen mit seinen schwieligen Schusterhänden, dass mir manches mal die Nase oder Lippen bluteten, oder er nahm seinen dünnen Leistenziehriemen und schlug mehrmals auf meinen straff gezogenen Hosenboden, dass mir vor Schmerzen das Wasser im Munde zusammen lief. Einmal gab er mir beim Mittagessen eine Ohrfeige, da ich keinen grünen Hering essen wollte. Er zwang mich jedoch dazu, so dass ich infolgedessen erbrechen musste. Ich schlug sehr unglücklich mit dem Kopf gegen einen herausstehenden Nagel, an dem ein Bild an der Wand hing. So blutete ich ziemlich heftig. Er wollte sicher in der schlechten Zeit nach dem Krieg mein Bestes, denn ich war ein schlechter Esser und der Geruch von rohen Fischen widert mich heute noch genauso an wie damals. Einmal rief ich ihm heldenhaft zu: „Wenn das mein Vater sehen könnte wie du mich behandelst, würde er dich töten.“ Es gibt aber auch viele gute Erinnerungen an ihn. Wir gingen Sonntags fast immer spazieren, oder wir fuhren auch einmal in Urlaub, sowie im Jahr 1953 nach Wernigerode. Den Urlaubsplatz hatte er von der Handwerkskammer erhalten. Wir besichtigten das Schloss von Wernigerode, wo mich tief im Keller die Folterkammern mit ihren scheußlichen Mordinstrumenten und ihren nassen Verließen nächtelang beschäftigen. Schon als Kind hasste ich Gewalt und alle die Scheußlichkeiten, die sich Kinder bereits auf dem Schulhof gegenseitig antun. Ich hatte den Wunsch später einmal ein kräftiger Mensch zu werden, um für etwas mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt eintreten zu können und die Schwachen vor den Brutalen schützen zu können. So war ich auch später stets auf der Seite der Schwachen, da ich selbst erfahren hatte, was Schutzlosigkeit und Abhängigkeit bedeuteten. Mit der Brockenbahn fuhren auf die höchste Erhebung des Harzes, den Brocken und besuchten auch die Orte Schierke, Sorge und Elend. Am letzten Tag unseres Urlaubes nahmen wir uns, bei einem damals sehr bekannten Vogelzüchter in Bad Suderode einen echten „Harzer Edelroller“, unseren Kanarienvogel „Hansi“ mit. In Erinnerung an Wernigerode blieben mir auch die großen Tüten voller saftiger Süßkirschen, wobei die Tüte 50 Pfennige kostete und ein kleiner Bach in der Stadt, in dessen klarem Wasser sich Blutegel in großen Klumpen zusammengefunden hatten. 1953 war ich für einige Wochen bei meiner Tante Berta und deren Mann Paul in Dresden. Die Tante war die Schwester meiner Großmutter, die leider auch bereits 1942, also zwei Jahre vor meiner Geburt an einem Gallenleiden verstarb. Die Tante schwärmte sehr für meinen gefallenen Vater und nahm mich im Einverständnis mit meiner Mutter zu sich. Sie hatten eine Dachwohnung in einer alleinstehenden Villa in der Augsburgerstraße, Ecke Blasewitzerstraße. Schräg gegenüber war die Huttenstraße. Die Villa war das einzige Haus, welches von der gesamten linken Straßenseite durch die Bombenangriffe der Alliierten noch stehen geblieben war. Dresden war zu der Zeit als ich dort war noch zu etwa 80% zerstört. Die Tante hatte eine Katze namens Mia, mit welcher ich oft spielte und mit den Jungen aus der Nachbarschaft streunte ich in den Ruinen der ausgebombten Häuser herum. Meine Tante erzählte mir das auf dem „Alten Markt“ von Dresden nach dem Bombenangriff der Alliierten, die mit Phosphor bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Leichen zu Tausenden aufgestapelt waren und die ganze Stadt nach verbranntem Fleisch stank. Auf den Schutthalden wuchs jetzt wilder Beifuss hervor, den ich sammelte und bei meiner Tante zum trocknen aufhängte. Zu Weihnachten sollte damit der Gänsebraten gefüllt und gewürzt werden. Mitunter fand ich einige Münzen, altes Geschirr und wühlte aus dem Schutt Bleirohre und Hausrat hervor. Viele sagten in den Kellern lägen mit Sicherheit auch noch verschüttete Tote. Meine Tante gab mir einige Decken und etwas Strick, wovon ich mir auf der kleinen Gartenwiese, unter zwei großen Bäumen eine Art Zelt baute. Ab und an fuhr die Tante mit mir Straßenbahn. Für nur 20 Pfennige konnte man durch die gesamte Stadt fahren. Wir besuchten den Zwinger, sie zeigte mir das „Blaue Wunder“ und fuhr mit mir in der Schwebebahn auf den „Weißen Hirsch“. Von Blasewitz aus fuhren wir mit einem Raddampfer nach Schloss Pillnitz und in das Elbsandsteingebirge nach Rathen. Stauend stand ich vor den hohen Felswänden. Auch Onkel Paul nahm mich einmal mit seinem alten BMW-Motorrad nach Pesterwitz mit, wo wir auf einer Obstplantage Birnen zum Einkochen holten. Ich musste den schweren Rucksack mit den Birnen tragen, so dass es mich bei der harten Federung und den holprigen Straßen tüchtig durchrüttelte. Die Tante ging auch ab und an einkaufen, dann war ich mit der Katze allein, denn Onkel Paul war ebenfalls auf Arbeit. So beschäftigte ich mich mit der Katze, der meine Zudringlichkeit einmal zuviel wurde und sie auf das Fensterbrett sprang und auf das Dach hinaus spazierte. So blieb sie einige Meter vom Fenster weg sitzen und wollte nicht mehr hereinkommen. Ich hatte Angst, dass die Katze vom Dachstürzen könnte und stieg vorsichtig aus dem Fenster um sie zu holen. Unterhalb des Fensters befand sich ein kleiner Schneezaun und die Dachrinne. Vorsichtig probierte ich das Schneegitter aus und es schien zu halten. Also rutschte ich etwa einen Meter vom Fenster weg in Richtung der neugierig guckenden Katze. Diese verlängerte die bisherige Distanz wieder auf den alten Abstand und wartete. In diesem Augenblick sah ich meine Tante unten die Straße entlang kommen und vielleicht auch für mich zur rechten Zeit, ehe etwas passiert wäre. Ich kroch vorsichtig zurück und hatte bald wieder das rettende Fenster erreicht. Als die Katze meine Tante an der Tür hörte, war sie mit einem Satz ebenfalls wieder in der Wohnung und unser gemeinsamer Ausflug auf das Dach in etwa fünfzehn Meter Höhe blieb unentdeckt. Während meines Aufenthaltes in Dresden ging meine Tante mit mir auch öfter bei guten Wetter an die Elbwiesen, rechts und links des „Blauen Wunders“, wo wir in Ufernähe badeten. Zur dieser Zeit war die Tante bereits 63 Jahre alt und ging auch mit ins Wasser. Allerdings war der Untergrund sehr steinig und von schwarzem Algenschlamm glitschig. Da die Elbe in erster Linie als Fahrwasser für die Raddampfer und die Binnenschifffahrt diente war das Baden gefährlich. Zum einen hatte die Elbe durch die Schifffahrt und das damit verbundene Ausbaggern der Fahrrinne starke Wasserstrudel, die schon manchen Schwimmer hinunterzogen und nicht mehr losließen. Andere kamen durch vorbeifahrende Radschaufeldampfer in den Sog der Wasserräder und wurden von den rotierenden Rädern erschlagen. Ich lag auf dem Bauch im flachen Wasser und hielt mich an einem großen Stein fest, als in der Mitte des Flusses ein solcher Raddampfer vorkam. Die Wellen waren so stark, dass es mich aushob und von dem Stein weg riss. Ich war damals neun Jahre alt und konnte noch nicht schwimmen, also schrie ich in Todesangst wie verrückt nach Hilfe, so dass schnell einige Leute trotz der vielen Steine in das Wasser rannten und mich bald wieder ans Ufer holten. Mit dem Wasser hatte ich mehrere schlechte Erfahrungen gemacht, was mich aber später nicht davon abhielt bei der Fischfang-Hochseeflotte der DDR anzuheuern. Ich war etwa 10 Jahre alt, als ich einen Klassenkameraden näher kennen lernte, der in der Stadtbrauerei meiner Heimatstadt Treuen wohnte. Es war Anfang Dezember des Jahres 1954 und wir beschlossen einmal die dünne Eisdecke des Brauereiteiches auf seine Tragfähigkeit zu prüfen. Mein Schulfreund kniete sich nieder und drückte mit der Hand auf das Eis welches hielt. Ich trat von der gemauerten Teichkante mit einem Fuß vorsichtig auf das Eis, bereit jederzeit zurück zu springen. Das Eis schien zu halten und so ich verlagerte mein Gewicht etwas weiter auf die Seite, wo ich auf der Eisdecke stand. Da gab es einen lauten Knall und ich versank zwischen dem splitternden Eis im kalten Wasser. Mein Trainingsanzug aus Zellwolle saugte sich voll wie ein Sack und zog mich wie ein Bleigewicht unter das Wasser. Neben mir schwamm meine Fellmütze. Das eisige Wasser schnürte mir, wie mit einem Strick die Kehle zu, so dass ich nach dem Auftauchen nur noch ein Krächzen herausbrachte. Ich war etwa zwei Meter vom Rand der gemauerten Teicheinfassung entfernt und ich strampelte um mein Leben. Mein bisheriges Leben zog wie ein Film an mir vorbei, ich sah meine Mutter und meine Gedanken signalisierten „ich sterbe jetzt.“ Auf einmal sah ich einen Polizisten, der über einen Zaun sprang und die Mutter meines Schulfreundes zu mir laufen. Sie konnten mich jedoch nicht erreichen, so dass die Frau nochmals wegrannte und einen Schirm holte, an dessen Griff ich mich festhalten konnte und sie mich mit Hilfe des Polizisten herauszog. Ich war schon so steif, dass ich nicht mehr laufen konnte und so trugen sie mich ins Haus, zogen mich aus und rieben mich trocken. Dann hüllten sie mich in Decken und holten meine Mutter. Wie ich später erfuhr war ich auf einem Tisch unter Wasser gesunken, der zur Fütterung der Teichkarpfen diente, so dass ich nicht völlig in die Tiefe abgesunken war. Durch die Schwärze des Wassers und das Eis war für mich nichts davon wahrnehmbar gewesen. Und so bekam ich bereits mit 10 Jahren eine Ahnung davon wie schnell der Tod kommen kann. An dieser Stelle sollte auch meine inzwischen erfolgte Einschulung im Jahre 1951 nicht unerwähnt bleiben. Der Stichtag für die Einschulung war der 30. Juni und ich war am 06. Juli geboren. So kam es, dass ich erst im Alter von fast sieben Jahren in die Schule kam. Zu dieser Zeit waren Lehrer gesuchte Personen, unter diesen wiederum waren die sogenannten „Altlehrer“. Das waren die, welche schon in der Nazizeit tätig waren und „Neulehrer“, dass waren zumeist jüngere Leute die aus der Gefangenschaft zurückkehrten und sich für die übriggebliebene Kinderschar als Lehrer engagierten und ausbilden ließen. Die 1949 gegründete DDR rief sogenannte „Institute für Lehrerbildung“ ins Leben. Die Klassenstärke der Neueinschulungen 1951 betrug in unserem Ort, insgesamt etwa 120 Schüler, die auf drei Klassen verteilt waren. Ich war von der ersten bis achten Klasse in der Klassenziffer 1c bis 8c. Die Schuleinführung selbst ist mir schwach in Erinnerung geblieben, jedoch fühlte ich eine starke Beklommenheit, als wir Neulinge von der Feierstunde im Kinosaal, wo die Klassen zusammengestellt wurden, anschließend mit unseren uns noch fremden Klassenlehrern durch die Stadt und in die Schule marschieren mussten. Überall an den Straßen standen Nachbarn und riefen uns etwas zu wie: “ Jetzt geht der Ernst des Lebens los“ und „Es wird Zeit das sie euch mal was vernünftiges beibringen“. Ich roch den mir bisher unbekannten eigenartigen Mief welcher unserer alten Schule anhaftete. Er roch nach geölten Böden, nach Papier, nach Holz. Unsere Schritte hallten auf dem mit gebrannten Fließen ausgelegten Gängen und wir wurden in unser im Erdgeschoss links liegendes Klassenzimmer einquartiert. Hier wurde die Sitzordnung festgelegt und wir saßen dann mit unseren Nachkriegsranzen neben einem noch unbekannten Sitznachbarn in den festgeschraubten Holzbänken, die schon etliche Jahrgänge von Erstklässlern ausgehalten hatten, was man deren polierten Sitzflächen, den Schnitzarbeiten, den Tintenklecksen und den Fettflecken im Holz unschwer ansehen konnte. Ich saß, so glaube ich, in der an der Türe gelegenen Außenreihe, etwa in der Mitte. Da wir jedoch mehrmals untereinander in den folgenden Tagen die Sitzpositionen und den Nachbarn wechseln mussten ist mir mein erster Nachbar nicht mehr im Gedächtnis haften geblieben. Es ging zu wie im Taubenschlag. Alle redeten durcheinander, dann hielt der Direktor, er hieß Kahn und hatte rote Haare, eine erbauliche Rede und überließ uns danach den Klassenlehrern und diese nach einer Stunde unseren Eltern, die draußen warteten. Wir wurden beim Zusammentreffen mit den Eltern und Verwandten gefeiert als hätten wir einen Verdienst, der allein in unserem Alter begründet schien. Ich bekam eine mittelgroße Zuckertüte mit Süßigkeiten und weiter unten in der Nähe der Spitze lag ein langer Brikett der als Füllstoff diente, denn soviel wollte man auch nicht investieren. Hauptsache oben sollte der Inhalt üppig hervorquellen. Stolz wurden dann von einem ansässigen Fotografen Klassenfotos und Einzelfotos mit den Zuckertüten gemacht und so kann ich heute noch ein sehr schönes Erinnerungsfoto von diesem Tag hervorholen und mit Staunen die Person betrachten, die ich vor vielen Jahren einmal war. Es ist schon interessant zu sehen wie die Zeit die Dinge und Personen zu verwandeln vermag. In diesem Sinne ist wohl die Natur die größte Zauberin. Meine Eltern waren in die ehemalige Mutschmannstraße 13, die nach dem Krieg Reiherstraße und schließlich Albrecht-Dürer-Straße hieß, umgezogen. Mein Stiefvater hatte sich inzwischen selbständig gemacht und so zogen wir in das Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Böden der Wohnung waren überwiegend aus Stein und in dieser Wohnung war vorher bereits ein Ladengeschäft gewesen. So wurde der Laden geringfügig umgestaltet, gemäß den Anforderungen an ein Schuhmachergeschäft und in den zwei Räumen die zum Hinterhof des Hauses zeigten richtete mein Stiefvater seine Werkstatt mit einem kleinen Lager, sowie den notwendigen Maschinen ein. Da standen eine zwei Meter lange Ausputzmaschine, an welcher Absätze und Sohlen geschliffen sowie poliert werden konnten, eine Doppelnahtmaschine für das Nähen von dickem Kernleder, zwei weitere Nähmaschinen, ein Podest für das eigentliche Arbeiten, eine Schuhpresse, ein Schneidetisch für Oberleder, Leisten und Formschablonen, Leime, Färbemittel, Holznägel, Werkzeuge usw.. Nach kurzer Zeit hatte der Stiefvater sehr viele Kunden, da seine Qualitätsarbeit, die Vielfalt dessen was er konnte und die Zuverlässigkeit der Fertigungstermine ihn schnell bekannt machten. Nicht nur die Kunden kamen aus weiterer Umgebung, sondern auch andere Schuhmacher ließen sich von meinem Stiefvater die Schäfte und Oberleder für Kunden berechnen und zuschneiden. Die Stiefel der er fertigte passten beim erstenmal bereits wie angegossen. Stiefel und feste Arbeitsschuhe waren sehr gefragt, aber der Stiefvater hatte auch einen Abschluss als Orthopädieschuhmacher und so hatte er viele Kunden mit Schäden an den Füßen, Verletzungen und Erfrierungen aus dem Kriege, Geburtsschäden usw.. Die Bauern brachten ihre Joche von Pferden und Ochsen, ja ich kann mich erinnern, dass mein Stiefvater auch komplettes Zaumzeug und Kutscherpeitschen fertigte. Es dauerte nicht lange, da konnte er einen Lehrling einstellen. Ich kann mich noch sehr gut an diesen erinnern, er hieß Wolfgang L. und dessen Familie wohnte in der Weststraße in Treuen. Er war ein sehr intelligenter, ansehnlicher und fleißiger Lehrling den mein Stiefvater sehr schätzte. Nach seiner Lehre ging er zu unser aller Bedauern weg, er wollte mehr Geld verdienen und studieren. Später erfuhren wir (er besuchte uns einmal und bedankte sich bei meinem Stiefvater für das bei ihm Gelernte) dass er im Ministerium für Außenhandel der DDR tätig und viel im Ausland war. Irgendwann erfuhren wir, es muss 1956 oder 1957 gewesen sein, dass er tot sein soll. Ein Unfall, wie es hieß. Unser zweiter Lehrling hieß Wilfried, aber diesen konnte man mit „unserem Wolfgang“, wie meine Mutter meinte nicht vergleichen. Mein Stiefvater entließ ihn bald wieder. Ich saß auch oft mit auf dem Arbeitspodest, wo zwei dreibeinige Schemel standen und entfernte mit einer Zange die alten Sohlen und Absätze der Kunden, oder ich polierte unter seiner Aufsicht und Anleitung die reparierten Schuhe. Bei säumigen Kunden legte mein Stiefvater einige Paar Schuhe in eine Tasche und ich trug sie dann zu den Kunden. Manchmal bekam ich auch 10 oder 20 Pfennige Botenlohn. Am Wochenende gab mir mein Stiefvater ab und an einen 50 Pfennigschein (diese waren blau) und ich sparte fleißig mein erstes, durch eigene Arbeit erworbenes Geld. Da war ich zehn oder elf Jahre alt. In der Schule kam ich ohne besondere Anstrengungen gut mit. Das, was ich im Unterricht gehört hatte reichte zumeist für eine gute oder durchschnittliche Zensur bei einer Kontrolle aus. Ich hatte zwei Vorteile: erstens war ich sehr neugierig, aus diesem Grunde las ich unglaublich viele Bücher, zweitens hatte ich ein gutes Gedächtnis und eine schnelle Auffassungsgabe. In der fünften oder sechsten Klasse war ich in zwei Bibliotheken zur gleichen Zeit eingetragen. Zum einen in der städtischen Bibliothek und in der Schulbibliothek. In den ersten zwei Schuljahren bekam ich (meine Mutter brauchte nie mit mir Schularbeiten zu machen) in Betragen und Fleiß jeweils die Note 1, in allen anderen Fächern die Note 2. Ab der dritten Klasse kam eine gewisse Langeweile in mir auf, die nur durch eine interessante Unterrichtsgestaltung entkräftet werden konnte. So kam in mein Zeugnis der dritten Klasse der Satz: „Bernd stört oft den Unterricht durch sein unbeherrschtes Wesen. Im übrigen verfügt er über Kenntnisse und Erfahrungen die den Unterricht vorantreiben.“ Mein „unbeherrschtes Wesen“ fand darin seinen Ausdruck, dass ich, wenn ein Mitschüler etwas gefragt wurde und derjenige eine besonders lange Leitung bei der Antwort aufwies, das Ergebnis der Frage oftmals laut in die Klasse rief. Mit Ende meines zwölften Lebensjahres kam ich in die Pubertät und entwickelte naturgemäß eine gewisse Opposition gegen Dinge, die von den meisten Menschen doch relativ kritiklos übernommen und gelebt werden. Das sechste Schuljahr war eigentlich mein schlechtestes überhaupt, da ich in dieser Zeit sehr „vorlaut“ war. Aber es lag sicher auch daran, dass wir vier Schuljahre denselben Klassenlehrer hatten, einen gewissen Studienrat F. , welchen meine Art stark verunsicherte. Später hatte ich einen Lehrer, an welchen ich auch heute noch mit Freude und Achtung denken kann. Es war mein Mittelschullehrer, Herr Benno B. Er war ein hervorragender Lehrer mit breitem Wissen und ein Mensch mit großer Kenntnis aller Regungen einer begabten Knabenseele. Er spannte den Bogen von der Sache bis zu den Wurzeln derselben. Er führte unsere wissbegierigen Sinne zu den Quellen der Abkürzungen, er erklärte uns die lateinischen und griechischen Wortstämme. In der Physik steht der Buchstabe „klein a“ für die Beschleunigung und dieser wiederum steht für das lateinische Wort „accelero“ ,“beschleunigen“. So lernten wir nicht nur das Allgemeine, sondern auch das Besondere und vor allem so, dass es heute noch haftet. Ich denke, dass in der heutigen Zeit der Informationsüberschwemmung von zu vielen Dingen zu wenig und vom klassischen Erbe kaum etwas vermittelt wird. Der größte Teil des Lehrstoffes von zehn Jahren Unterricht ist nach kurzer Zeit „versandet“ und 80-90% braucht man ohnehin nie im Berufsleben. Würde man die Schüler mit 10 Jahren in die Schule schicken und diese bis zum 15. Lebensjahr mit allem praktischen Wissen ausstatten, was zur erfolgreichen Behauptung in Natur und Gesellschaft erforderlich ist, so hätte die Masse ausreichend das gelernt, was man für die Bewältigung des Lebens bräuchte. Voraussetzung wäre natürlich, dass der Unterricht wirklich eine Vorbereitung auf das Leben wäre. Wer mehr wissen will, wird dies aus seinem inneren Drang heraus ohnehin tun. Dem Rest der Durchschnittsschüler und später Durchschnittsbürger jedoch blieben viele seelische Tortouren, die eine so lange Schulzeit mit den vielen Klausuren und Prüfungen mit sich bringt, erspart. Es würden mit Sicherheit weniger Psychopathen geschaffen werden. Allerdings wäre auch das Bildungssystem ein völlig anderes. Lessing sagte einmal: „Das aus Büchern erworbene Wissen nennt man Gelehrsamkeit, das aus dem Leben erlangte Wissen Weisheit. Ein Wort jener Weisheit ist mehr wert als Hundert Sätze Gelehrsamkeit.“ Es ist nun an der Zeit auch etwas mehr zu meiner Mutter und meinem Verhältnis zu ihr zu schreiben. Die Mutter meiner Mutter stammte aus einer Fabrikantenfamilie namens Seifert aus Unterstützengrün im Erzgebirge und wurde in Schneeberg geboren. Der Vater meiner Mutter, ein Hans Fügert, war ebenfalls in Stützengrün ansässig und war Malermeister. Die Großmutter mütterlicher Seite starb wenige Jahre nach der Geburt meiner Mutter und ihres Bruders Erich, meinem Onkel. Als meine Mutter geboren wurde, war der Erste Weltkrieg gerade zu Ende gegangen und die Menschen in Deutschland standen wieder einmal vor dem Nichts. Der Vater meiner Mutter war mit den beiden Kindern allein und heiratete mehr notgedrungen eine Köchin aus Wernesgrün, um eine Mutter für seine beiden Kinder zu haben. Wie anfangs erwähnt lebten sie später in einem kleinen Haus des Ortes. Ich kannte diese Stiefmutter und meinen Großvater noch persönlich, zumal mir ein erstes Erlebnis mit diesem sehr im Gedächtnis haften blieb. Er besuchte uns einmal, es war 1948 in Treuen und rauchte dabei eine Meerschaumpfeife, was mir sehr imponierte. Als vierjähriger und neugieriger Knirps fragte ich ihn nach dem Sinn des Rauchens aus, wie es schmeckte usw.. Er sagte zu mir: „Hier, zieh mal tüchtig daran und steckte mir die qualmende Pfeife in den Mund. Ich zog ordentlich und ein Teil des Rauches kam in die Lunge, den Rest verschluckte ich wohl und mir wurde unendlich übel, alles drehte sich um mich und ich musste erbrechen. Das gab dann noch einen schönen Ärger mit meiner Mutter, die für solche Späße nichts übrig hatte. Die Stiefmutter meiner Mutter war eine herbe Frau, die mit dem Großvater noch vier eigene Kinder zusammen hatte, wovon die zwei Jungen starben. Einer davon, er hieß Wolfgang, erstickte im Alter von 11 Jahren qualvoll an Diphtherie. Er war derjenige, der mich einmal in dem Haus fast zu Tode erschreckt hatte. Ich war fünf Jahre und musste abends auf das Klosett gehen, was im Hausflur ganz am Ende war. Er hatte das wohl gehört und sich im Dunkel bereits vor mir auf das Klo geschlichen und dort versteckt. Er hatte sich die Maske einer alten, zahnlosen Hexe vor das Gesicht gemacht und ein Kopftuch aufgesetzt. Als ich im Dunkeln das Klosett öffnete und Licht anschaltete, saß ein „Hexe“ auf der Toilette. Ich schrie wohl sehr unnatürlich auf, so dass alle heraus rannten, um zu sehen was geschehen sei. Da hatte er aber eine Tracht Prügel bezogen und ich hatte einen Schock. Wie mir meine Mutter schilderte hatte sie eine recht herzlose Kindheit bei dieser Stiefmutter, die ihre Kinder den Kindern aus erster Ehe des Vaters vorzog.
[...]
- Arbeit zitieren
- Bernd Staudte (Autor:in), 2012, Gib niemals auf, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190154
Kostenlos Autor werden



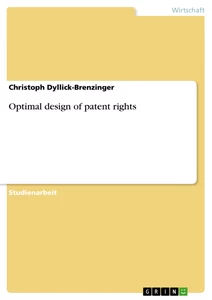







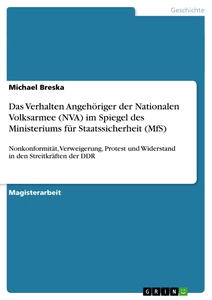







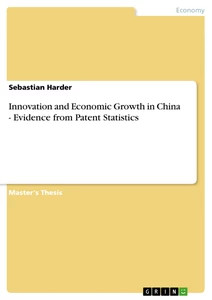


Kommentare