Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Einleitung
1.1 Hinführung
1.2 Abgrenzung
1.3 Bewegte Ganztagsschule - Idealverein für Sportkommunikation und Bildung
1.4 Wissenschaftliche Fragestellung
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Sport in Schule und Verein
2.2 Ganztagsschulentwicklung
2.3 Bildungs- und Gesundheitsaspekte von Sport
2.3.1 Physische Aspekte
2.3.2 Psychische Ressourcen
2.3.3 Verhaltens- und Verhältniswirkungen
2.4 Sekundäranalyse
2.5 Das ISB-Programm „Bewegte Ganztagsschule“
2.6 Hypothesen
3. Methodik
3.1 Die SAFTSQ - Studie
3.2 Erhebungsmethoden
3.3. Zusammenfassung
4. Auswertung der Ergebnisse
4.1 Dateneingabe
4.2 Datenverarbeitung
4.2.1 Zum Untersuchungsgegenstand der physischen Aspekte
4.2.2 Zum Untersuchungsgegenstand der psychischen Ressourcen
4.2.3 Zum Untersuchungsgegenstand der Verhaltens- und Verhältniswirkungen
4.2.4 Cluster
4.3 Demografie der exklusionsbereinigten Stichprobe
4.4 Ergebnisse und Interpretation
4.4.1 Physische Aspekte
4.4.1.1 Untersuchungsgegenstand 1: BMI
4.4.1.2 Untersuchungsgegenstand 2: aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit (scp7)
4.4.2 Psychische Ressourcen
4.4.2.1 Untersuchungsgegenstand 3: Selbstwirksamkeitserwartung
4.4.2.2 Untersuchungsgegenstand 4: Selbstkonzept
4.4.3 Verhaltens- und Verhältniswirkung
4.4.3.1 Untersuchungsgegenstand 5: Habituelles Bewegungsverhalten - Aktivität
4.4.3.2 Untersuchungsgegenstand 6: Teilhabe am sozialen System Sport
4.4.3.3 Untersuchungsgegenstand 7: vielseitige Ernährung
4.4.3.4 Untersuchungsgegenstand 8: Hygieneverhalten
5. Gesamtergebnis & Handlungsempfehlungen
I. Literaturverzeichnis
II. Abbildungsverzeichnis
III. Tabellenverzeichnis
Vorwort
Die vorliegende Masterarbeit entstand im Rahmen meines berufsbegleitenden Studiums zum Master of Business Administration (MBA) an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt.
Meine Beschäftigung als Bildungsreferentin beim Idealverein für Sportkommunikation und Bildung e.V. (ISB) machte den Bezug des theoretischen Wissens zur beruflichen Praxis möglich. Die Themenwahl erfolgte angesichts einer möglichen Erst-Auswertung von Datenbeständen, die seit Beginn des Programms „Bewegten Ganztagsschule“ im Jahr 2008 im Rahmen der Active-Full-Time-School-Quality (SAFTSQ) erhoben wurden. Die SAFTSQ stellt eine durch Mitarbeiter des ISB entwickelte Evaluation dar, um die Ergebnis-, Struktur-, und Prozessqualität des Projekts „Bewegte Ganztagsschule“ zu messen. Die Eingabe der Daten erfolgte durch Personal des ISB, ab dem Zeitpunkt der Operationalisierung steuerte ich die Auswertung. Damit kann die vorliegende Arbeit auch als methodische Vorlage für weitere Auswertungen dienen.
An dieser Stelle möchte ich der Vorstandschaft des ISB danken, die mir verschiedene Themen im Bereich der „Bewegten Ganztagsschule“ vorschlugen und mir schließlich den enormen Datenpool zur Auswertung anvertrauten.
Zum besseren Verständnis der Abbildungen im Rahmen der Arbeit ist zu sagen, dass die Abbildungen, welche in grün gehalten sind, gruppenübergreifende Aussagen über die gesamte Stichprobe treffen. Die Farbe Rot markiert jeweils Aussagen über die Testgruppe, wohingegen Aussagen über die Kontrollgruppe über die gesamte Arbeit hinweg in blau gekennzeichnet werden. Die gänzlich in verschiedenen Rottönen gestalteten Abbildungen geben folglich einen differenzieren Einblick innerhalb der Testgruppe.
Karin Eberle, im September 2013
1.Einleitung
Bewegung, Spiel und Sport nimmt in unserer Gesellschaft einen bedeutenden Stellenwert ein. Viele positive Effekte auf physische, psychische und soziale Entwicklung im Kindesalter, die insbesondere auch einer aktiven Teilhabe an Bewegung, Spiel und Sport zugeschrieben werden können, werden in erster Linie im Rahmen der sozialen Instanzen Familie, Peer-Group, Schule oder Sportverein erzielt.[1]
Divergierende Tendenzen jedoch lassen sich im Hinblick auf die Entwicklung der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen beobachten. In den letzten Jahren haben diese Lebenswelten sich insbesondere hinsichtlich der Familienstrukturen, Mediatisierung, Urbanisierung und des demografischen Wandels verändert, der wiederum wachsende Nachfrage nach Ganztagsbetreuung generiert. Diese Veränderungen wirken sich auch ungünstig auf das Bewegungsverhalten von Kindern aus. Die aus den veränderten Lebenswelten resultierenden Lebensstile begünstigen Phänomene wie mangelnde Primärerfahrungen, also unmittelbare Erfahrungen, bei denen der Mensch direkt in Kontakt mit den Dingen oder Menschen steht, Bewegungsmangel oder Adipositas.[2]
Insgesamt lässt sich jedoch verzeichnen, dass Kinder im Vergleich zu anderen Altersgruppen heutzutage eine relativ gesunde und aktive Altersgruppe darstellen. Je nach Definition sind in Deutschland aktuell zwischen 10 % und 20 % der Schulkinder übergewichtig, 4 % bis 7 % weisen bei den fünf- bis sechsjährigen Kindern bereits Adipositas auf.[3]
Innerhalb der letzten 30 Jahre nimmt Sport und Bewegung für Kinder zudem einen konstant hohen Stellenwert in der Freizeitgestaltung ein. Sportvereine sind im Hinblick auf eingangs erwähnte Bildungseffekte des Sports besonders bedeutsam, „da Häufigkeit, Regelmäßigkeit und inhaltliche Anleitung der Aktivität hier […] einer hohen Verbindlichkeit unterliegen.“[4] In Verbindung mit dem wachsenden Ausbau der Ganztagsbetreuung entsteht indes seit wenigen Jahren eine interessante Kombination bestehender sozialer Instanzen; häufig kooperieren Sportvereine mit Schulen und erreichen mit einem spezifischen sportpädagogischen Konzept eine große Gesamtheit verschiedener Schülerinnen und Schüler. Diese unspezifischen Angebote sind oftmals weniger wettkampf- und sportartenorientiert als etablierte Sportvereins-Angebote oder schulischer Basissportunterricht und fördern und erschließen vielmehr auf niedrigschwellige und vielfältige Weise neue Sportbereiche und die Freude an Bewegung.
1.1 Hinführung
Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschäftigen sich Autoren mit alternativen Sinndimensionen des Sports.[5]
„Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine,
Kürzt die öde Zeit,
Und er schützt uns durch Vereine
Vor der Einsamkeit.“[6]
JOACHIM RINGELNATZ (1883-1934)
Bötticher[7] liefert damit bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts „konkrete Hinweise darauf, dass dem organisierten Sport nicht nur die bloße Zielsetzung einer Verbesserung physischer Kompetenzen beizumessen ist“ […] sondern sich Aspekten zuwendet, die sich „heutzutage als Stärkung psychosozialer Gesundheitsressourcen als besondere Chance für Sportvereine“ interpretieren lassen.[8]
Weitaus frühzeitiger, bereits im 17. Jahrhundert, schrieb John Locke in seinen „Gedanken über Erziehung“ erste Aspekte der Erziehung durch Bewegung nieder. Er betont den Sinn der Gesunderhaltung und Ausbildung von Tugend und Moral durch Körper- und Bewegungserziehung. Durch Jean-Jaques Rousseau erhalten die Menschen im 18. Jahrhundert eine grundlegend neue Idee über Erziehung und die Rolle des Körpers. Er sieht erstmals das Kind als solches an, das durch vielfältige Formen von Bewegung, Spiel und Körpertraining entscheidende körperliche und sinnliche Erfahrungen macht. Erst durch diese Erfahrungen würde nach Rosseau das Kind zum „wahren Menschen“[9], es trainiere die Sinne, lerne den Körper zu beherrschen und sein Selbstbewusstsein auszubilden.
In Deutschland werden diese Ideen von den Philanthropen[10] aufgenommen und in ihren Musterschulen der Versuch einer Umsetzung in die Erziehungswirklichkeit unternommen.[11] Der Philanthrop Johann Christoph Friedrich GutsMuths veröffentlicht einige Werke zu Leibesübungen und Gymnastik, sein bekanntestes ist „Gymnastik für die Jugend“ (1796). Diese Elaborate gelten als „erste umfassende Lehrbücher für pädagogische Leibesübungen“; sein wohl bedeutendstes Motiv sind hierbei Selbst- und Zwecklosigkeit, die sowohl Körper als auch Geist in Aktion setzen; Zwang ist der Grundsatz, der auf jeden Fall vermieden werden sollte.[12]
Seit Mitte des 19. Jahrhundert beginnt sich das Schulturnen nach Adolf Spieß, der als Vater des Schulturnens gilt, in den Schulen durchzusetzen. Hierbei steht der physische Aspekt, die Wehrertüchtigung im Vordergrund, der zu dieser Zeit das bedeutende Argument für den Einzug in die Lehrpläne darstellte.[13] Bis heute ist diese einstige Form des Schulturnens bekannt dafür, dass psychosoziale Aspekte weitgehend nicht berücksichtigt werden.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird diese Form des klassischen Turnens immer lauter kritisiert. Durch die Gründung eines Zentralausschusses für Volks- und Jugendspiele sowie des Goß‘lerschen Spielerlasses 1891, rückt das vaterländische Turnen mitsamt seiner vordergründig agonalen und physischen Monopolstellung mehr und mehr in den Hintergrund zu Gunsten von Spiel und Sport.
Das Spiel wahrt der Jugend über das Kindesalter hinaus Unbefangenheit und Frohsinn, die ihr so wohl anstehen, lehrt und übt Gemeinsinn, weckt und stärkt die Freude am tatkräftigen Leben und die volle Hingabe an gemeinsam gestellte Aufgaben und Ziele.[14]
Durch den Ersten Weltkrieg erfährt die Ausdehnung des Sports und des vaterländischen Turnens eine Unterbrechung.[15] Während der Weimarer Zeit (1919-1933) blühen die verschiedensten Bewegungskulturen wieder auf. In dieser Zeit wird 1920 die erste Hochschule für Leibesübungen in Berlin gegründet. Im Nationalsozialismus wird der Sport sodann vollständig als politische Leibesübung instrumentalisiert.
Nach der Kapitulation 1945 entwickeln sich Turn- und Sportvereine in den verschiedenen Besatzungszonen auf unterschiedliche Weise. Auch der Schulsport wird neu überdacht. Dies geschieht mit Rückbesinnung auf die „Bildungswerte der Leibesübungen“ von Ommo Grupe. Sein Grundgedanke dabei ist, dass der Mensch durch „zweckfreien, spielerischen, offenen und wandelbaren“ Sport „aktives und selbstbestimmtes Handeln“[16] lernt.[17]
Heutzutage tritt überdies neben den Bildungswerten der Gesundheitsaspekt vermehrt in den Vordergrund des Sporttreibens. Im Jahr 2000 unterstützt in Deutschland der Gesetzgeber die Gesundheitsförderung durch Sport mit dem „Präventionsparagraphen“ im fünften Sozialgesetzbuch (§ 20).[18]
Ein solcher Ansatz von Gesundheitsförderung führt die unterschiedlichen Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit zusammen und zielt (vgl. Brehm 1998):
1. auf Gesundheitswirkungen und damit auf eine Stärkung der physischen sowie psychosozialen Gesundheitsressourcen, verbunden mit einer Meidung und Minderung von Risikofaktoren sowie mit einer möglichst effektiven Bewältigung von Beschwerden und Missbefinden;
2. auf Gesundheitsverhalten und damit auf die Befähigung des Einzelnen, selbst Kontrolle über Gesundheit auszuüben;
3. auf gesunde Verhältnisse und damit ökologischen Voraussetzungen für Gesundheitsverhalten sowie Gesundheit in unterschiedlichen Settings.[19]
Für Sportvereine eröffnet überdies das Verständnis der Weltgesundheitsorganisation (WHO) des Gesundheitsförderungsbegriffs in unterschiedlichen Settings, also Orten oder Instanzen, in deren Rahmen Gesundheitsförderung erfolgen kann, neue Möglichkeiten für ihre Angebote. Nicht nur durch Schaffung von Angeboten innerhalb eines Vereins selbst als Setting, sondern durch Kooperationen, die Sportvereine mit anderen Einrichtungen, wie beispielsweise Schulen eingehen, generieren diese gemeinsam Settings der Gesundheitsförderung, in diesem Fall für Kinder und Jugendliche.
Berücksichtigt man, dass in der Definition des modernen Gesundheitsbegriffs neben dem physischen vor allem auch dem psychischen und sozialen Aspekt im selben Maße Bedeutung zukommt, so liegt im Sinne einer Entwicklung umfassender Gesundheitskompetenzen nahe, zwischen dem WHO-Settingbegriff und der Begrifflichkeit einer sozialen Instanz des Bildungs- und Erziehungswesens keinen bedeutsamen Unterschied mehr zu suchen.
1.2 Abgrenzung
Grundsätzlich soll die vorliegende Arbeit nicht zuletzt wegen der beachtlichen inhaltlichen Schnittmengen zwischen Gesundheitsaspekt und Bildungs- und Erziehungsaspekt zuerst Bewegung, Spiel und Sport im Setting Ganztagsschule beleuchten und sodann mitsamt all seinen Wechselwirkungen erörtert werden. Dies wird in Kapitel (2) als theoretische Grundlage verstanden, das mit einer kurzen Sekundäranalyse, die dem noch jungen Forschungsstand innerhalb dieser spezifischen Problemstellung geschuldet ist, abschließt.
In Kapitel (4) erfolgt die Auswertung neuer umfangreicher quantitativer Erhebungen, die im Rahmen bereits längerfristig eingerichteter Modellprojekte durchgeführt werden und deren Erhebungsdesign zuvor in Kapitel (3) vorgestellt wird.
1.3 Bewegte Ganztagsschule - Idealverein für Sportkommunikation und Bildung
Bei den erwähnten Modellprojekten handelt es sich um Standorte des Projekts „Bewegte Ganztagsschulte“ des Schweinfurter Idealvereins für Sportkommunikation und Bildung (ISB). Der ISB ist ein eingetragener Verein, der vom Finanzamt Schweinfurt für die Zweckbetriebe Sport, Jugendhilfe und Erziehung als gemeinnützig und steuerbegünstigt anerkannt ist. Als reguläres Mitglied des Landes-Sportverbands geht der Verein jedoch statt mittels traditioneller, sportartenspezifischer regelmäßiger Übungsbetrieb-Angebote für Mitglieder überdies in hohem Maße projektbezogene Kooperationen ein.
Das Projekt „Bewegte Ganztagsschule“ führt der ISB seit Beginn des Schuljahres 2008/2009 an insgesamt sieben Grund-, Haupt- und Mittelschulen in Stadt und Landkreis Schweinfurt durch; insgesamt nehmen seither mehr als 800 Schüler am Programm in allen im Freistaat Bayern durchführbaren Ganztagsschulmodellen – der gebundenen, der offenen Ganztagsschule sowie der verlängerten Mittagsbetreuung – teil.
Grundlegendes pädagogisches Projektziel ist neben der Förderung physischer, psychischer und sozialer Kompetenzen die Begünstigung eines Zuganges aller am Projekt teilnehmenden Ganztagsschülerinnen und Ganztagsschüler zum sozialen System Sport. Dies erfolgt durch die attraktive Gestaltung vielseitiger, auch neuer, Sportangebote und Schaffung neuer Bewegungsräume durch an den Schulen eingesetzte ISB-Mitarbeiter.[20]
Zusammenfassend ist zu sagen, dass durch [die Durchführung des Programms „Bewegte Ganztagsschule“] die gesundheitlichen Schutzfaktoren gestärkt werden sollen und eine nachhaltige, positive Verhaltensänderung in Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten angestrebt wird.[21]
Doch lässt sich dieses Unterfangen ohne weiteres in einem bildungspolitischen Umfeld realisieren?
1.4 Wissenschaftliche Fragestellung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich insgesamt mit der Frage, inwieweit ein Bewegungsprogramm an Ganztagsschulen ein wirksames Setting darstellt, um gezielt physische und psychische Kompetenzen, sowie Verhaltens- und Verhältniswirkungen zu fördern. Nicht erörtert sollen länder- oder modellspezifische qualitative Unterschiede aus schulischer oder bildungspolitischer Perspektive werden.
Die Schule als wichtiges Setting[22] der Gesundheitsförderung kann in umfassendem Maße Kinder und Jugendliche unabhängig ihrer Herkunft erreichen. Bereits 1986 intendiert die Ottawa Charta die Schaffung von für alle Menschen zugänglichen Rahmenbedingungen zur Gesundheitsförderung. Hierbei solle jeder Mensch ein Stück Verantwortung für die eigene Gesundheit und die Gesundheit seiner Mitmenschen übernehmen:
Gesundheit wird von den Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt, dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben. Gesundheit entsteht dadurch, daß man sich um sich selbst und für andere sorgt, daß man in der Lage ist, selber Entscheidungen zu fällen und Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben sowie dadurch, daß die Gesellschaft in der man lebt, Bedingungen herstellt, die allen ihren Bürgern Gesundheit ermöglichen.
Füreinander Sorge zu tragen, Ganzheitlichkeit und ökologisches Denken sind Kernelemente der Entwicklung der Gesundheitsförderung. Alle Beteiligten sollen anerkennen, daß in jeder Phase der Planung, Umsetzung und Bewertung von gesundheitsfördernden Handlungen Frauen und Männer gleichberechtigte Partner sind.[23]
Die erste Internationale Konferenz zur Gesundheitsförderung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1986 erweitert das Verständnis des Präventionsbegriffs[24] ; fokussiert wird die Erhaltung und Förderung von Gesundheitsressourcen und -potentialen der Menschen. Maßnahmen, die dies fördern sind für alle Menschen unabhängig ihres Alters von Bedeutung. Dieses Verständnis führt zum sogenannten Setting-Ansatz, Lebenswelten fokussierend, innerhalb derer Menschen ihre Gesundheitskompetenzen entwickeln und ausbauen können.[25]
Die Schule spielt hierbei im Sinne der Kinder und Jugendlichen eine bedeutsame Rolle. Die Heranwachsenden verbringen einen erheblichen Anteil ihrer Tageszeit hier; sie stellt für Kinder eine Sozialisationsinstanz dar. In der Schulklasse erfahren Kinder die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe, einer Schulgemeinschaft, die von aktiver Mitgestaltung lebt. Diesem Umfeld können sich Kinder und Jugendliche bereits schulgesetzlich nicht entziehen. Nicht zuletzt deswegen stellt die Schule ein interessantes Setting für Gesundheitsförderung dar.[26]
Die Gesundheitsbildung und -erziehung von Schülerinnen und Schülern ist als Auftrag in den Schulgesetzen verankert. Im Artikel 1 des Bayerischen Schulgesetz wird dieser Auftrag als „Vermittlung von Wissen und Können; Bildung von Geist und Körper, Herz und Charakter“ bezeichnet.[27] Von besonderer Wichtigkeit ist in diesem Zusammenhang, dass in der Kindheit und Jugend Grundlagen für einen gesundheitlichen Lebenslauf gelegt werden. Die in dieser Zeit erworbenen Habitus, insbesondere Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten, festigen sich im Laufe des Lebens und sind in zunehmend schwierigerem Maße wandelbar. Frühzeitig auftretende gesundheitliche Probleme können sowohl Wohlbefinden als auch Lebensqualität einschränken und sich innerhalb eines Erwerbs chronischer Krankheiten manifestieren.
Die Kompetenzen, die für den Umgang mit gesundheitlichen Problemen entscheidend sind, werden ebenfalls in frühen Jahren erworben.[28] Der Soziologe Aaron Antonovsky fasst diese Kompetenzen in dem sogenannten Kohärenzgefühl zusammen. Diese beschreibt die Fähigkeit erfolgreich mit Belastungen umzugehen, was sich wiederum positiv auf die Gesundheit auswirkt.[29] In diesem Kontext wird die Bedeutung für die Gesundheitsförderung im schulpflichtigen Alter entsprechend deutlich. Denn eben in diesem Alter sind häufig noch keine Gesundheitsprobleme vorhanden; Prophylaxen wären in diesem Umfeld wirksamer. Besonders die nachhaltige Vermeidung von gesundheitlichen Risikofaktoren durch Vermittlung von Wissen und Einstellungen, die zu einem gesunden Lebensstil führen, sind hierbei von großer Bedeutung.
Bei einer Durchführung gesundheitsfördernder Maßnahmen bedarf es jedoch darüber hinaus der Stärkung individueller Handlungsressourcen. Sozial integrierte Kinder mit hoher Selbstwirksamkeitseinschätzung und somit in höherem Maße entwickelten Konfliktlösungs- und Entscheidungsfähigkeiten haben auch für hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Entwicklung günstigere Voraussetzungen.[30] Auch in diesen Kompetenzfeldern kann mittels Bewegung, Spiel und Sport als gesundheitsfördernde Elemente in der Schule viel erreicht werden.
Die schulische Gesundheitsförderung hat mit den neuen Konzeptionen [z.B. die Bewegte Ganztagsschule], die unter dem Begriff „gute gesunde Schule“ firmieren, einen Stand erreicht, der konzeptionell „Gesundheit“ und „Bildung“ eng miteinander verzahnt und Gesundheit als Ressource für Bildung, zu der auch Gesundheitsbildung und -erziehung gehören, begreift.[31]
Die Frage, die sich hierbei stellt ist, ob durch die Ganztagsschule per se positive Effekte hervorgerufen werden, da alle Kinder von früh bis spät unter denselben Bedingungen Reifen, oder es zusätzlich noch eines Konzepts bedarf, das die Ganztagsschule als gesundheitspolitisches Setting begreift. Die erste bundesweite Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG, 2005 bis2010) untersucht nicht, wie Ganztagschule optimal gestaltet sein müsste, sondern beleuchtet vielmehr die Bedingungen, die in der Realität vorzufinden sind. In den Ergebnissen wird deutlich, dass sich eine Teilnahme an einer Ganztagsschulmaßnahme positiv auf die Entwicklung hinsichtlich Motivation, Sozialverhalten und schulischer Leistung auswirkt. Hierzu sei jedoch nach (Klieme, Fischer, Günter Holtappels, Rauschenbach, & Stecher, 2010) notwendig, dass Kinder zum einen dauerhaft und regelmäßig teilnehmen und zum anderen die Angebote eine hohe Qualität haben. Überdies sei Angebotsvielfalt ein einflussreicher Faktor für eine gute Qualität. Diese Vielfalt alleine reiche jedoch nicht aus; auch die Qualität der pädagogischen Prozesse innerhalb der Angebote und die inhaltliche Verknüpfung von Unterricht und Angebot sind entscheidend. Hier ist ein enger Austausch von Lehrkräften und weiterem pädagogisch tätigem Personal im Ganztag von elementarer Bedeutung.
Dies gelingt insbesondere dann, wenn alle Beteiligten der Schule wie Lehrpersonal, Eltern und Kooperationspartner Hand in Hand mit einem gemeinsamen Konzept das Ziel anstreben, den Kindern ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen.[32]
Die wesentliche Frage dabei ist, ob sportbetreute Ganztagsschüler mit Hintergrund einer Teilnahme am pädagogischen Programm „Bewegte Ganztagsschule“ aktiver und gesünder sind als Schüler, die im Sinne einer Kontrollgruppe nicht an diesem Programm teilnehmen?
Diese Forschungsfrage hat globale Ausmaße und bedarf in taxonomischer Hinsicht der Formulierung differenzierterer Fragestellungen im Vergleich einer Test- und Kontrollgruppe, insbesondere hinsichtlich ihrer
- physischen Unterschiede, messbar in Anthropometrien und aerober Ausdauerleistungsfähigkeit als Indikator für physische Gesundheitswirkungen,
- psychischen Unterschiede, messbar in Selbstkompetenzen wie Selbstkonzept und Selbstwirksamkeitserwartung, sowie
- Unterschiede in Verhaltens- und Verhältniswirkung, messbar in habituellem Bewegungserhalten, Teilhabe am sozialen System Sport, Hygieneverhalten sowie Ernährungsvielfalt
Überdies empfiehlt sich eine Analyse der Befunde der genannten drei Untersuchungsgegenstände auf Abhängigkeiten hinsichtlich der Dosierung der Programminhalte, des Geschlechts der Schülerinnen und Schüler, des Alters der Schülerinnen und Schüler, sowie des Ganztagsschulmodells.
2. Theoretische Grundlagen
Nach Betrachtung der verschiedenen Sinndimensionen von Sport in seiner geschichtlichen Entwicklung bis heute sowie deren möglicher Umsetzung in Schulen durch Sportvereine wie den ISB besteht jedoch die Notwendigkeit, intensivere Einblicke in die Themenkomplexe „Sport in Schule und Verein“, Ganztagsschulentwicklung in Deutschland sowie Bildungs- und Gesundheitsaspekte von Sport zu gewinnen. Um abschließend die im Rahmen der Forschungsfrage ausdifferenzierten physischen und psychischen Aspekte sowie die Verhältnis- und Verhaltenswirkungen untersuchen zu können, bedarf es vorbereitend einer grundlegenden Analyse dieser Begriffe.
2.1 Sport in Schule und Verein
Es existieren entsprechend der sozialen Instanz verschiedene Ansätze, um Kompetenzen im und durch Sport zu entwickeln. Sportvereine kennzeichnen sich eher durch Arbeit in homogenen Gruppen, die auf freiwilliger Basis zusammenkommen, um gemeinsam ein überwiegend leistungsorientiertes Ziel zu erreichen; eingesetzte Übungsleiter arbeiten in der Regel ehrenamtlich. Schulen hingegen fördern eine heterogene Gesamtheit an Kindern. Hier arbeitet hochqualifiziertes hauptberufliches Personal, die Arbeit nach formalisierten pädagogischen Konzepten ausrichtend.[33]
Zu Beginn der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts sind institutionell angelegte Kooperationen zwischen Schulen und Sportvereinen die Ausnahme. Es existieren unverbindliche Kooperationen, primär begründet durch beispielsweise Nutzung derselben Sportanlagen. Lediglich in Nordrhein-Westfalen (1985) und Baden-Württemberg (1987) werden bereits zu dieser Zeit formalisierte Landesprogramme eingerichtet. Zwischen 1992 und 1996 ziehen jedoch alle Bundesländer in dieser Sache nach; die Kooperationslandschaft in Deutschland verändert sich beachtlich. Bislang geduldete unverbindliche Kooperationen erhalten nun eine formale Basis.
Zum einen sollen mit diesen formalisierten Kooperationen die Ressourcen von Schule und Verein effizienter genutzt werden, andererseits betrachtet man sie zudem als wichtig für die Erfüllung pädagogischer Aufgaben des Schulsports.[34]
Kooperation meint […] eine Arbeitsweise, bei der die Produzenten aufeinander angewiesen sind, Leistungen also nur durch die Zusammenarbeit erstellt werden können[…].[35]
Nach Fessler lassen sich drei Charakteristika des Kooperationsbegriffs ausdifferenzieren. „Kooperation ist nicht Hierarchie[…], nicht nebeneinander[…] und nicht gegeneinander[…].“[36] Dies stelle eine gute Basis für die Kooperation von Sportverein und Schule, mitsamt ihrer jeweils unterschiedlichen Strukturen dar. Jede Institution habe hierbei eine gewisse Autonomie mit vielen Berührungspunkten, an denen zusammen gearbeitet werden müsse. Der Grundgedanke der Zusammenarbeit sei, Kinder zu lebenslangem Sport zu erziehen. Um diesen Gedanken gemeinsam leben und anstreben zu können, öffnen sich Schulen immer mehr gegenüber Sportvereinen.[37]
Eines der ersten Kooperationsmodelle von Schule und Sportverein in Bayern ist das Modell „Sport nach 1“ in Schule und Verein. Dieses Programm wird seit 1991 vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus und dem Bayerischen Landes-Sportverband mit Hilfe der kommunalen Spitzenverbände entwickelt. In erster Linie betreuen Übungsleiter der Sportvereine Schülerinnen und Schüler in diesem Programm. Im Jahr 2006 existieren bereits 2.200 Kooperationen in über 70 Sportarten.
Das Programm soll Schule als Ort des Lernens mit der außerschulischen Lebenswelt von Kindern verbinden, sie für den Sport begeistern, ihre Begabungen fördern und die Bedeutung der Bewegung für ein gesundes Leben vermitteln.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Entwicklung der Sport-nach-1-Sportarbeitsgemeinschaften in Bayern[38]
Eine Kooperation kann in unterschiedlichen Bereichen eingegangen werden. Zum einen gibt es die sogenannten Sportarbeitsgemeinschaften (SAGs), diese werden von qualifizierten Übungsleitern bzw. Lehrkräften geleitet, sind entweder sportartenbezogen oder sportartenübergreifend. Weiterhin kann eine Kooperation in Form eines leistungsorientierten Stützpunkts eingegangen werden; hierbei werden neben dem Vereinstraining zusätzlich vier Stunden Sportunterricht an der Schule in der Stützpunktsportart erteilt. Darüber hinaus existieren noch einige alternative Möglichkeiten einer Ausgestaltung wie Fitnessprogramme, Sportfeste oder die Abnahme von Sportabzeichen. In Bayern steigt die Anzahl der Kooperationen im Bereich der SAGs über alle Regierungsbezirke seit Einrichtung des Programms hinweg stetig, wie in Abbildung 1 zu erkennen ist.[39]
Ein weiteres Programm, welches das Ziel verfolgt, mehr Bewegung in Schulen zu bringen, ist das Konzept der Bewegten Schule. Entsprechende Konzepte werden seit den neunziger Jahren mit hohem Aufwand entwickelt; man erfindet den Rahmen zu dieser Zeit nicht neu. Im weitesten Sinne als Vorläufer dieses Konzepts können unter anderem Wandertage, Bundesjugendspiele oder der Bundeswettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ bezeichnet werden.
Viele dieser nicht typischerweise dem Kern der schulischen Programme zurechenbaren Maßnahmen sind dennoch neben dem Basissportunterricht inzwischen fester Bestandteil des sportbezogenen Schullebens. Der Grundgedanke der bewegten Schule geht auf den Schweizer Urs Illi zurück. Seinem Ziel eines „bewegteren gesamten Schullebens“, um langes „falsches“ Sitzen zu vermeiden, soll durch Bausteine wie bewegtes Sitzen, bewegtes Lernen, bewegungsfreundliche Schulraumgestaltung und Bewegungspausen, ergänzend zu Sportunterricht und außerschulischen Bewegungsangeboten nähergekommen werden.[40]
Die Idee der bewegten Schule prägt die Diskussion um die Schulprogrammentwicklung im Jahr 2008; viele Bundesländer entwickeln ihr eigenes Programm unter Bezeichnungen wie „Schule als Bewegungsraum“ (Sachsen-Anhalt), „bewegungsfreudige Schule“ (NRW), „sport- und bewegungsfreundliche Schule“ (Baden-Württemberg) oder „bewegte Schule“ (Bayern, Berlin).[41] Alle Konzepte fokussieren „Bewegung als Prinzip schulischen Lernens und Lebens“[42]
In diesem Zusammenhang werden drei wissenschaftliche Positionen entwickelt, mittels deren Grundannahmen an die Umsetzung des Programms herangegangen werden kann.
(1) Die kompensatorische Position geht von der Problematik des Stillsitzens und langen Konzentrationsphasen aus, die zu Gesundheitsproblemen führen können. Hinzu kommt, dass die heutige Lebenswelt von Kindern oftmals durch einen hohen Medienkonsum geprägt ist. Durch mehr Bewegung im Unterricht und Schule soll dem im Sinne des „Salutogenese-Modells“ entgegengewirkt werden.
(2) Die schulreformerische Position unterliegt dem anthropologischen-bildungstheoretischen Gedanken, der durch eine bewegte Schulkultur gelebt werden kann. Es soll sich mehr als nur im Sportunterricht bewegt werden. Bewegung, Spiel und Sport soll in das pädagogische Gesamtkonzept der Schule aufgenommen werden und verwirklicht werden.
(3) Die pragmatische Position lässt sich zwischen die beiden ersten Positionen einordnen. Diese sieht sich eher darin, auf bestehende Konzepte zurückzugreifen, diese zu analysieren und Empfehlungen für die Praxis zu geben. Sie sollen eine Orientierungshilfe in der Konzeptionsvielfalt sein.
Für welche Grundannahmen sich eine Schule entscheidet, variiert; selbstverständlich werden auch Mischformen der verschiedenen Positionen umgesetzt.[43]
2.2 Ganztagsschulentwicklung
Nicht nur die Konzeptentwicklung von Schulen, auch die Überlegungen zu grundlegenden Formen von Schule, Ganztagsschule oder Regelschule, verändert die Schullandschaft in den letzten Jahren erneut. In Deutschland besteht die Diskussion um Ganztagsschulen seit Beginn der Reformpädagogik um 1890. Hier beziehen sich die Neuerungen auf Reformmotive der klassischen Pädagogik des 19. Jahrhunderts - Hauptanliegen der Bemühungen ist eine ganzheitliche Förderung des Individuums mitsamt der Entfaltung seiner Kräfte.[44] Zentraler Kritikpunkt an der „alten Ganztagsschule“ mitsamt der dort stattfindenden ausschließlichen Unterrichtsstoffvermittlung umfasst die in diesem formalen Rahmen beinahe gänzlich außer Acht gelassene Eigenaktivität der Schüler.
Es sind vor allem auch Gedanken der Reformpädagogen, die „entscheidende Anstöße zur Konzeption und Realisierung moderner Ganztagsschulen[45] in Deutschland“[46] geben.
[...] zentrale Strukturelemente für eine moderne Ganztagsschule [...] [sind] vor allem diese: Mittagsmahlzeit und Freizeitangebote, Arbeitsgemeinschaften und Neigungsgruppen, Förderunterricht, Integration der Hausaufgaben in die Schule, neue Unterrichtsformen („Offene“ Unterrichtsgestaltung, Gruppenarbeit, Projekte), flexible Stundenplangestaltung und Rhythmisierung, enge Kooperation mit Eltern, Intensivierung des Schullebens, Ausgestaltung als Lebensraum, Öffnung der Schule zum „Leben“, Ausbau des schulischen Beratungswesens, mehr Gelegenheit für Schüleraktivitäten, Wandlungen der Lehrerrolle.[47]
In der Zeit des Nationalsozialismus werden Weiterentwicklungen von reformpädagogischen Bewegungen in der Ganztagsbeschulung zwar unterdrückt, dennoch entwickeln sich vereinzelt Bewegungen im Exil oder in jüdischen Schulen in Deutschland weiter.[48]
Nach Ende des zweiten Weltkriegs wird die Einrichtung von modernen Ganztagsschulen in Konzepten unter Federführung von Lina Mayer-Kulenkampf (1947) oder Herman Nohl (1947) erneut forciert.
Bis zum Jahr 1965 werden alle Entwicklungen, die in der heutigen Zeit von Bedeutung sind, konzipiert und realisiert.[49] Wichtige Anstöße hierfür liefern auch Erfahrungen aus dem Ausland, besonders dem angelsächsischen Raum. Die Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates 1968/1969 generieren der Ganztagsschulentwicklung zudem erheblichen Aufschwung; in dieser Zeit werden bundesweit Bedarfe für Ganztagsschuleinrichtungen erkannt. Eine „bildungspolitische Ernüchterung“[50] bildet sich in der Zeit von 1975 bis 1985 auch im Rahmen der Ganztagsschulentwicklung ab; Vorgaben einzelner Bundesländer für die Einführung von Ganztagsschulen bleiben unerfüllt.[51]
Ende der 80er Jahre erfolgt eine erneute Stärkung der Bemühungen um die Ganztagsschulentwicklung, die Wiedervereinigung Deutschlands bremst jedoch die Entwicklungen aufgrund der vorherrschenden Ressourcenknappheit erneut. Während dieser Zeit entwickeln sich dennoch unterschiedliche Ganztagsschulkonzepte.[52]
In den Jahren 2003 bis 2009 fördert die Bundesregierung durch das Investitionsprogramm „Zukunft, Bildung und Betreuung“ (IZBB) den weiteren Ausbau sowie die Schaffung neuer Plätze in der Ganztagsbetreuung. Welche Schulen eine Förderung erhalten, entscheiden die Bundesländer. Insgesamt werden in Deutschland hierdurch mehr als 8.200 Schulen in einer Gesamtsumme in Höhe von 4 Milliarden Euro gefördert.[53] Im Rahmen der zweiten Projektphase (2012-2015) wird mittels der Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG), deren Hauptanliegen die Abbildung der aktuellen Ganztagsschullandschaft ist, festgestellt, dass acht Jahre nach Einrichtung des IZBB die Entwicklung des Ganztagsschulbereichs keineswegs an Wichtigkeit verloren hätte.
Unterdessen erarbeitet die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) eine allgemeingültige Definition für Ganztagsschulen als Orientierung für die Länder.
Darin sind die drei zentralen Merkmale a) ganztägige Angebote im Umfang von täglich mindestens sieben Zeit-stunden an mindestens drei Tagen in der Woche, b) Bereitstellung eines Mittages-sens für die teilnehmenden Schüler/-innen und c) Organisation der Ganztagsangebote unter der Aufsicht und Verantwortung der Schulleitungen mit einem konzeptionellen Zusammenhang zum Unterricht, enthalten. Die Definition der Kultusministerkonferenz benennt zudem drei Formen von Ganztagsorganisation: die voll gebundene, die teilweise gebundene und die offene Form. Während in den gebundenen Formen die Teilnahme an mindestens drei Tagen zu sieben Zeitstunden für die Schüler/-innen verbindlich ist (in voll gebundener Form für alle Schüler/-innen, in teilweise gebundener Form für einen Teil der Schüler/-innen bspw. einzelne Klassen oder Klassenstufen), können in der offenen Form einzelne Schüler/-innen freiwillig an den ganztägigen Angeboten teilnehmen.[54]
Es werden drei verschiedene Modelle unterschieden, wie beispielsweise Sportvereine und Ganztagsschulen gemeinsam in Form von Kooperationen die Ideale der bewegten Schule umsetzen können. Diese drei Kooperationsformen werden entweder komplementär, additiv oder inklusiv verwirklicht.
(1) Sportvereine bieten an den Schulen zu bestimmten Zeiten Sportaktivitäten an, die freiwillig besucht werden können. Diese additiv-duale Kooperationsform, die bereits seit langem in Form von Sportarbeitsgemeinschaften existiert (Sport-nach-1), ist für die Ganztagsschulentwicklung nicht unbedingt förderlich. Es hat den typischen Charakter eines Sportvereins, der sich durch das Vorhandensein homogener Gruppen, Talentsichtung und Wettkampf determiniert.
(2) Das komplementäre Modell hingegen versucht, in gemeinsamer Anstrengung zwischen Ganztagsschule und Sportverein ein pädagogisches Konzept zu erarbeiten, das auf dem Selbstverständnis des Sportvereins als Jugendhilfebereich unter Berücksichtigung und konsequenter Anwendung der Bildungspotenziale des Sports beruht; der Sportverein fördert Kinder damit aktiv in ihrer Entwicklung.
(3) Im inklusiven Modell hingegen soll gelingen, nicht nebeneinander, sondern miteinander den ganztägigen Schultag zu rhythmisieren und Kinder gemeinsam durch und in der Bewegung, dem Sport und dem Spiel zu fördern.[55]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Ausdifferenzierung der Ganztagsmodelle[56]
Da in Deutschland die Schulpolitik im Verantwortungsbereich der Länder liegt, haben die jeweiligen Bundesländer wiederum eigene Konzepte und Richtlinien für die Ganztagsschule. Es ist feststellbar, dass die Bezeichnungen der Ganztagsschulmodelle in den Bundesländern von den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK) abweichen.
In Bayern wird beispielsweise die von der KMK definierte „teilweise gebundene“ Form als „gebundene“ Form bezeichnet.[57] Überdies existiert in Bayern neben den bildungspolitischen Maßnahmen der offenen sowie gebundenen Form die familien- und sozialpolitische Maßnahme der Mittagsbetreuung und verlängerten Mittagsbetreuung. Damit bestehen in Bayern folgende drei Ganztagsmodelle.
(1) Die gebundene Ganztagsschule:
Unter gebundene GTS wird verstanden, dass ein Aufenthalt in der Schule an mindestens vier Wochentagen von täglich mindestens sieben Zeitstunden für Schüler verpflichtend ist (z. B. von 8.00 – 15.00 Uhr), der Pflichtunterricht auf Vormittag und Nachmittag verteilt ist.
Der Unterrichtstag ist rhythmisiert; das heißt: Übungs- und Lernzeiten stehen im Wechsel mit sportlichen, musischen und künstlerisch orientierten Fördermaßnahmen und Freizeitaktivitäten.[58]
(2) Die offene Ganztagsschule:
Die offene Ganztagsschule ist ein freiwilliges schulisches Angebot der ganztägigen Förderung und Betreuung von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 5 bis 10. Der Unterricht an offenen Ganztagsschulen findet wie gewohnt überwiegend am Vormittag im Klassenverband statt. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, deren Eltern dies wünschen, besuchen dann nach dem planmäßigen Unterricht die Ganztagsangebote.[59]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Ganztagsschulentwicklung in Bayern 2002/2003 bis 2012/2013[60]
(3) Mittagsbetreuung:
Insbesondere für Grundschüler gibt es die so genannte Mittagsbetreuung. Sie wird bei Bedarf und abhängig von regionalen Gegebenheiten eingerichtet und liegt in kommunaler oder freier Trägerschaft. Sie gewährleistet eine verlässliche Betreuung der Kinder vom Ende des stundenplanmäßigen Vormittagsunterrichts - bisher bis etwa 14 Uhr. […] [oder] einer zeitlichen Verlängerung in den Nachmittag hinein (bis mindestens 15.30 Uhr), und sie können zusätzlich das bisherige Angebot um eine Hausaufgabenbetreuung sowie Freizeitaktivitäten erweitern.[61]
Die Mittagsbetreuung (bis 14.00 Uhr) wird in Bayern mit Landtagsbeschluss vom 3. Dezember 1992 als weitere Möglichkeit der außerschulischen Betreuung ins Leben gerufen; damit werden auch die notwendigen Mittel bereitgestellt.
Im Schuljahr 2008/2009 wird das Angebot erweitert und ergänzend die verlängerte Mittagsbetreuung bis mindestens 15:30 Uhr eingeführt. Abbildung 3 bildet die kontinuierlich steigende Zahl der Gruppen anhand der 1.000-Schülerzahlentwicklung ab.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Entwicklung der Schülerzahlen der (verlängerten) Mittagsbetreuung zwischen 1993 und Schuljahr 2012/2013[62]
Die bundesdeutsche Bildungspolitik verfolgt mit der Einrichtung von Ganztagsschulen in diesen Formen unabhängig der Beteiligung von Kooperationspartnern folgende vier Ziele:
1) individuelle Förderung im Leistungsbereich, aber auch in anderen Kompetenzbereichen und hinsichtlich der Motivation von Kindern und Jugendlichen,
2) soziale Integration, insbesondere von sozial benachteiligten Gruppen sowie von Schülerinnen und Schülern aus zugewanderten Familien,
3) thematische und konzeptionelle Ausweitung der pädagogischen Praxis und der Organisationsprozesse von Schulen, einschließlich ihrer stärkeren Verbindung mit dem sozialen Umfeld, sowie
4) Betreuung und erzieherische Versorgung, die Familien entlasten und nicht zuletzt die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Eltern ermöglichen.[63]
Diese Ziele finden sich auch in Zieldimensionen von Bewegung, Spiel und Sport im Ganztag[64] wieder:
- Zugang/Teilhabe am „sozialen System Sport“
- Kompensationscharakter
- Gesundheitscharakter
- Bildungspotenziale
In taxonomischer Hinsicht ergeben sich hieraus folgende drei Kernaufgabenfelder für eine wirksame Ausgestaltung von Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten im schulischen Ganztag[65]:
- Defizitkompensation & Gesundheitsförderung
- Wahrnehmungsförderung
- Gezielte motorische Förderung
Voraussetzungen für den Erfolg von Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten im schulischen Ganztag sind einerseits die Schulform, andererseits jedoch der Innovationsgrad der Schule bzw. des Trägers. Während hinsichtlich der Schulform bereits aufgrund der verschiedenen Umfänge der Curricula an Grundschulen grundsätzlich mehr Freiraum zur Ausgestaltung der Angebote zur Verfügung steht als beispielsweise an Gymnasien, kann der Innovationsgrad der Schule von drei verschiedenen Faktoren abhängen:
(1) Gestaltung des Unterrichts
(2) Merkmale beim für die Inhalte verantwortlichen Personal
(3) Rhythmisierung
Nach Laging und Stobbe gestalten sich Kooperationen zwischen Sportvereinen und Schulen bereits in folgendem Maße[66]:
- Sport dominiert bei den Freizeitangeboten an Ganztagsschulen
- 20 % - 37 % der Ganztagsangebote an Schulen werden bereits durch Sportvereine gestaltet
- 94 % der Grundschulen integrieren Sportangebote (Sekundarstufe II: 89 %)
- 46 % - 52 % der Kooperationen umfassen 2-3 Wochentage, während 26 % - 35 % der Kooperationen 4-5 Wochentage abdecken
- 48,5 % der Grundschulkinder nehmen an 4-5 Wochentagen an Sportangeboten teil.
In Bayern kooperieren Schulen mit einem Ganztagsangebot häufig mit außerschulischen Kooperationspartnern. Durchschnittlich handelt es sich hierbei um vier Partner. Die meisten arbeiten jedoch nicht mit mehr als fünf Kooperationspartnern zusammen. Einige wenige (6%) arbeiten mit mehr als zehn Partnern zusammen. Die Kooperationspartner stammen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Sport, Jugendhilfe, kulturelle Bildung etc. Sport ist vor der Jugendhilfe der häufigste Partner mit Anteilen zwischen 66,5 und 85,9 %, wie Abbildung 4 verdeutlicht.[67]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Anteil der Ganztagsschulen, die mit Akteuren aus dem Bereich Sport kooperieren[68]
Trotz der ökonomischen Zieldivergenz zwischen Schule und Sportverein[69], die es zu überwinden gilt, ist eine Ganztagsschullandschaft ohne außerschulische Kooperationspartner des Sports nicht mehr vorstellbar. Eine Studie des Landesssportbund Niedersachsen belegt, dass der Sport eine zentrale Rolle für die Ganztagsschule einnimmt. Es wurde ermittelt, dass zwei Drittel aller befragten Schulen mit mindestens einem Sportverein kooperieren und 40 % der Angebote durch Übungsleiter angeleitet werden.[70]
(Laging & Stobbe, 2009) zitieren folgende Erkenntnisse aus der StUBBS-Studie, die noch nähere Aussagen zu den Bedingen bezüglich der Kooperationspartner von Schulen:
(1) Anzahl der Kooperationen, welche ein Schulträger eingeht, ist nicht an die Qualität des Betreuungsangebots gekoppelt.
(2) Kooperationen sichern das Stattfinden von Sportangeboten signifikant besser als keine Kooperationen.
(3) Offenkundig ist die effizientere Variante von Kooperationen darin gelegen, wenn eine bzw. wenige Kooperationen viele Angebote schaffen und nicht umgekehrt.
2.3 Bildungs- und Gesundheitsaspekte von Sport
Insgesamt werden mit Sport unterschiedliche Ziele und Aufgaben assoziiert. Dadurch wird das Sporttreiben an sich zu einer pädagogischen Angelegenheit, wie sie praktisch beispielsweise im Rahmen des Programms „Bewegte Ganztagsschule“ des ISB umgesetzt wird. Diese Sichtweise ist, wie in der Einleitung bereits erwähnt, nicht neu. Schon seit langer Zeit werden dem Sport – auch ohne dem neugeschaffenen Setting „Ganztag“ – pädagogische Aufgaben und Ziele beigemessen. Somit ist der Sport reich an pädagogischem und erzieherischem Potenzial.
Die Schwierigkeit besteht in der pädagogischen „Verrechenbarkeit“, der Taxonomie.
Grupe differenziert in Ermangelung klar definierbarer Aufgaben und Ziele folgende vier Erfahrungsbereiche des Sports aus.
- „Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Vitalität, Wohlbefinden
- Natürlichkeit, Lockerheit, Gelöstheit, Sicherheit
- Soziales Verhalten, Fairness, Disziplin, Selbstbeherrschung, Freiwilligkeit
- Spiel, Bewegungsfreude, Zwecklosigkeit“[71]
Diese vier Bereiche scheinen auf den ersten Blick mit gewöhnlichen pädagogischen Aufgaben- und Zielformulierungen zu divergieren, insbesondere bei genauerer Betrachtung des Aspekts der Zwecklosigkeit und Freiwilligkeit. Wichtig ist jedoch bei diesem Ansatz die Erkenntnis, dass Grupe das Spiel als Teil des Sports ansieht, indem Ernst und Spaß gleichermaßen zu erfahren ist. Insgesamt besteht hiermit eine herausragende Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Aufgaben und Ziele bzw. der Bildungsbereiche von Sport die Entwicklung von Kindern gleichzeitig und ganzheitlich zu fördern – nicht nur im körperlichen, sondern auch im gesundheitlichen und psychischen Bereich wie folgende Abbildung verdeutlicht.[72]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Ansatzpunkte und Wirkungen - Gesundheitsförderung durch körperlich sportliche Aktivierung[73]
Doch lassen sich Begrifflichkeiten der Bildung und Gesundheit ohne weiteres aufeinander anwenden?
Mit der Gesundheit beschäftigen sich die Menschen bereits seit Jahrtausenden. Verschiedene wissenschaftliche Disziplinen, Politiker, Schriftsteller oder auch Versicherungen definieren den Gesundheitsbegriff.
Denn Krankheit und Gesundheit sind nicht Gegensätze, die sich bekämpfen, sie sind gleichberechtigte und notwendige Lebensäußerungen, etwa so wie Schlafen und Wachen, Nacht und Tag, Ruhe und Arbeit… Wer ist gesund, wer ist krank? Die Narren nur vermögen es zu unterscheiden. (Georg Groddeck 1910)
Sie (die Gesundheit) ist die Rhythmik des Lebens, ein ständiger Vorgang, in dem sich immer wieder Gleichgewicht stabilisiert. (Hans-Georg Gadamer 1993)
Gesundheit ist das Stadium des Gleichgewichts von Risikofaktoren und Schutzfaktoren, das eintritt, wenn einem Menschen eine Bewältigung sowohl der inneren (körperlichen und psychischen) als auch äußeren (sozialen und materiellen) Anforderungen gelingt. Gesundheit ist ein Stadium, das einem Menschen Wohlbefinden und Lebensfreude vermittelt. (Klaus Hurrelmann 2006)“[74]
Eine allgemeingültige Definition von Gesundheit gibt es nicht. Die Definition der Welt Gesundheitsorganisation (WHO)[75] ist umstritten, da Gesundheit mit der Abwesenheit von Krankheit als „vollständiger Zustand“ bezeichnet wird; dies ist utopisch. Gesundheit als ausgewogenen Zustand von Wohl- und Missbefinden zu betrachten, gehört zu den am weitesten verbreiteten, ältesten, sowie am dauerhaftesten vertretenen Sichtweisen. Der Soziologe Aaron Antonovsky entwirft diesen Gedanken in seinem Salutogenese-Modell; in den Gesundheitswissenschaften zählt dieses zu den einflussreichsten.[76]
Stressoren[77] können hier den ausgewogenen Zustand ins Ungleichgewicht bringen, den es wieder zu erreichen gilt. Der konstruktive Umgang mit Stressoren kann gesundheitsfördernd wirken. Alle Faktoren, die hierfür ausschlaggebend sind werden als Widerstandressourcen, in der Pädagogik als „Resilienzen“, bezeichnet. Der Gesundheitszustand ist also ein Ergebnis des Wirkens von Schutz- und Risikofaktoren, die man beeinflussen und steuern kann. Das Wissen über diese Faktoren und deren Steuerbarkeit nennt Antonovsky „Kohärenzgefühl“. Ein gutes Kohärenzgefühl[78] verleiht Menschen die Fähigkeit, mit verschiedenen Anforderungen flexibel umgehen zu können. Für die Theorie der Gesundheitsförderung schafft dieses Modell eine Basis, die Stärkung der individuellen und gesellschaftlichen Ressourcen hervorhebend.
Ein weiterer neuerer Begriff im Bereich des Gesundheitsverhaltens, der die Stärkung der Ressourcen unterstützt, ist die Gesundheitskompetenz.[79] Die Bedeutung von Gesundheitskompetenz - im Englischen „health literacy“ – geht ursprünglich sprichwörtlich von der Lesefähigkeit aus.
Health literacy is the ability to obtain process and understand basic health information and services needed to make appropriate health decisions and follow instructions for treatment. (American Medical Association) [80]
Inzwischen wird der Gesundheitskompetenzbegriff weiter gefasst; nicht nur das Begreifen der Inhalte von Beipackzetteln der Medikamente wird subsummiert, sondern überdies der Bereich der Gesundheitsbildung, der das Gesundheitsverhalten einer gesamten Bevölkerung fokussiert.[81] Gesundheitskompetenz definiert sich also als „Fähigkeit des Einzelnen, im täglichen Leben Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken“.[82]
[...]
[1] vgl. (Cachay & Thiel, 2000)
[2] vgl. (Schmidt, 2008)
[3] vgl. (Kromeyer-Hausschild, 2005)
[4] (Sygusch, Wagner, Opper, & Worth, 2006), S.120
[5] vgl. (Bauer, 2008)
[6] (Bauer, 2008), S.1
[7] Joachim Ringelnatz, eigentlich Hans Böttcher ist deutscher Humorist, Lyriker und Erzähler
[8] (Bauer, Qualitätsmanagement von Gesundheitssport im Sportverein, 2008), S.1
[9] (Krüger, 2005a), S. 28
[10] Philanthropen „– Menschenfreunde (abgeleitet aus dem Griechischen philos = Freund, Liebhaber und anthropos = Mensch – bezeichnet ein Kreis von Reformpädagogen in Deutschland, die sich im Jahre 1770 zusammenfanden […]“ (Krüger, 2005a), S. 29
[11] (Krüger, 2005a), S.37
[12] (Krüger, 2005a), S. 39
[14] (Denk & Hecker, 1981), S. 258/259
[15] vgl. (Krüger, 2005a)
[16] (Krüger, 2005b), S.180
[17] vgl. (Krüger, 2005b)
[18] vgl. (Brehm & Bös, 2., vollständig überarbeitete Auflage 2006)
[19] (Brehm & Bös, 2., vollständig überarbeitete Auflage 2006) S. 19
[20] vgl. Mitarbeiterhandbuch (2012)
[21] vgl. (Rödemer, 2010)
[22] „Als Settings werden die Lebenswelten der Menschen bezeichnet: zum Beispiel Kindergärten, Schulen, Stadtteile, Senioreneinrichtungen und Migrantentreffpunkte. Dort lassen sich auch Menschen erreichen, die von sich aus keine individuellen präventiven Kursangebote aufgesucht haben.“ (http://www.gbe-bund.de/gbe10/abrechnung.prc_abr_test_logon?p_uid=gastg&p_aid=&p_knoten=FID&p_sprache=D&p_suchstring=12495), abgerufen am 13.09.2013
[23] (Hildebrandt & Kickbusch, 1986), S.5
[24] „Inhalte, Konzepte und praktische Maßnahmen zur Erhaltung von Gesundheit bzw. zur Verminderung von Krankheiten.“, (Röthig & Prohl, 2003), S.429
[25] vgl. (Kanning & Schlicht, 2006)
[26] vgl. (Hähne, Bilz, Dümmler, & Melzer, 2008)
[27] (Paulus, 2010), S. 544
[28] vgl. (Lampert, Mensink, Hölling, & Kurth, 2008)
[29] vgl. (Vogt & Neumann, 2007)
[30] vgl. (Lampert, Mensink, Hölling, & Kurth, 2008)
[31] (Paulus, 2010), S.599
[32] vgl. (Klieme, Fischer, Günter Holtappels, Rauschenbach, & Stecher, 2010)
[33] vgl. (Laging, Bewegungsangebote - auch mit außerschulischen Kooperationspartnern, 2008)
[34] vgl. (Fessler & Rieder, 1997)
[35] vgl. (Röthig & Prohl, 2003)
[36] (Fessler & Rieder, 1997), S.38
[37] vgl. (Fessler & Rieder, 1997)
[38] (Laspo, 2003-2013)
[39] vgl. (Stephan, 2006)
[40] vgl. (Aschebrock & Pack, 2008)
[41] vgl. (Deutschland, 2001)
[42] (Stibbe, 2004), S.180
[43] vgl. (Stibbe, 2004)
[44] (Ludwig, 1993a), S.44
[45] Moderne Ganztagsschule bedeutet, im Gegensatz zu dem in dieser Zeit in Deutschland vorherrschendem Konzept der „traditionellen Ganztagsschule“ (Unterricht von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr), dass die Schule neue Strukturelemente nach dem Vorbild der amerikanischen Ganztagsschule aufnahm und durch die Pädagogik des Reformpädagogen John Dewey (1859-1952) gestützt wurde.
[46] (Ludwig, 1993a), S.46
[47] (Ludwig, 2004), S.214
[48] vgl. (Ludwig, 2004)
[49] vgl. (Ludwig, 2004)
[50] (Ludwig, 1993a), S.48
[51] vgl. (Ludwig, 1993b)
[52] vgl. (Ludwig, 2004)
[53] vgl. (Augsburg, Lüke, & Albrecht)
[54] (Klieme E. e., 2013), S.8
[55] vgl. (Laging, 2008)
[56] (Laging, Sport in der Ganztagsschule, 2010)
[57] vgl. (Klieme E. e., 2013)
[58] (gebundene GTS)
[59] (offene GTS)
[60] (Barfknecht, 2012)
[61] (Sachsenröder, 2012)
[62] vgl. (Weier, 2010)
[63] (Klieme & Rauschenbach, Entwicklung und Wirkung von Ganztagsschule. Eine Bilanz auf Basis der StEG-Studie, 2011), S.344
[64] vgl. (Laging, Bewegt den ganzen Tag, 2008)
[65] vgl. (Laging, Bewegt den ganzen Tag, 2008)
[66] vgl. (Laging & Stobbe, 2009)
[67] vgl. (Klieme E. e., 2013)
[68] (Klieme E. e., 2013)
[69] vgl. SCHLESINGER et al. (Sportunterricht 09/2009)
[70] vgl. (LSBNiedersachsen, 2013)
[71] (Ehni, 2001), S.178
[72] vgl. (Ehni, 2001)
[73] (Woll & Bös, 2001), S.300
[74] (Franke, 3., überarbeitete Auflage 2012), S36/37
[75] “Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. (Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen.) (Weltgesundheitsorganisation WHO 1946)“ (Franke, 3., überarbeitete Auflage 2012), S.37
[76] vgl. (Becker, 2006)
[77] „Stressoren sind „Anforderungen auf, die der Organismus keine direkt verfügbaren oder automatischen adaptiven Reaktionen hat […].“ (Franke, 3., überarbeitete Auflage 2012), S.173
[78] „Das Kohärenzgefühl (›sense of coherence‹) ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind; einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu begegnen; diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engagement lohnen.“ ( (Antonovsky, 1997), S.37
[79] vgl. (Franke, 3., überarbeitete Auflage 2012)
[80] vgl. (Glassman, 2013)
[81] vgl. (Zeyer & Obermatt, 2009)
[82] vgl. (BundesamtfürGesundheit)
- Arbeit zitieren
- Idealverein für Sportkommunikation und Bildung (Hrsg.) (Autor:in)Karin Eberle (Autor:in), 2013, „Bewegte Ganztagsschule“ – wirksame Gesundheitsförderung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301583
Kostenlos Autor werden
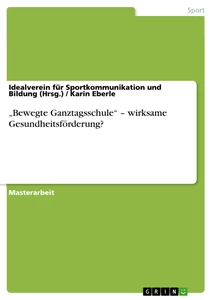
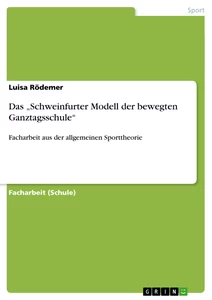


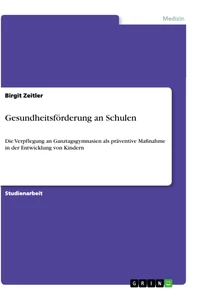

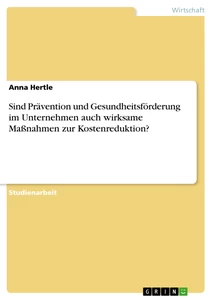

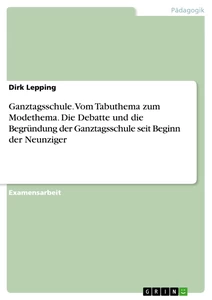
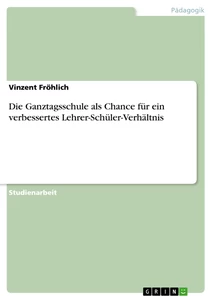


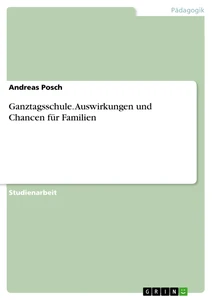

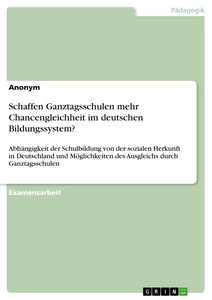
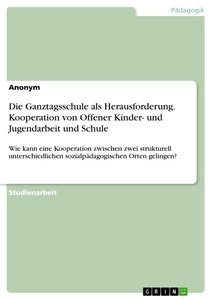
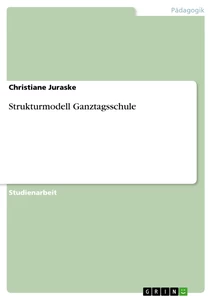

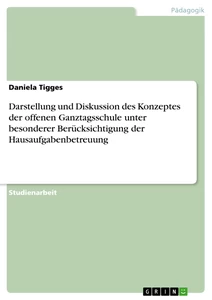

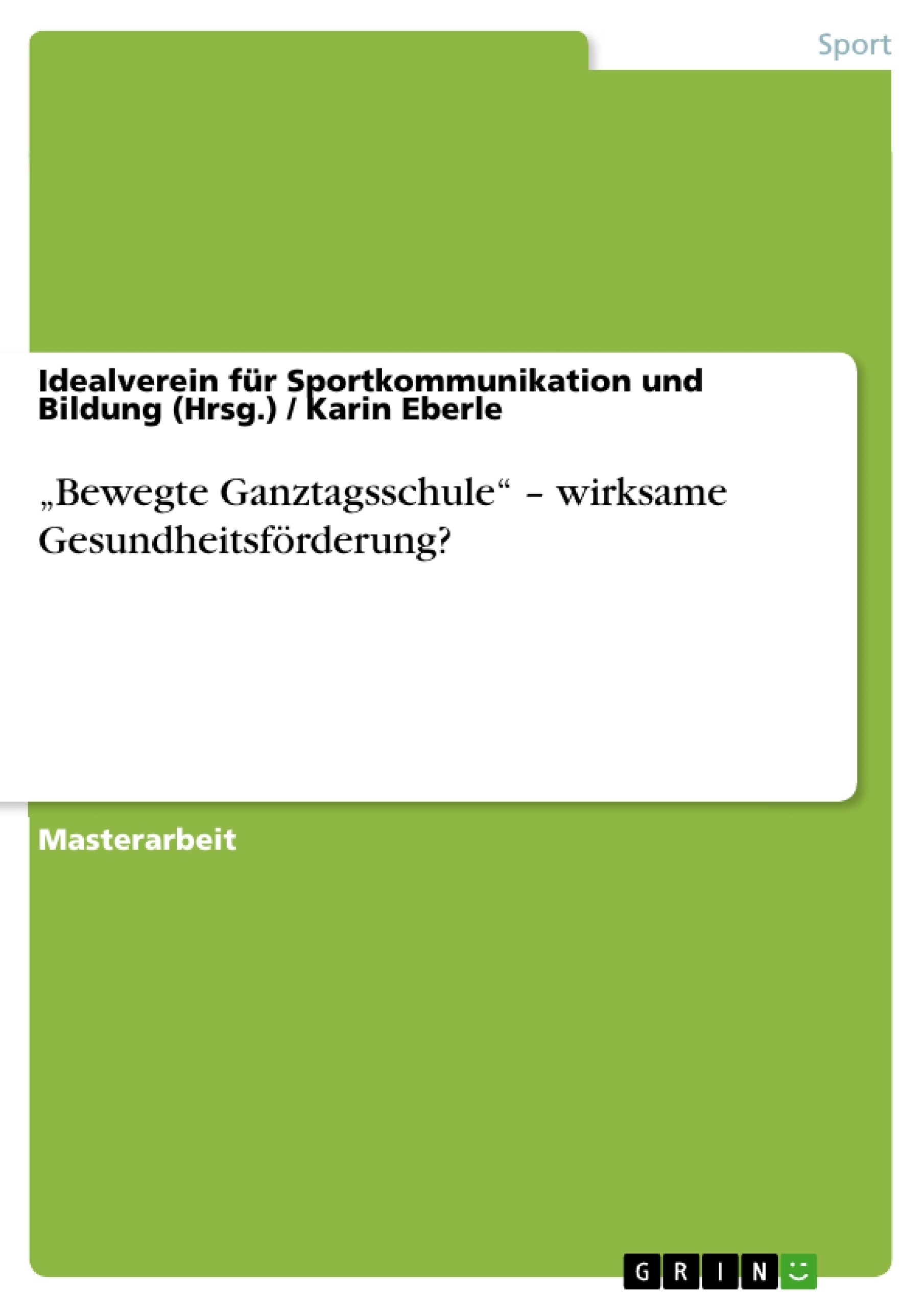

Kommentare