Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Grammatiker und ihre Regeln
2.1 Vokalzeichen
2.1.1 u, i vs. v, j
2.1.2 au, eu vs. aw, ew
2.1.3 ei, ej, vs. ey
2.1.4 ie, ih vs. i
2.2 Konsonantenzeichen
2.2.1 f, s vs. ff, ß
2.2.2 m, mm vs. mb, mp
2.2.3 tt, ll vs. t, l
3. Der Anteil der Drucker an der Rechtschreibung
4. Vergleich von Theorie und Praxis
4.1 Vokalzeichen
4.1.1 u, i vs. v, j
4.1.2 au, eu vs. aw, ew
4.1.3 ei, ej vs. ey
4.1.4 ie, ich vs. i
4.2 Konsonantenzeichen
4.2.1 f, s vs. ff, ß
4.2.2 m, mm vs. mb, mp
4.2.3 tt, ll vs. t, l
5. Zusammenfassung
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Das 17. Jahrhundert zeichnete sich durch ein großes Varianzgebot aus, was dazu führte, dass Drucke eines Werkes von einem Autor unterschiedlich ausfallen konnten, da die Drucker zum Teil selbst entscheiden konnten, wie sie bestimmte Wörter schreiben. Außerdem war es oft der Fall, dass sie nach den Wünschen ihrer Käufer druckten. Es konnte jedoch auch zu dem Fall kommen, dass Werk, Autor und sogar Drucker und Druckort übereinstimmten und sich im Laufe von ein paar Jahren die Orthographie änderte. In diesem Fall spricht man von diachronischer Varianz.
Zu diesem Wechsel in der Rechtschreibordnung haben viele Grammatiker beigetragen, die im Laufe des 17. Jahrhunderts Regeln aufstellten, wie ihrer Meinung nach richtig zu schreiben sei. Die Meinung dieser Grammatiker ging jedoch fast immer auseinander und änderte sich teilweise auch in kürzester Zeit. Hierbei stellt sich dann die Frage, ob und wenn ja, an welchen Grammatikern sich die Drucker orientierten. Dies wird auch an den vorliegenden Texten zu überprüfen sein.
Im Verlauf dieser Arbeit werde ich zunächst einen Überblick über die verschiedenen Grammatiker und ihre aufgestellten Regeln geben und einen Ausblick darauf geben, welchen Einfluss die Drucker auf die Orthographie nehmen konnten. Den Hauptteil meiner Arbeit soll dann ein Vergleich der Theorie mit der Praxis ausmachen. Als Vorlage dazu dienen zwei Drucke von 1661 und 1689 von Andreas Gryphius’ Verlibtes Gespenste. Beide Auflagen wurden in Breslau von Esaiæ Fellgibel gedruckt.
2. Die Grammatiker und ihre Regeln
Hiroyuki Takada beschreibt die Rolle deutscher Grammatiker im schriftsprachlichen Ausgleichsprozess. Er unterscheidet hierbei zwischen phonologischen, morphologischen, graphiegeschichtlichen Regeln; semantischen Regeln und syntaktischen Regeln.
In meiner Arbeit möchte ich mich jedoch auf die erste Kategorie beschränken und hierbei genau wie Takada zwischen Vokal- und Konsonantenzeichen unterscheiden.
2.1 Vokalzeichen
2.1.1 u, i vs. v, j
Die Grammatiker des 17. Jahrhunderts unterschieden zwischen den Vokalen i bzw. u und den Konsonanten j bzw. v. Um 1640 forderten Schottelius, Bellin und Zesen die Schreibung mit v bzw. j, wenn sie am Wortanfang stehen und ein Selbstlaut darauf folgt. Dem schließt sich Gueintz 1645 an. Gibert geht sogar so weit und verbietet u am Wortanfang. Harsdörffer jedoch schreibt: „und/ über/ nicht vnd/ vber/ ihn/ ihm/ nicht jhn/ jhm“ (Takada 1998: 75) und scheint mit dieser Regel der Fortschrittlichste unter den Grammatikern zu sein. Schottelius jedoch führt dann noch eine weitere Differenzierung ein. Man soll vor Vokalen j und vor Konsonanten i schreiben und kommt mit dieser Differenzierung der heutigen Rechtschreibung am nächsten. Zusammenfassend kann man sagen, dass die meisten Grammatiker die v -/ j -Schreibung bevorzugten. Nur Harsdörffer und Schottelius brachen mit dieser Tradition.
2.1.2 au, eu vs. aw, ew
Bei der Benutzung von u bzw. w am Wortende kann man eindeutig zwei Phasen erkennen. In der ersten Phase herrschte große Uneinigkeit über den Gebrauch. Während Gueintz den Gebrauch der neuen Formen -au und -eu ablehnte, erkannten viele diese Formen an, wiesen jedoch, wie z.B. Schottelius auf ihren „missbräuchlichen Gebrauch hin.“ (Takada 1998: 76) Es gab kaum einen Grammatiker, der eine eindeutige klare Regel aufstellte, bis auf Olearius. Dieser benutzte schon 1630 die Formen -au und -eu, da „das w von vielen […] ein zwiefaches u gehalten wird“ (Takada 1998: 76) und -aw und -ew so eigentlich -auu und -euu geschrieben werden müssten. Nach 1642, in der zweiten Phase, wurden die neuen Formen von allen, außer Gibert, dann hundertprozentig anerkannt. Stieler sagte dazu 1691, dass „die alte Mitstimmer aw und ew / nunmehr bey nahe und zwar billig/ ausgemustert“ (Takada 1998: 77) seien.
2.1.3 ei, ej vs. ey
Hier kann man zwei Gruppen von Grammatikern unterscheiden. Auf einer Seite Gueintz, Schottelius (1641), Bellin und Zesen, die der Regel von Werner von 1629 folgten, dass „das kleine schlechte i nicht ans ende eines wortes gesetzet“ (Takada 1998: 77) und y schreiben. Schottelius war sich seiner Vorschriften 1651 wohl schon nicht mehr so sicher und ließ ej und ey als Möglichkeit gelten. Demgegenüber stellten sich Olearius, Bellin, Pudor und Stieler. Sie schrieben die Schreibung -ei vor.
2.1.4 ie, ih vs. i
Bei der letzten Kategorie der Vokalzeichen mit der ich mich beschäftigen möchte, handelt es sich um die verschiedenen Möglichkeiten zur Kennzeichnung von Langvokalen. Olearius beschrieb 1630 drei von ihnen. Als erstes die Möglichkeit der Verdoppelung des Vokals, zweitens die Möglichkeit der Einfügung von einem e und drittens die Einfügung von einem h. Er ließ jedoch jeden für sich selbst entscheiden, welche die bessere Variante sei. Deswegen kam es auch hier zu den unterschiedlichsten Regeln.
Bellin bevorzugte die Variante der i-Dehnung durch e. Harsdörffer bezeichnete dies als Form der „Analogie“ (Takada 1998: 81), schloss sich aber nicht an. Schottelius dagegen forderte die Dehnung mit h, verwarf jedoch diese Schreibung wieder wegen dem „phonologischen Lehrsatz“ (Takada 1998: ebd.), der besagt, dass man Buchstaben, die man nicht spricht auch nicht schreiben muss. Schottelius schrieb deswegen die Schreibung mit bloßem i oder j vor, verwendete sie selbst jedoch nicht. Bellin führte später als einziger eine Differenzierung durch und schrieb bloßes i, jedoch am Wortende -ie, wie z.B. die aber diser.
In dieser Kategorie waren sich die Grammatiker wohl am Unsichersten, da die Meinungen oft geändert wurden und Schreibungen oft nur abgelehnt. Für eine einzige richtige Schreibung wurde sich selten ausgesprochen.
[...]
- Arbeit zitieren
- Juliane Lüdicke (Autor:in), 2005, Varianz im 17. Jahrhundert - Grammatik und Realität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57634
Kostenlos Autor werden





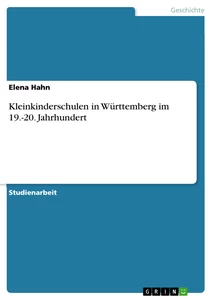

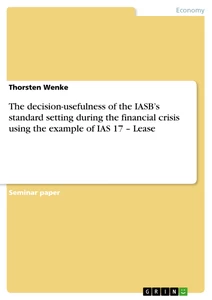





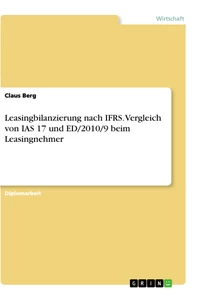
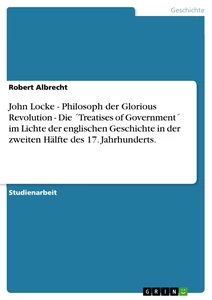




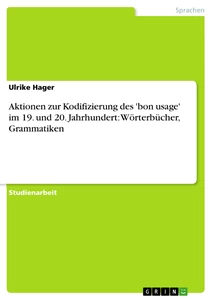
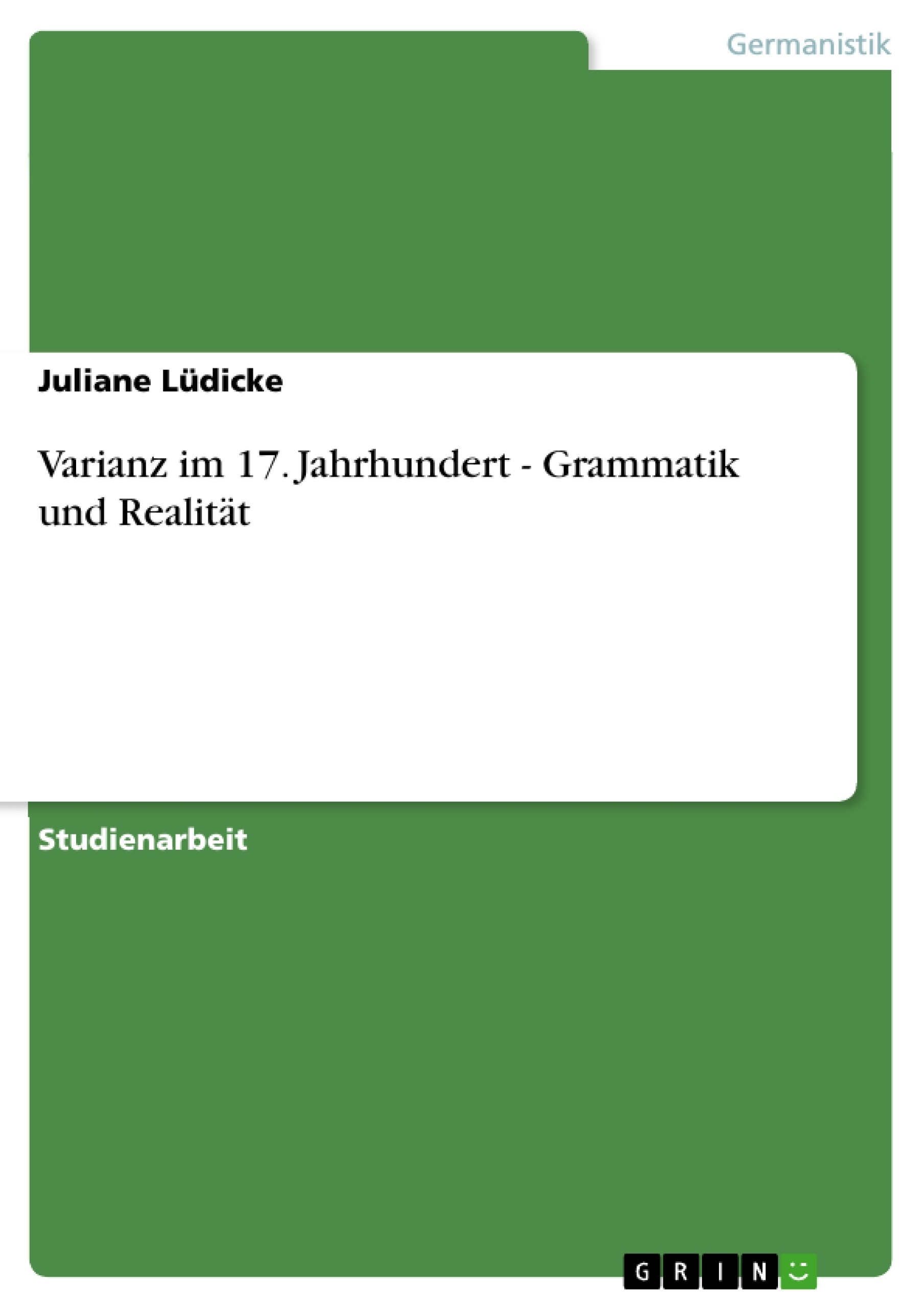

Kommentare