Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abstract
Vorwort
0. Einleitung
0.1 Erkenntnisinteresse
0.2 Thesen
1. Zum Forschungsstand
1.1 Geschlechterstereotype im interdisziplinären Kontext
1.2 Inhalte geschlechtsstereotyper Vorstellungen
1.3 Zur Abgrenzung von Stereotyp, Vorurteil und Klischee aus kognitionslinguistischer Sicht
1.4 Beitrag der Presseberichterstattung zur Etablierung und Aufrechterhaltung
1.5 Kapitelzusammenfassung
2. Informationsselektion, Perspektivierung, Evaluierung und persuasives
2.1 Informationsselektion und Perspektivierung/ Evaluierung
2.2 Informationsselektion und persuasive Aspekte
2.2.1 Persuasive Strategien
2.2.2 Formen der Ereignisdarstellung
2.2.3 Schein-Evidenz
2.2.4 Analogien
2.3 Kapitelzusammenfassung
3. Korpus
3.1 Auswahl des Textkorpus
3.2 Vorgehen
4. Formen geschlechtsspezifischer Perspektivierung und Evaluierung als Ausdruck von Stereotypen in der Presseberichterstattung
4.1 Realisierung geschlechtsspezifischer Stereotype
4.1.1 Globalstereotyp und eiserne jungfrau
4.1.2 hausfrau und sonnyboy
4.1.3 Zwischenfazit
4.2 Vorurteilsverbalisierungen
4.2.1 Eine Frau als Verteidigungsministerin?
4.2.2 Zuschreibung von Inkompetenz: kind und kavalier
4.2.3 Zwischenfazit
4.3 Geschlechtsspezifische Informationsselektion: personen- vs. themenbezogene
4.3.1 Als erste Frau…
4.3.2 und trotz der Kinder
4.3.3 Das schöne Geschlecht?
4.3.4 Zwischenfazit
4.4 Perspektivierung und Evaluierung durch männliche und weibliche
4.4.1 Darstellung von Frauen in Führungspositionen der Industrie
4.4.2 Darstellung von Politikerinnen
4.4.3 Zwischenfazit
4.5 Kapitelzusammenfassung
5. Diskussion
6. Fazit und Ausblick
7. Bibliographie
7.1 Literaturverzeichnis
Abstract
In der vorliegenden Masterarbeit wird die sprachliche Darstellung von Geschlechter-stereotypen in der deutschsprachigen Presseberichterstattung untersucht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Berichterstattung über Frauen in Führungspositionen in Politik und In-dustrie – zwei Bereiche, die stark von Männern geprägt sind, in denen sich jedoch seit gerau-mer Zeit ein Wandel abzeichnet.
Es wird herausgearbeitet, welche Perspektivierungen und Evaluierungen gegenwärtig von TextproduzentInnen in der Boulevard- sowie der seriösen Presse vorgenommen werden. Damit einhergehend werden persuasive Aspekte der Berichterstattung betrachtet. Bestandteile der Arbeit sind ein Überblick über den interdisziplinären Forschungsstand, die linguistische Einordnung der Thematik, eine terminologische Abgrenzung sowie die Analyse und Auswer-tung von Textbeispielen. Übergeordnet steht die Frage nach der potenziellen Wirkung sprach-lich inszenierter Stereotype auf die Einstellungen von RezipientInnen.
Vorwort
Die vorliegende Masterarbeit ist im Rahmen des Forschungsschwerpunktes der Kognitiven Medienlinguistik entstanden. Bei der Recherche zu Stereotypen- und Vorurteils-verbalisierungen bezüglich beruflich erfolgreicher Frauen, zeigte sich, dass die Forschung zu Geschlechterstereotypen einen umfassenden und kaum zu überblickenden interdisziplinären Gegenstandsbereich darstellt. Auch innerhalb der Linguistik beschäf-tigen sich verschiedene Strömungen mit der Thematik. Linguistische Arbeiten, die die Zusammenhänge kognitiver und sprachlicher Phänomene zu dieser spezifischen Thematik aufzeigen, gibt es bisher nur wenig. Die vorliegende Arbeit ist deshalb als anwendungs-orientierte Textanalyse zu verstehen, die eine kognitionslinguistische Einordnung des Themas ‚Geschlechterstereotype in der Presseberichterstattung‘ vornehmen will. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Zusammenhängen von Sprache und Kognition: Inwiefern spiegeln sich mental vorhandene Geschlechterstereotype in sprachlichen Realisierungen wider? Dies wird anhand einer qualitativen Analyse der Presseberichterstattung über Frauen in Führungspositionen in Politik und Industrie untersucht. Textproduktion und -ver-stehen werden als Schnittstellenbereiche mit anderen kognitiven Systemen sowie Kontextfaktoren betrachtet. Damit werden auch die soziale Funktion von Sprache sowie das Verhältnis von realitätsabbildender und -konstituierender Funktion der Presse berück-sichtigt. Die Phänomenbereiche der Perspektivierung, Evaluierung und Persuasion bilden dabei zentrale linguistische Untersuchungsgegenstände.
0. Einleitung
„Die Definition des Exzellenten steckt auf allen Gebieten voller männlicher Implikationen, deren Eigenart es ist, nicht als solche in Erscheinung zu treten. Die Definition einer Stelle, besonders einer solchen mit Machtbefug-nissen, umfasst lauter mit geschlechtlichen Konnotationen versehene Eignungen und Befähigungen. Viele Positionen sind für Frauen deshalb so schwer erreichbar, weil sie maßgeschneidert sind für Männer, deren Männlichkeit durch Entgegensetzung zu den heutigen Frauen konstruiert wurde.“ (Pierre Bourdieu)
Geschlechterforschung wird seit Jahrzehnten in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, wie in den Sozial-, Kultur-, Medien- und Kommunikationswissenschaften, der Sozialanthropologie (bzw. Ethnografie), der Psychologie oder den Gender-Studies vorangetrieben. Die linguistische Forschung zum Zusammenhang von Sprache und Geschlecht ist ebenfalls vielfältig und lässt sich bis in die 1960er Jahre zurückverfolgen. Bislang ist sie vor allem auf die Analyse des geschlechtsspezifischen Sprechens und Kommunikationsverhaltens ausgerichtet und somit Teil der Sozio- und Diskurslinguistik, der Gesprächsanalyse oder auch der Dialektologie. In diesem Zusammenhang hat sich als eigenständiger Zweig die Feministische Linguistik etabliert (s. Pusch 1983). Diese befasst sich seit Ende der siebziger Jahre mit sexistischem Sprachgebrauch und mit geschlechts-spezifischem Sprechen (s. Samel 2000: 20). Dabei spielen beispielsweise die textuelle Repräsentation der Geschlechter und die Durchsetzung einer geschlechtergerechten Sprache eine wesentliche Rolle (s. Kotthoff 2008: 2495).
Die vorliegende Arbeit grenzt sich von diesen Ansätzen dahingehend ab, dass es sich um eine deskriptive, kognitionslinguistische Betrachtung sprachlicher Realisierungen von Geschlechterstereotypen handelt. Die Kognitive Linguistik greift dabei „auf die Ergebnisse sprachpsychologischer Forschung zurück, um dem Kriterium der kognitiven Plausibilität […] gerecht zu werden“ (Schwarz 2008: 232 f.). In den Massenmedien wird die Kategorie gender, d. h. das soziale Geschlecht, fast immer bedeutsam gemacht und stereotyp inszeniert (s. Kotthoff 2008: 2515 f.). Dieser Aspekt wird anhand der Presseberichterstattung über Frauen, die gegenwärtig in hohen politischen Ämtern und Posten in der Industrie tätig sind, aus kognitionslinguistischer Perspektive untersucht. Eine durchgehende, mehr oder weniger subtile Diskriminierung von Frauen in den Medien wurde in der Vergangenheit in unterschiedlichster Hinsicht festgestellt:
„Die Diskriminierung besteht gerade sehr oft darin, wie eine Frau angeredet oder nicht angeredet wird, wie ihr Redebeitrag abgetan, nicht gehört, mißverstanden, falsch paraphrasiert, unterbrochen und ignoriert wird, wie sie lächerlich gemacht, bevormundet oder entwertet wird, und nicht zuletzt darin, wie man über sie redet“ (Trömel-Plötz 1978: 50).
Bislang wird die Darstellung von Frauen in der Presse vor allem in medien- und kommunikationswissenschaftlichen Aufsätzen (bspw. im Rahmen des media framing) thematisiert.1 Ob sich diskriminierendes Verhalten, wie es im obigen Zitat beschrieben wird, als Ausdruck von Stereotypen und Vorurteilen auch in der schriftlichen Bericht-erstattung über Frauen widerspiegelt und ob diese Feststellung gegenwärtig Bestand hat, soll in dieser Arbeit qualitativ untersucht werden. Vorurteile und stereotype Vorstellungen sind häufig die Grundlage für eine geschlechtsspezifische Diskriminierung und können laut Carlin/ Winfrey (2009: 329) durch den Einsatz von Sprache verstärkt werden. Dies wird insbesondere durch die Presseberichterstattung möglich: „Die Rezeption massenmedialer Texte kann dazu führen, dass globale Einstellungen in Form von stereotypen Pauschalurteilen, aber auch bestimmte Wertevorstellungen […] evoziert bzw. verfestigt werden […]“ (Schwarz-Friesel 2013: 233). Für den englischen Sprachraum belegen Studien, dass Medien eine geschlechtsspezifische Berichterstattung über Politikerinnen vornehmen, die über sexistischen Sprachgebrauch oder stereotype Porträtierungen hinaus geht. So bestehen bspw. Unterschiede bezüglich der Quantität, der Qualität sowie der Bewertungen durch die Medienberichterstattung, die die Glaubwürdigkeit von Wahl-kampf-Kandidatinnen beschädigen können (vgl. Aday/Devitt 2001; Banwart/Bystrom & Robertson 2003; Devitt 2002; Kahn 1994; Kahn/ Goldenberg 1991).
Auch im 2013 gewählten 18. Deutschen Bundestag sind Frauen unterrepräsentiert. 229 Frauen zogen in den Bundestag ein, was einem Anteil von 36,3 Prozent entspricht. Jedoch ist der Frauenanteil im Deutschen Bundestag damit so hoch wie nie zuvor.2 Angesichts dieser Feststellung sowie des Anbruchs der mittlerweile dritten Legislaturperiode von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dürfte außer Frage stehen, dass Frauen in der Politik eine stetig wachsende Rolle einnehmen und damit verstärkt in den Fokus der Pressebericht-erstattung geraten. Auch in Industrie und Wirtschaft nimmt die Zahl von Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten zu, wenngleich sie noch immer verschwindend gering erscheint (2013 betrug der Anteil der Frauen in den Vorständen der 200 größten deutschen Unternehmen 4,8 Prozent).3 Dabei gilt in der Berichterstattung: „Je höher das Prestige und je umfassender der Kompetenzbereich innerhalb der jeweiligen Machteliten ist, umso bedeutender wird eine Person für die Nachrichtenherstellung“ (Huhnke 1996: 62). Hinzu kommen im öffentlichen Diskurs geführte Debatten zu gesetzlichen Quotenregelungen in Unternehmensvorständen sowie verbesserten Möglichkeiten der Vereinbarung von Familie und Beruf für Mütter und Väter.
Darüber, wie die „Inszenierung“ geschlechtsspezifischer Stereotype in der Pressebericht-erstattung auf Textebene genau erfolgt, existieren aus kognitionslinguistischer Sicht bisher kaum Publikationen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine kognitionslinguistische Textanalyse der Darstellung von Frauen in Führungspositionen durch die Pressebericht-erstattung. Es soll untersucht werden, wie die Presse über Frauen berichtet, die in (vormals) männlich dominierten Arbeitsfeldern, wie Politik und Industrie, tätig sind. Dabei soll punktuell ein Vergleich zur Berichterstattung über Männer in ähnlichen Positionen erfolgen. Des Weiteren wird analysiert, ob männliche und weibliche TextproduzentInnen unterschiedliche Perspektivierungen und Evaluierungen vornehmen.
Nachfolgend wird das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit anhand spezifischer Fragestellungen und Thesen näher ausgeführt. In den Kapiteln 1 und 2 erfolgt ein Abriss über den umfangreichen interdisziplinären Forschungsstand sowie die terminologische Abgrenzung der für die bearbeitete Thematik relevanten Fachbegriffe. Nachdem der theoretische Rahmen auf diese Weise eingegrenzt wurde, finden sich in Kapitel 3 Erläuterungen zum verwendeten Korpusmaterial. In Kapitel 4 soll die Präsentation und Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Untersuchung des Korpusmaterials anhand ausgewählter Textbelege erfolgen. Abschließend werden die Ergebnisse im Diskussionsteil erörtert und im Fazit zusammengefasst.
0.1 Erkenntnisinteresse
Gegenstand dieser Arbeit ist die Frage, inwiefern Stereotype bzw. Vorurteile gegenüber Frauen in Spitzenpositionen der Politik und Industrie in Deutschland gegenwärtig verbalisiert werden: Wie spiegeln sich stereotype Konzeptualisierungen im sprachlichen Ausdruck wider? Mit welchen sprachlichen Mitteln intendieren TextproduzentInnen in dieser Hinsicht eine persuasive Wirkung, eine spezifische Einstellung bei den RezipientInnen? Die kognitionslinguistische Auseinandersetzung erfolgt mit dem Ziel, „die Konzeptualisierungsstrukturen der Sprachproduzenten zu rekonstruieren […]“ und „die Intention ihrer Verfasser (sowie das Persuasionspotenzial in Bezug auf die Rezipienten) transparent zu machen“ (Schwarz 2008: 233). In diesem Sinne wird versucht, „Sprachproduktionsdaten (als Spuren der kognitiven Aktivität der Benutzer) so zu erklären, dass sie Aufschluss über die Interaktion sprachlicher und konzeptueller Kompetenz geben“ (Schwarz 2008: 233). Es erfolgt ein punktueller Vergleich zur Berichterstattung über Männer in äquivalenten Führungspositionen.4
In diesem Zusammenhang ist relevant, welche Informationen über Frauen in Führungs-positionen durch die Presse in den Fokus gerückt und welche Perspektivierungen dabei vorgenommen werden. Finden Evaluierungen vermehrt auf der Sachebene, d. h. hin-sichtlich der geleisteten Arbeit, oder auf der persönlichen Ebene statt? Des Weiteren ist zu fragen, inwiefern männliche und weibliche JournalistInnen unterschiedliche geschlechts-spezifische Perspektivierungen realisieren und damit ggf. verschiedene Intentionen sichtbar werden.
0.2 Thesen
Es wird auf der Basis bestehender Forschung (s. Kap. 1) von der Grundannahme aus-gegangen, dass eine geschlechtsspezifische Berichterstattung in der Presse erfolgt. Darauf basieren folgende Vorüberlegungen und Thesen:
- Es werden vielfältige persuasive Strategien eingesetzt, die dazu beitragen können, dass sich Geschlechterstereotype und Vorurteile bei RezipientInnen manifestieren bzw. dass spezifische Einstellungen gegenüber bestimmten Frauen oder auch Frauen im Allge-meinen evoziert werden.
Der Einsatz persuasiver Mittel bei der Darstellung von Frauen in Führungspositionen, durch welchen Einfluss auf Einstellungen und Urteile der RezipientInnen intendiert wird, wird übergreifend (d. h. in der Boulevard- und der seriösen Presse) erwartet.5 Zu den verwendeten Strategien werden sicherlich das Berufen auf regelhafte Beziehungen (und damit der Bezug zu tradierten Geschlechterrollen), Spekulationen sowie der Gebrauch von Metaphern und Vergleichen für Evaluierungen und eine geschlechtsspezifische Charakterisierung gehören.
- Die sprachliche Realisierung von Geschlechterstereotypen unterscheidet sich sowohl zwischen der Boulevard- und der seriösen Presse, als auch zwischen männlichen und weiblichen TextproduzentInnen.
In der seriösen Berichterstattung werden sprachlich repräsentierte Vorurteile und Stereo-type hintergründig platziert und damit indirekt vermittelt. Hinsichtlich der Informations-selektion über Frauen in Führungspositionen wird angenommen, dass sich die seriöse Presse vorrangig auf die Wiedergabe sachbezogener Informationen fokussiert: Bewer-tungen werden vermutlich hinsichtlich der geleisteten Arbeit der Frauen vorgenommen und weniger auf die Person, ihren Charakter oder ihr Äußeres bezogen sein, als dies in der Boulevardpresse erwartet wird. In der Boulevardpresse werden sich größere Unterschiede zwischen den Berichten über Frauen und Männer nachweisen lassen. Das „Frau-Sein“ in hohen beruflichen Stellungen wird expliziter thematisiert und vorurteilsbehaftet sein. Es ist eine vordergründige Selektion persönlicher Informationen zu erwarten.
Des Weiteren ist zu vermuten, dass Textproduzenten andere Perspektivierungen und Evaluierungen vornehmen, als Produzentinnen. Möglicherweise werden von männlichen Journalisten geschlechtsspezifische Vorurteile in größerem Ausmaß und expliziter formuliert, da Frauen in Männerdomänen aufgrund verschiedener, teils unbewusster Faktoren (z. B. sozialisationsbedingt) eine geringere Akzeptanz erfahren. Hingegen werden Autorinnen Frauen in Führungspositionen tendenziell positiv evaluieren und versuchen, ein hohes Identifikationspotenzial für RezipientInnen herzustellen.
1. Zum Forschungsstand
In diesem Kapitel sollen die Erkenntnisse von Publikationen zusammengefasst werden, die aufzeigen, wie Frauen im Allgemeinen und insbesondere die berufstätigen durch die Presse dargestellt werden. Um linguistisch fundierte Aussagen darüber machen zu können, wie auf beruflich erfolgreiche Frauen gegenwärtig in der Presse referiert wird, ist es unerlässlich, auch die Erkenntnisse aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen zu dieser Thematik zu betrachten. Vor allem die Soziologie und Sozialpsychologie, aber auch die Medien- und Kommunikationswissenschaften befassen sich mit Geschlechterstereotypen als kognitivem Phänomen sowie in Zusammenhang mit sprachlichen Manifestationen. Diese Erkenntnisse werden in Relation zur kognitionslinguistischen Sichtweise auf die behandelte Thematik gesetzt. Auf diese Weise kann die vorliegende Bestandsaufnahme in den interdisziplinären Kontext bisheriger Forschung zu Geschlechterstereotypen und geschlechtsspezifischen Vorurteilsverbalisierungen eingeordnet werden. Zugleich wird eine Abgrenzung der unterschiedlichen Termini, die mit (Geschlechter-) Stereotypen in Verbindung stehen, vorgenommen. In diesem Zusammenhang werden interdisziplinäre Forschungsergebnisse darüber vorgestellt, welche stereotypen Vorstellungen über Frauen existieren.
1.1 Geschlechterstereotype im interdisziplinären Kontext
Der Terminus Stereotyp existiert mittlerweile seit über 90 Jahren und wurde zunächst von Lippmann (1922; 1964: 9) sehr allgemein als „Bilder in unseren Köpfen“ definiert. Huhnke (1996: 200) beschreibt geschlechtsspezifische Stereotype und Klischees aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive unter weitgehend synonymer Verwendung als Realitätssurrogate, durch die „Informationen über Frauen auf ein beschränktes Repertoire von Bildern und Vorstellungen komprimiert werden“. Stereotype bezieht sie hinsichtlich geschlechtsspezifischer Presseberichterstattung recht unspezifisch und vage auf „nicht-argumentativ begründete ‚Erzählungen‘ über soziale und politische Sachverhalte, die Frauen betreffen“ (Huhnke 1996: 200). Aus einer soziologischen Perspektive auf berufstätige Frauen stellt Kanter (1977: 232) fest, dass diese auch in Spitzenpositionen auf geschlechtsspezifische Rollen reduziert werden: „There was also a tendency to encapsulate women and to maintain generalizations by defining special roles for women, even on the managerial and professional levels […]”.
Nach Schwarz-Friesel (2013: 340) wird der Terminus Stereotyp meist generell „im sozialpsychologischen Sinne verwendet, um in einer Gesellschaft verbreitete Vor-stellungen von charakteristischen Zügen und Verhaltensweisen der Mitglieder sozialer und ethnischer Gruppen zu beschreiben“. Ein Stereotyp „hat die logische Form eines Urteils, das in ungerechtfertigt vereinfachender und generalisierender Weise, mit emotional-wertender Tendenz, einer Klasse von Personen bestimmte Eigenschaften zu- oder ab-spricht“ (Quasthoff 1973: 28). Demnach handelt es sich bei Geschlechterstereotypen um die als charakteristisch betrachteten Eigenschaften und Merkmale, die Männern und Frauen jeweils zugeschrieben werden. Diese Definition genügt zwar noch nicht dem Zweck einer kognitionslinguistischen Auseinandersetzung mit der Thematik (s. Kap. 1.2), dient aber als erste Verständnisgrundlage für die durchaus maßgeblichen Erkenntnisse aus der Sozialpsychologie.
Eine sozialpsychologische Publikation, die sich mit Geschlechterstereotypen als kogni-tivem Phänomen auseinandersetzt und deren evidenzbasierte Erfassung zusammenfasst, stammt von Eckes (2008). Er beschreibt eine „duale Natur“ von Geschlechterstereotypen: Es handelt es sich um kognitive Strukturen, die einerseits zum individuellen Wissen einer Person gehören, andererseits aber auch den „Kern eines konsensuellen, kulturell geteilten Verständnisses“ von charakteristischen Merkmalen der Geschlechter bilden (Eckes 2008: 178; s. Kap. 1.2). Geschlechterstereotype enthalten dabei deskriptive und präskriptive Informationen (im Gegensatz zu nationalen oder Altersstereotypen, welche nur deskriptive Anteile aufweisen). Bei Ersteren handelt es sich um tradierte Annahmen darüber, wie Frauen und Männer typischerweise sind (Frauen „sind“ emotional, Männer „sind“ dominant). Werden diese Annahmen durch andersartiges Verhalten verletzt, folgt daraus Überraschung. Bei präskriptiven Annahmen handelt es sich hingegen um Charakteristika, die Frauen und Männer jeweils aufweisen sollen. Aus einer Verletzung dieser Erwartungen resultiert Ablehnung oder Bestrafung (s. Eckes 2008: 178). Die präskriptiven Anteile von Geschlechterstereotypen sind nach Eckes (2008) eng verwandt mit den Geschlechter-rollen. Geschlechterrollen werden im sozialpsychologischen Sinn „allgemein als Bündel von größtenteils normativen Erwartungen, die an die Rollenträger gestellt werden“, definiert (Gern 1992: 13). Sie bestehen dabei „aus der unterschiedlichen Gewichtung in der Anwendung von Normen, nicht aber aus der Anwendung differentieller Normen […]“ (Gern 1992: 14). Ein Teil dieser Erwartungen an geschlechtsspezifische Verhaltensweisen schlägt sich folglich in der geschlechtsspezifischen Zuschreibung von Eigenschaften, d. h. in Geschlechterstereotypen nieder. Dabei können auch Berufsrollen mit Geschlechterrollen verknüpft sein. Sie „legen als spezifische Rollen fest, welche Erwartungen an die Trägerin bzw. den Träger einer Berufsrolle gerichtet sind. Beispielsweise werden von Menschen in Führungspositionen Unabhängigkeit und Führungsqualitäten erwartet – dieselben Eigen-schaften, die Männern allgemein zugeschrieben würden“ (Heß 2010: 175; s. auch Alfermann 1996: 32 ff.).
Geschlechterstereotype sind nach Eckes (2008: 178) „in hohem Maße änderungsresistent“ – Verletzungen stereotyper Erwartungen führen kaum zu einer Änderung des Stereotyps (s. dazu Prentice/ Carranza 2003). Eckes (2008) unterscheidet zwischen Stereotypen als soziokognitiven Strukturen und dem Prozess der Stereotypisierung. Dieser bezieht sich auf die Anwendung, d. h. die Übertragung, stereotypgesteuerten Wissens auf eine bestimmte Person (vgl. Kap. 1.2). Es „ist eine Frage, über Stereotypwissen zu verfügen, aber eine andere, dieses Wissen in einem bestimmten Kontext zu nutzen“ (Eckes 2008: 178). Unter bestimmten Voraussetzungen soll eine willentliche Beeinflussung dieses Prozesses der Stereotypisierung zwar möglich sein, jedoch geschieht dieser „in den ersten Augenblicken [meist, I.K.] implizit oder automatisch“ (Eckes 2008: 178). Zudem verwendet Eckes (2008) die Termini Geschlechtervorurteil und Sexismus synonym als „geschlechts-bezogene Stereotype, Affekte und Verhaltensweisen, die einen ungleichen sozialen Status von Frauen und Männern zur Folge haben“ (Eckes 2008: 179; s. dazu auch Swim/ Campbell 2001).
1.2 Inhalte geschlechtsstereotyper Vorstellungen
Ein wesentliches Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, aus sprachlichen Erscheinungsformen Rückschlüsse auf die möglichen zugrundeliegenden Stereotype zu ziehen. An dieser Stelle wird zunächst ein Überblick über diejenigen Geschlechter-stereotype gegeben, deren Vorhandensein in verschiedenen Publikationen (bspw. Eckes 2008; Huhnke 1996; Schmerl 1989; Thiele 2010) postuliert wird. Anhand authentischer Textbelege wird in Kapitel 4 untersucht, inwiefern diese Annahmen unterstützt werden können. Hierbei muss nochmals betont werden, dass sich anhand der durch Sprache zum Ausdruck gebrachten Vorstellungen und Bewertungen von den untersuchten jeweiligen Vertretern des Geschlechts, lediglich Mutmaßungen über die zugrunde liegenden Konzepte bzw. Stereotype der TextproduzentInnen anstellen lassen, da es sich dabei um nicht-beobachtbare kognitive Phänomene handelt.
Hinsichtlich der vorherrschenden Stereotype über Frauen besteht über die vergangenen Jahrzehnte hinweg ein relativ breiter wissenschaftlicher Konsens (was möglicherweise auch als Beleg dafür gewertet werden kann, dass Stereotype sich nur sehr langsam oder kaum verändern). Kasper (1979: 154 f.) dokumentiert beispielsweise, wie Geschlechter-stereotype der dame, der hausfrau oder der mutter durch Medieninszenierung zu-nehmend dem Bild der sexpuppe weichen.6 Andere Analysen verweisen vielmehr auf ein paralleles Vorhandensein unterschiedlicher Stereotype in der Presseberichterstattung. Kanter (1977: 233 ff.) unterscheidet aus soziologischer Sicht vier zentrale Stereotype, nach denen berufstätige Frauen durch männliche Kollegen und Vorgesetzte kategorisiert werden. Sie nennt diese Konzepte verführerin (seductress/ sex object), mutter (mother), kind (pet/ child) sowie eiserne jungfrau (iron maiden).7 Carlin/ Winfrey (2009) greifen die Beobachtungen der Soziologin auf und übertragen sie auf die Presse-berichterstattung über weibliche Spitzenpolitikerinnen im US-amerikanischen Wahlkampf. Sie stellen diejenigen Geschlechterstereotype heraus, die während der Wahlkampagne der US-Präsidentschaftswahlen 2008 vorherrschten und bestätigen, dass die von Kanter (1977) postulierten Stereotype auch sprachliche Manifestationsformen finden. Wird eine Frau als verführerin kategorisiert, so werden ihr entsprechende Charakteristika oder Eigenschaften zugeschrieben. Diese können Kleidung und andere Äußerlichkeiten be-treffen, aber auch das Verhalten oder Sprechen auf typisch „weibliche“ Art. Zudem gehören auch das Konzept sex-objekt sowie die öffentliche Darstellung als Opfer sexueller Belästigung in diese Kategorie (s. Carlin/Winfrey 2009: 327 f.). Die stereotype Vorstellung von der Frau als mutter kann mit positiven und negativen Assoziationen einhergehen (s. Carlin/Winfrey 2009: 328). So könnten Frauen positive Eigenschaften, wie verständnisvoll, fürsorglich oder teilnahmsvoll zugeschrieben werden, was unter Umständen – gerade auch für Politikerinnen – von Vorteil sein könne. Auf der anderen Seite können durch das mutter-Stereotyp negative Bewertungen impliziert werden, wenn beispielsweise die Kompetenz von Frauen in Spitzenpositionen durch den Verweis auf traditionelle mütterliche Pflichten in Abrede gestellt wird.8 Zudem werden Frauen mit teilweise als hinderlich gewerteter Emotionalität in Verbindung gebracht. Eine extremere Darstellung beinhaltet die Zuschreibung negativer „mütterlicher“ Charak-teristika, wie bestrafen, schimpfen oder zänkisch sein. Die Darstellung der Frau in der Rolle des kindes manifestiere sich zumeist in den Eigenschaften schwach, naiv, unselbstständig oder auch unvorbereitet. Kanter (1977: 235) vergleicht diese Zu-schreibung auch mit der Rolle der kleinen Schwester, die höchstens am Rande als „Glücksbringer“ oder „Cheerleader“ Bedeutung findet. Durch derlei trivialisierende Zuschreibungen wird Frauen unterstellt, schwierige Aufgaben nicht oder zumindest nicht ohne (männliche) Hilfe bewältigen und somit auch keine leitende Funktion in der Berufswelt einnehmen zu können (s. Carlin/ Winfrey 2009: 328). Wenn eine Frau in einer Spitzenposition viele „männliche“ Eigenschaften aufweist, kann sich das laut Kanter (1977: 236) ebenfalls nachteilig auswirken – sie wird dann der Vorstellung der eisernen jungfrau zugeordnet, die sich durch „männliche“ Verhaltensweisen in einem männlich dominierten Umfeld behaupten will. In ihrer Betrachtung verweist Kanter (1977: 236) darauf, dass eine Stereotypisierung von Frauen als verführerin oder kind den männlichen Beschützer-Instinkt anspricht. Hingegen blieben eiserne jungfrauen bei beruflichen Schwierigkeiten auf sich allein gestellt, da sie als stark und eigenständig gelten.
Eckes (2008: 179 ff.) führt ebenfalls Inhalte von Geschlechterstereotypen an, die er als seit Jahren konsistent, kulturell invariant, über die Zeit stabil und durch empirische Forschung abgesichert apostrophiert:9
„Die Forschung zu den Inhalten von Geschlechterstereotypen zeichnet seit Jahren ein klares Bild: Merkmale, die häufiger mit Frauen als mit Männern in Verbindung gebracht werden, lassen sich in den Konzepten der Wärme oder Expressivität (auch: Femininität, Gemeinschaftsorientierung, „communion“) bündeln; Merkmale, die häufiger mit Männern als mit Frauen in Verbindung gebracht werden, lassen sich mit den Konzepten der (aufgabenbezogenen) Kompetenz oder Instrumentalität (auch: Maskulinität, Selbstbehauptung, „agency“) umschreiben“ (Eckes 2008: 179)
Die Eigenschaften wärme/ expressivität bzw. kompetenz/ instrumentalität beziehen sich dabei auf ein Globalstereotyp für das jeweilige Geschlecht. Damit decken sich die Annahmen mit der Beobachtung von Jamieson (1995: 16), wonach Frauen, die als feminin wahrgenommen werden, zugleich als inkompetent gelten; kompetente Frauen würden hingegen als unfeminin beurteilt. Daneben gibt es Hinweise auf das Vorhandensein einiger Substereotype, die sich z. T. mit den Erkenntnissen von Kanter (1977) decken. Demnach wurden die Konzepte hausfrau, bunny, karrierefrau und emanze als inhaltlich voneinander abgesetzte Substereotype identifiziert (s. Eckes 2008: 182; s. auch Carpenter/ Trentham 1998; Coats/ Smith 1999; Eckes 1994, 1997). Dabei stünden vor allem die Merkmalszuschreibungen für karrierefrau (selbstbewusst, kühl, dominant) und emanze (politisch links, tritt für frauenrechte ein) konträr zum Globalstereotyp (s. Eckes 2008: 182). Dies führe jedoch nicht zu einer Invalidität des Globalstereotyps, das eher unverändert bleibe (s. Eckes 2008: 182; vgl. Richards/ Hewstone 2001; Wänke/ Bless/ Wortberg 2003).
Fiske et al. (2002) beschreiben eine Taxonomie von Geschlechterstereotypen (stereotype content model) hinsichtlich der Eigenschaften wärme und kompetenz:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle: Taxonomie der Geschlechterstereotype (entn. aus Fiske et al. 2002: 881)
Demnach sind paternalistische Stereotype über Frauen „Ausdruck dessen, wie Frauen aus männlicher Sicht sein sollten. Da diese Stereotype […] Anteile besitzen, die von vielen Frauen und Männern positiv bewertet werden, fördern die damit kommunizierten Verhaltenserwartungen die Übernahme traditioneller Rollen durch Frauen; zugleich können sich Männer selbst als relativ frei von sexistischen Tendenzen wahrnehmen“, da sie Frauen positiv bewerten (Eckes 2008: 182 f.). Die neidvollen Stereotype (karriere-frau/ eiserne jungfrau) tragen trotz gegensätzlicher Inhalte „ihrerseits zur Aufrecht-erhaltung der Geschlechterhierarchie bei: Sie liefern (wieder aus männlicher Sicht) eine Rechtfertigung für fortgesetzte Diskriminierung von Frauen“ (Eckes 2008: 183). Diese werden, sofern sie „in traditionell von Männern dominierten Berufen Erfolg haben, als bedrohliche […] Konkurrentinnen wahrgenommen, die in ihre Schranken zu verweisen seien. Negative Merkmalszuschreibungen, wie […] sozioemotionale Kälte, verstärken derartige Einschätzungen noch“ (Eckes 2008: 183).
Die vorliegende Arbeit soll einen linguistischen Beitrag leisten, indem aufgezeigt wird, inwieweit die beschriebenen kognitiven Strukturen und Prozesse auf sprachlicher Ebene manifestiert sind. Dies geschieht mit Blick darauf, ob sich die postulierten Stereotype sowie deren Beständigkeit bestätigen lassen. Im Großteil der bisher betrachteten Publikationen wird eine weitgehend uneinheitliche Terminologie verwendet. Die Literatur enthält vielfältige Bezeichnungen, wie Geschlechterrolle, Geschlechterstereotyp, Rollen-stereotyp, Rollenbild, Berufsrolle oder Sexismus, denen häufig keine präzise Definition zugrundegelegt wird. Zudem wird, gerade in älteren Publikationen, nicht (oder nicht aus-reichend) zwischen kognitiven und sprachlichen Phänomenen differenziert. Im folgenden Kapitel soll deshalb eine einheitliche, kognitionslinguistische Terminologie für diese sprachlichen und nicht-sprachlichen Phänomene erläutert werden, auf welcher die nachfolgende Korpusanalyse basiert.
1.3 Zur Abgrenzung von Stereotyp, Vorurteil und Klischee aus kognitionslinguistischer Sicht
Die in der Kognitiven Linguistik etablierte Unterscheidung zwischen nicht-beobachtbaren, kognitiven Phänomenen und beobachtbaren sprachlichen Ausdrucksweisen findet in vielen Untersuchungen (z. B. Kanter 1977; Huhnke 1996; Carlin/ Winfrey 2009) nur unzu-reichend statt. Es muss zwischen Stereotypen als mentalen Repräsentationen und den sprachlichen Manifestationen dieser Repräsentationseinheiten differenziert werden (s. Schwarz-Friesel 2013: 340).10
Das im Langzeitgedächtnis (LZG) gespeicherte Wissen wird in Form von Konzepten und Konzept-Relationen repräsentiert (s. bspw. Bourne 1974). Stereotype existieren dort als geistige Type- bzw. Klassenkonzepte. Sie beziehen sich auf Klassen von Referenten, z. B. frau oder mutter. Ein Token- bzw. Individuenkonzept repräsentiert hingegen einen einzelnen Vertreter, z. B. die geistige Vorstellung von einer bestimmten Frau, wie der eigenen Mutter oder Angela Merkel (vgl. Schwarz-Friesel 2013: 38). Die Speicherung von Klassenkonzepten ist nur über die Abstraktion möglich. Eine zunehmende Abstraktion (d. h. eine unvollständige Repräsentation von Erlebtem) führt zu zunehmender Kategorisierung von Repräsentationen (s. bspw. Rösler 1984). Kognitive Prozesse laufen möglichst ökonomisch ab. Neue Sachverhalte werden leichter verarbeitet, wenn sie zu bereits bekannten Sachverhalten bzw. geistigen Vorstellungen in Beziehung gesetzt werden können. In diesem Sinn dienen Kategorisierungen „sowohl der Orientierung in der Welt als auch der effizienten Weltwissensspeicherung.“ (Schwarz-Friesel 2013: 37 f.).
Zusammengefasst sind Stereotype mentale Repräsentationen, welche die als charak-teristisch betrachteten Merkmale einer Person oder einer Gruppe abbilden (s. Schwarz-Friesel/ Reinharz 2013: 107). Für das Konzept frau könnten beispielsweise die Kern-informationen mensch, weiblich angenommen werden. Daneben enthält das Konzept zusätzliche charakteristische, stereotype Eigenschaften, die interindividuell variieren können: Bei einem Sprachbenutzer könnten z. B. die konzeptuellen Merkmale ist emo-tional, friedfertig, zurückhaltend, bei einem anderen hingegen ist kommunikativ, sozial oder auch ist zänkisch, hysterisch vorherrschen. Zudem existieren unterschied-liche Klassenkonzepte, die sich im semantischen Feld frau mit der gemeinsamen Eigenschaft weiblich subsumieren lassen.11 Die Kerneigenschaften von mutter könnten z. B. weiblich, hat kind geboren, die von hausfrau weiblich, geht unvergüteter tätigkeit im haushalt nach, lauten. Diese Konzepte stehen also in semantischer Rela-tion, unterscheiden sich jedoch aufgrund der Zuschreibung verschiedener stereotyper Eigenschaften voneinander.
Das Vorhandensein von Stereotypen ist nicht per se als negativ zu werten. Ein relevanter Aspekt ist aus linguistischer Sicht jedoch, dass „sich bei den meisten Stereotypen ein Missverhältnis zwischen Bedeutungs- und Refe-renzebene [ergibt, I.K.]: Die Bedeutungsrepräsentationen mit ihren mentalen Attributen werden den tatsächlichen Referenten nicht gerecht. Bei der Stereo-typbildung werden die Vielfalt, die Heterogenität innerhalb einer Gruppe weitgehend missachtet, die Individualität des Einzelnen außer Acht gelassen“ (Schwarz-Friesel 2013: 341).
Bei einem Stereotyp, das eine negative Wertung enthält, handelt es sich um ein Vorurteil (z. B. Frauen sind zu emotional für eine Führungsposition). Vorurteile können damit als Teilmenge von Stereotypen betrachtet werden (s. Schwarz-Friesel/ Reinharz 2013: 108; Schwarz-Friesel 2013: 341). Sie sind individuelle, innere Einstellungen gegenüber Personen, Objekten oder Sachverhalten. Dieser Aspekt grenzt Vorurteile von Klischees ab (s. Schwarz-Friesel/ Reinharz 2013: 109). Im Gegensatz zum Vorurteil ist ein Klischee personenunabhängig. Es ist „überindividuell und Bestandteil des kollektiven Wissens einer Gesellschaft“ (Schwarz-Friesel/ Reinharz 2013: 109). Daher kann das Klischee als spezifischer Subtyp des Stereotyps gelten. „Klischees sind spezifische, schablonenhafte und von bestimmten kulturellen Erfahrungen geprägte Konzeptualisierungen von Personen, Dingen oder Sachverhalten, die in einer Gemeinschaft als bekannt vorausgesetzt werden können“ (s. Schwarz-Friesel/ Reinharz 2013: 109).12 Als Beispiele für solch allgemeine, überindividuelle Vorstellungen ließe sich das Klischee von der Liebe auf den ersten Blick nennen oder, dass der beste Wein aus Frankreich stamme und Frauen nicht einparken könnten.
Hieran zeigt sich jedoch auch die Schwierigkeit in der terminologischen Abgrenzung: Was bei einer Person zur individuellen und in einer Gemeinschaft zur überindividuellen Vorstellung zählt, lässt sich nicht eindeutig ermitteln. Vor allem in Texten der Presseberichterstattung lässt sich nur schwer unterscheiden, ob TextproduzentInnen ein individuelles Vorurteil oder ein überindividuelles Klischee ausdrücken. So kann es sich bei Frauen können nicht einparken einerseits um ein Klischee handeln, von dem eine kulturelle Gemeinschaft Kenntnis besitzt – unabhängig davon, ob ihre Mitglieder die Ansicht teilen oder nicht. Es kann aber auch ein individuelles Vorurteil sein, eine Einstellung, die eine Person Frauen gegenüber hat. Die Bekanntheit von Klischees variiert also zwischen Sprachbenutzern. Auch bei den durch die Presse zum Ausdruck gebrachten Stereotypen kann es sich um individuelle Vorurteile oder überindividuelle Klischees handeln. Gerade hinsichtlich der Geschlechterstereotype ist eine eindeutige Abgrenzung zwischen mentalen Phänomenen wie Stereotypen, Vorurteilen und Klischees nicht immer möglich. Zwischen ihnen gibt es Überschneidungen sowie graduelle Übergänge (s. Schwarz-Friesel/ Reinharz 2013: 107). Anhand von (1) lässt sich die Problematik veranschaulichen.
(1): Ursula von der Leyen vor dem Bundestag. Ministerin umgarnt Soldaten
(sz.de, 16.01.2014, Thorsten Denkler)
Mit der Überschrift Ministerin umgarnt Soldaten werden stereotype Eigenschaften des Konzepts verführerin (s. Kap. 1.2) auf von der Leyen übertragen und verbalisiert (umgarnt). Unklar ist, ob damit ein Vorurteil mit negativ wertender Tendenz oder sogar eine (implizite) positive Wertung zum Ausdruck gebracht wird. Dies ergibt sich teilweise aus Ko- und Kontextfaktoren der sprachlichen Äußerung. Berücksichtigt werden muss zudem, dass die produzentInnenseitige Intention (bspw. Wiedergeben eigener Ein-stellungen, Persuasion des Lesers) und die rezipientInnenseitige Wirkung eines Textes nicht zwangsläufig kongruent sind.
Aufgrund der teilweise problematischen Abgrenzung werden in der vorliegenden Arbeit die Termini Stereotyp und Vorurteil (ohne eine differenziertere Berücksichtigung von Klischees) verwendet. Dies geschieht unter der Annahme, dass es hinsichtlich der potenziellen Persuasion eines Lesers und der Beeinflussung und Manifestierung emotionaler Einstellungen gegenüber Frauen unerheblich sein dürfte, ob eine individuelle oder überindividuell verbreitete Vorstellung sprachlich realisiert wird. Beide Formen könnten zur Folge haben, dass bestimmte Perspektivierungen und Bewertungen von RezipientInnen internalisiert werden. Auf Grundlage der erläuterten Literatur (s. Kap. 1.2) werden folgende Stereotype festgehalten, deren Vorkommen in der Presseberichterstattung über Frauen in Führungspositionen untersucht werden soll:13
Globalstereotyp:
frau (sozial/ emotional/ kommunikativ…)
Substereotype:
mutter (warmherzig/ fürsorglich/ aufopfernd/ tadelt/ bestraft/ verbietet …)
hausfrau (kümmert sich/ kocht/ putzt/ räumt auf/ ist zänkisch/ zetert/ braucht versorger …)
verführerin/ sex-objekt/ bunny (aufreizend/ attraktiv/ offensiv …)
eiserne jungfrau/karrierefrau (willensstark/ kämpferisch/ unabhängig/ emotionsarm/ emanzipiert …)14
kind (schutzbedürftig/ unselbstständig/ hilflos/ naiv/ artig/ frech/ aufgeweckt …)
In ihrer sprachlichen Ausprägung können (müssen jedoch nicht) die Eigenschaften mit einer positiven oder negativen Evaluierung einhergehen (s. Kap. 2). Geschlechter-stereotype können ausgedrückt werden, indem sie auf eine bestimmte Person bezogen und verbalisiert werden. So können einer Politikerin in einem Pressebericht Eigenschaften von hausfrau zugeschrieben werden, wie bspw. in (2):
(2) Von der Leyen mistet bei der Bundeswehr aus – Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) räumt bei der Rüstung auf. (bild.de, 10.01.2014, Hanno Kautz)
In diesem Fall überträgt der Textproduzent die Eigenschaften des Klassenkonzepts hausfrau auf das Individuenkonzept von der leyen. Aus kognitionslinguistischer Sicht relevant ist, wie sich Konzeptualisierungen (als mentale Repräsentationen der Produzen-tInnen) auf unterschiedliche Weise verbal widerspiegeln. „Auf der Ebene der Konzeptua-lisierung steuern nicht nur kognitive, sondern auch emotionale Komponenten maßgeblich die mentale Repräsentation eines Sachverhalts […]“ (Schwarz-Friesel 2013: 213). Mit der Referenzialisierung erfolgt die sprachliche Kodierung einer Konzeptualisierung – eine spezifische Sachverhaltsdarstellung – mittels Sprache (s. Schwarz-Friesel 2013: 213).15 Auf das Konzept frau mit der Zuschreibung emotional könnte auf Satzebene beispiels-weise folgendermaßen referiert werden:
(3) Nur eine Frau kann so feinfühlig zwischen zwei Parteien vermitteln.
(4) Als Frau ist sie viel zu emotional, um in diesem Streit zu schlichten.
(5) Frauen heulen doch bei jeder Kleinigkeit!
Dabei lässt (3) eine positive Bewertung der zugeschriebenen Eigenschaft emotional erkennen, (4) beinhaltet eine tendenziell negative Wertung, (5) ist eindeutig negativ evaluierend (s. auch Kap. 2). Die Evaluierung kann, wie in (3) und (4) direkt über ent-sprechende Lexeme (feinfühlig, emotional) oder, wie (5) indirekt (heulen bei jeder Kleinig-keit) vorgenommen werden.
1.4 Beitrag der Presseberichterstattung zur Etablierung und Aufrechterhaltung
von Geschlechterstereotypen
Seit den 1960er Jahren beschäftigen sich die Geisteswissenschaften kontinuierlich mit der zunehmend als gesellschaftliches Problem betrachteten Ungleichbehandlung von Frauen und Männern. Dabei stehen vor allem die Diskrepanz und Wechselwirkung zwischen mediengeschaffenen Rollenbildern und der gesellschaftlichen Lebenswirklichkeit der Frauen im Fokus. In dieser Zeit wurde die Erkenntnis bedeutsam, dass „die Kategorie „Geschlecht“ weniger biologischer Parameter, sondern eine weitgehend sozial determinierte Kategorie ist“ (Reiss 2010: 751) und dass die Art und Weise, wie Sprache verwendet wird, auch einen maßgeblichen Einfluss auf geistige Einstellungen hinsichtlich der Geschlechter haben müsse (s. Reiss 2010: 751).
Die Medien spielen also als soziokulturelle Einflussquelle eine große Rolle bei der Entwicklung und Manifestierung von Geschlechterstereotypen (s. Eckes 2008: 180). „Die Manifestation des Status quo der Genderhierarchie wird auf der Ebene von Sprache vollzogen, insofern Sprache als wirklichkeitskonstruierende Instanz verstanden wird“ (Reiss 2010: 751).16 Mit diesen Erkenntnissen einhergehend, hat auch die Forschung zu Frauenbildern in den Massenmedien ihren „Ursprung in der neuen Frauenbewegung, die herausstellte, dass zum einen die mediale Stereotypisierung von Frauen und zum anderen die medial vermittelte Reduzierung der Frauenrolle auf Elemente wie Mutterschaft, Er-ziehung und Hausarbeit der gesellschaftlichen Gleichstellung der Geschlechter entgegen-wirkt“ (Heß 2010: 75 f.).
Holzer (1967) analysiert z. B., wie die „emanzipierte“ Frau in Zeitungen und Zeit-schriften dargestellt wird. Er konstatiert, dass die Presse diesen beginnenden gesellschaftlichen Wandel durch subtil eingesetzte sprachliche Mittel und Bericht-erstattungsstrategien abzuwehren versucht (s. Holzer 1967: 220). Oberflächlich wird der Wunsch nach Gleichberechtigung und Emanzipation zwar aufgegriffen. Dies geschieht jedoch nur, um eine subtile „Propaganda für die weibliche Subordination“ (Holzer 1967: 216) zu betreiben, durch welche den Leserinnen suggeriert wird, dass auch unabhängige Frauen im Grunde das häusliche Glück suchen (s. Holzer 1967: 234).
In einer vergleichenden Langzeitbetrachtung der Darstellung von Frauen in Illustrierten zwischen 1953 und 1972 kann Hagena (1974) kaum einen qualitativen Wandel feststellen. Sie bemerkt allenfalls einen leichten Trend zur Abkehr von der absoluten Fixierung auf die Familie (s. Hagena 1974: 337). Insgesamt werden jedoch vorherrschende Rollen-stereotype bestätigt (s. Hagena 1974: 379). Durch die Berichterstattung der Medien würden gesellschaftliche Konflikte von Frauen auf „individuelle Lebensprobleme“ verkürzt, wodurch die Rezipientin nicht in der Lage sei, die gesellschaftlich relevante Dimension ihrer persönlichen Konfliktlage zu erkennen (Ulze 1977: 214 f).
In den 1980er Jahren gerät die Berichterstattung einiger Zeitungen und Zeitschriften über Frauen verstärkt in die Kritik. Vor allem Der Spiegel, der Stern aber auch Die Zeit finden in verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten immer wieder negative Erwähnung. So wird insbesondere den Spiegel-Autoren vorgeworfen, dass sie „ein nahezu albernes Bild“ (Spieß 1988: 137) von emanzipierten Frauen entwerfen.17 „Die ernste und wichtige Welt wie Politik und Wirtschaft spielt keine vergleichbare Rolle“ (Spieß 1988: 127). In den Presseberichten der 1950er bis 1970er Jahre werden erfolgreiche und von Männern unabhängige Frauen zunehmend mit dem Makel sexueller Freizügigkeit assoziiert und sexistische Darstellungen verstärkten sich in dieser Zeitspanne (s. Huhnke 1996: 23).
Die negative Be- und Verurteilung unabhängiger Frauen geschieht durch die Presse dahin-gehend, dass sie ihre Lebensweisen als egoistisch darstellt (s. Becker 1963: 438). Die traditionellen Moralvorstellungen seien sexistischen Vorstellungen „mit libertärem An-strich“ gewichen (Huhnke 1996: 24). Sexistischen Sprachgebrauch definieren Trömel-Plötz et al. (1980) wie folgt:
„Sprache ist sexistisch, wenn sie Frauen und ihre Leistung ignoriert, wenn sie Frauen nur in Abhängigkeit von und Unterordnung zu Männern beschreibt, wenn sie Frauen nur in stereotypen Rollen zeigt und ihnen so über das Stereotyp hinausgehende Inte-ressen und Fähigkeiten abspricht, und wenn sie Frauen durch herablassende Sprache demütigt und lächerlich macht“ (Trömel-Plötz et al. 1980: 15).
Eine Studie von Schmerl (1989) zur quantitativen und qualitativen Darstellung von Frauen in der Presse hat gezeigt, dass das Ressort Politik durch Berichterstattung über Männer dominiert wird. Frauen würden auf die Rubriken Kultur, Klatsch, Prominenz und Unterhaltung abgedrängt (s. Schmerl 1989: 40). Der Deutsche Journalistenbund fasst es in einem Bericht von 1990 ähnlich zusammen: „Frauen sind Wesen, die äußerst selten vorkommen, und wenn, dann sind sie dekorativ, nackt oder Opfer, begleiten Männer, gewinnen Preisausschreiben, werden vergewaltigt oder dringen hier und dort mal in Männerdomänen ein“. Es wird darin weiterhin festgestellt, dass insbesondere das Hamburger Abendblatt Frauen subtil diffamiere. Die taz berichte zwar kontinuierlich über Frauen, jedoch wird dies als eine Art der Aussonderung gewertet – Frauen würden als Exotinnen wahrgenommen, ihr Denken als Ausnahme aufgefasst.
Auch Schmerl (1989: 44) vermutet eine durchgehende, subtile „Andersbehandlung“ von Frauen durch spezifische Strategien der „Annihilierung und Trivialisierung“. Dies geschehe beispielsweise, wenn typisch weibliche Schwächen oder Stärken der Charakterisierung einer Politikerin dienen – oftmals Beschreibung von Äußerlichkeiten – wie am Beispiel der Berichterstattung über Margaret Thatcher verdeutlicht wird. Schmerl (1989: 50 f.) stellt eine „recht bösartig[e]“ Berichterstattung insbesondere durch Die Welt und den Spiegel fest. Dies geschehe jedoch nicht direkt, sondern durch latente Wertungen. Vor allem Der Spiegel zeichne sich durch Häme und „Inszenierung ins Lächerliche“ aus. Zudem „demonstrieren die Illustrierten an exotischen […] Einzelfällen die ‚gelungene‘ Emanzipation, andererseits wird der normalen Hausfrau oder Berufstätigen signalisiert, daß ihr das kaum widerfahren kann und wird. Z. B. ist in vielen Geschichten über ‚ausbrechende‘ […] Frauen die Moral, daß sich dies nicht lohnt und sie reumütig in ihre geordneten (Ehe-) Verhältnisse zurückkehren“ (Schmerl 1989: 53). Die subtilen Strategien der Presse bezeichnet sie als folgenreicher, als eine offen tendenziöse „Meinungsmache“ (Schmerl 1989: 52). Pusch (1990) untersucht erstmals verschiedene journalistische Techniken, mit deren Hilfe Geschlechterstereotype inszeniert werden. Durch den Vergleich von Frauen- und Männerporträts stellt sie, vor allem im Spiegel, eine „Heldenverehrung und Frauenverunglimpfung“ (Pusch 1990: 190) fest. Der Zeit des Jahrgangs 1989 attestiert sie die „gröbsten“ Sexismen. Neuere wissenschaftliche Studien konstatieren, „dass Frauen heutzutage in den Medien nicht mehr generell annulliert sind. […] Allerdings ist ihre Rolle als Politikerinnen, Expertinnen und Funktionärinnen immer noch marginalisiert“ (Heß 2010: 78).
1.5 Kapitelzusammenfassung
Vor allem durch sozialpsychologische Ansätze konnten in der jüngeren Vergangenheit Geschlechterstereotype als mentale Phänomene erfasst werden, die sich als relativ beständig und kulturell invariant erwiesen haben (für einen Überblick s. bspw. Eckes 2008). Im Vordergrund stehen stereotype Vorstellungen der hausfrau, mutter, karrierefrau/ eisernen jungfrau, verführerin/ bunny sowie des kindes. Die empirisch belegten Erkenntnisse decken sich größtenteils mit medien- und kommu-nikationswissenschaftlichen Untersuchungen hinsichtlich geschlechtsspezifischer Presse-berichterstattung. Die aufgeführten Studien lassen keine terminologische Abgrenzung zwischen Stereotypen und Vorurteilen erkennen (s. Kap. 1.3). So wurde bisher nicht präzise festgestellt, inwieweit neben gängigen Stereotypen auch geschlechtsspezifische Vorurteile mit negativen Wertungen durch die Berichterstattung vermittelt werden. Die Darstellung von beruflich erfolgreichen, unabhängigen Frauen in der Presse wird bis in die 1990er Jahre als oberflächlich und nur scheinbar liberal gewertet. Es kann kaum ein Wandel hin zu einer gleichwertigen Berichterstattung über Frauen und Männer belegt werden (s. bspw. Hagena 1974; Holzer 1967; Huhnke 1996). Frauen werden subtil diskriminiert und stereotype Geschlechterrollen in der Presseberichterstattung immer wieder aufgegriffen und manifestiert (s. bspw. Huhnke 1996; Pusch 1990; Schmerl 1989). Dieses Vorgehen wird auch vermeintlich seriösen Zeitungen, wie der Zeit, attestiert. Besonders hervorgehoben wurden Diffamierungen von Frauen in der Welt, dem Spiegel und dem Focus.
Huhnke (1996: 35) merkt an, dass dezidierte Textanalysen fehlen, um zu beantworten, „wie, nämlich mit welchen journalistischen Strategien und sprachlichen Realisierungen“ geschlechtsstereotype Vorstellungen bei RezipientInnen forciert beziehungsweise mani-festiert werden. Eine solche Analyse soll in der vorliegenden Arbeit durchgeführt werden. Die Betrachtung beschränkt sich dabei nicht ausschließlich auf textinterne Zusammen-hänge, sondern bezieht auch textexterne Aspekte der Analyse von Presseberichten ein (s. Kap. 2.2). Dabei spielen produzentInnenseitige Intentionen, die potenzielle Wirkung auf RezipientInnen sowie die realitätskonstituierende Funktion der Berichterstattung eine Rolle. Im folgenden Kapitel werden gezielt diejenigen textlinguistischen Aspekte erläutert, hinsichtlich derer die Analyse des Korpusmaterials (Kap. 4) vorgenommen wird.
2. Informationsselektion, Perspektivierung, Evaluierung und persuasives
Potenzial
Die Informationsselektion und die daraus resultierenden Möglichkeiten der Perspekti-vierung und Evaluierung in Presseberichten sind ein wesentlicher Aspekt für die Beantwortung der Frage, mithilfe welcher linguistischen Mittel geschlechtsspezifische Stereotype realisiert werden. Die Aufgabe der Presseberichterstattung „besteht darin, die Stimuli und Ereignisse in der sozialen Umwelt zu selektieren, zu verarbeiten, zu interpretieren.“ (SCHULZ 1989: 142). In massenmedialen Texten findet meist eine selektive Auswahl von Informationen statt: Sachverhalte „werden kaum je umfassend geschweige denn neutral und objektiv berichtet, sondern aus einem spezifischen Blickwinkel, durch den bestimmte Aspekte fokussiert und andere ausgeblendet werden“ (Skirl 2012: 342). BUCHER (1992: 260) konstatiert, das teilweise eine Absicht besteht, durch eine gezielte Berichterstattung Einfluss auf die Einstellungen und Urteile von LeserInnen zu nehmen.18
Informationsselektion kann hinsichtlich verschiedener Aspekte erfolgen. Das Weglassen bzw. Reduzieren oder das Hinzufügen bzw. Konstruieren von Informationen sowie Spekulationen sind maßgebliche Faktoren. Sie können für die Komplexität und Detailliertheit eines Berichts sowie für die Charakterisierung einer Person entscheidend sein. Durch die Auswahl und die Strukturierung von Informationen, lassen sich geschlechtsspezifische Perspektivierungen sowie implizite oder explizite Evaluierungen sprachlich realisieren. Diese stellen ein Emotionspotenzial bereit, das bei RezipientInnen zu einer Emotionalisierung und damit auch zu einer spezifischen (emotionalen) Einstellung bzw. Überzeugung führen kann (jedoch nicht zwingend muss, s. SCHWARZ-FRIESEL 2013: 214 f.).19 In dieser Hinsicht ist auch der Aspekt der (mehr oder weniger bewussten) intentionalen Persuasion aufseiten der TextproduzentInnen zu berücksichtigen:
„In diesem Zusammenhang scheint lediglich problematisch, dass die Mehrzahl der Medienkonsumenten nicht sensibel für die Perspektivierungen und Evaluierungen in der Berichterstattung scheint, da die Massenmedien sie selbst nicht als solche herausstellen. Die Leser […] erwarten nach wie vor eine objektive Darstellung […], auf die sie als Laien angewiesen sind. Dadurch entsteht eine Abhängigkeit von der medialen Berichterstattung, die intentional von massenmedialen Institutionen genutzt werden kann, um bestimmte Einstellungen […] zu formen und zu festigen“ (Peters 2013: 174).
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist besonders relevant, inwiefern durch die Selektion bestimmter geschlechtsspezifischer Informationen stereotype Vorstellungen aufrechter-halten sowie Vorurteile gegenüber Frauen verbalisiert werden können. Die Zusammen-hänge von Informationsselektion, Perspektivierung und Evaluierung sowie der Aspekt der Persuasion werden im Folgenden erläutert.
2.1 Informationsselektion und Perspektivierung/ Evaluierung
Die Perspektivierung wird von Skirl (2012: 335) als eine „Grundkategorie für Texte der öffentlichen Kommunikation“ bezeichnet. Durch eine gezielte Selektion von Informationen lassen TextproduzentInnen „eine bestimmte Perspektive in die verbale Sachverhaltsrepräsentation einfließen“ (s. Schwarz-Friesel 2013: 214). Sie nehmen damit eine Perspektivierung vor, d. h. ein spezifischer Blickwinkel auf eine Person oder einen Sachverhalt wird zum Ausdruck gebracht. Perspektivierungen lassen sich aus der Informationsselektion und -strukturierung sowie aus der Wahl der sprachlichen Mittel auf lexikalischer und syntaktischer Ebene ableiten. Sie basieren auf den jeweiligen Konzeptualisierungen der TextproduzentInnen (s. Skirl 2012: 342). Es besteht die Möglichkeit einer mono- oder multiperspektivischen Darstellung. Dabei können die Perspektiven der TextproduzentInnen selbst, aber auch Perspektiven von Dritten (Beteiligten, Experten etc.), von Gruppen oder Institutionen wiedergegeben werden. Gemäß der produzentInnenseitig vorgenommenen Perspektivierungen „entwickelt sich eine eigenständige konzeptuelle Textwelt, wodurch die realitätskonstituierende Dimension von Sprache hervortritt“ (Becker 2012: 19). Dabei bauen RezipientInnen während des Textverstehens ein mentales Textwelt-Modell (TWM) auf (s. Schwarz 2008: 197). „Diese TWM-Erzeugung entsteht dadurch, dass zu jeder sprachlichen Äußerung ein passendes mentales Sachverhaltsmodell konstruiert wird, das eine plausible Relation zwischen den sprachlich präsenten Informationen und den konzeptuellen Konfigurationen des Welt-modells etabliert“ (Schwarz 2008: 197).
Mit der Perspektivierung geht zumeist auch eine Evaluierung, also die Bewertung einer Person (oder eines Sachverhalts), einher. Nach Klein (1994: 3) handelt es sich bei Evaluierungen um „positive oder negative Stellungnahmen zu Sachverhalten oder Personen, zu Dingen oder zu Handlungen. […] Bewertungen können explizit formuliert oder implizit nahegelegt werden. In den Medien […] finden wir Wertungen des journalistischen Personals selber ebenso wie Wertungen dritter […]“. Evaluierungen können dabei auf emotionaler und nicht-emotionaler Ebene stattfinden (s. Skirl 2012: 345). Wertungen auf der emotionalen Werteskala können in ihrer Qualität, Intensität und Dauer variieren (s. Bednarek 2006; Schwarz-Friesel 2013). Laut Bednarek (2006: 3 f.) können Wertungen hinsichtlich verschiedener Parameter, wie Emotionen (gut/ schlecht), Relevanz (un-/wichtig), Erwartung (un-/erwartet), Verständlichkeit, Notwendig-keit oder Glaubwürdigkeit, vorgenommen werden. So können ein Sachverhalt, eine Handlung oder eine Person durch TextproduzentInnen z. B. als wenig oder sehr glaub-würdig bewertet werden. Bewertungen können beispielsweise in Form von Metaphern, konnotierter Lexik oder mittels Emotionsthematisierungen ausgedrückt werden. Nicht-emotionsbezogene Wertungen können aus verschiedenen Wertungssichten (bspw. juristisch, moralisch, politisch) heraus stattfinden (s. Skirl 2012: 342). Evaluierungen sind häufig an ein textuelles Emotionspotenzial gebunden.20 Denn neben kognitiven, steuern emotionale Komponenten maßgeblich die mentale Repräsentation eines Sachverhalts (s. Schwarz-Friesel 2013: 213) und damit einhergehend die persönliche Einstellung diesem oder einer Person gegenüber. In informationsbetonten Texten der journalistischen Presse-berichterstattung werden emotionale Informationen in hohem Maße indirekt vermittelt (s. Skirl 2012: 339)
2.2 Informationsselektion und persuasive Aspekte
In der Kognitiven Textlinguistik werden nicht nur „strukturorientierte, textinterne Aspekte untersucht, sondern auch prozedurale, textexterne Faktoren, die bei Kohärenzetablierung und Textsinnkonstruktion eine Rolle spielen […]“ (Schwarz-Friesel 2013: 213). Neben der Betrachtung der sprachlichen Mittel in der Berichterstattung über Frauen in Spitzen-positionen, wird bei der Analyse von Textbelegen in dieser Arbeit immer auch der Versuch unternommen, die potenzielle Wirkung sprachlicher Äußerungen auf RezipientInnen zu antizipieren. Dies geschieht auch im Hinblick auf den Wirklichkeitsaspekt der Presse-berichterstattung. Molotch und Lester (1981: 133 f.) schlagen vor „not to look for reality, but for purposes, which underlie the strategies of creating one reality instead of another”. Hinterfragt wird folglich der Zweck der medialen Konstruktion spezifischer Sichtweisen auf Frauen in Führungspositionen (vgl. auch Bucher 1992: 261 f.). Die Bertachtung geschieht zudem von dem Standpunkt aus, dass die außersprachliche Realität über einen „Status als Bezugssystem mit Orientierungsfunktion“ (Becker 2012: 15) verfügt. Dennoch können Textwelten deutlich „von dieser abweichen […] und sind vorrangig von Perspektive und Wertung des Produzenten abhängig“ (Becker 2012: 15).
RezipientInnen sollen in der Berichterstattung vertraute Überzeugungen und moralische Einstellungen wiederfinden können (s. Bennet/ Edelmann 1985: 163). Sie finden dort jedoch nicht nur eine Bestätigung der eigenen Einstellungen. Vielmehr können bestimmte Urteile und Einstellungen durch die Presse forciert und manifestiert werden, wenn medial vermittelte Perspektivierungen und Evaluierungen internalisiert werden. Bednarek (2006: 4) formuliert den Zusammenhang zwischen Evaluierungen als persuasives Mittel etwas allgemeiner: „evaluation […] pervades human behavior: when we interact with the world around us, we perceive, categorize and evaluate what we encounter. Our short-term evaluations may then turn into long-term values […]”. Demnach können sich aus spontan evozierten Meinungen unter entsprechenden Umständen, wie eine repetitive persuasive Berichterstattung zu einer Person oder einem Sachverhalt, durchaus dauerhafte Ein-stellungen ergeben. Darüber, dass die Übernahme von Sichtweisen und Bewertungen aus der Presseberichterstattung aufseiten der RezipientInnen häufig (und zumeist unreflektiert bzw. unbewusst) geschieht, besteht Konsens in der Wissenschaft:
„Die seit Jahrzehnten etablierte konstruktivistische Einsicht, dass Medien kein Spiegelbild der Realität bieten (können), sondern eine spezifische Medienrealität konstruieren, wird von der Mehrheit ignoriert. Sowohl die Mediennutzer als auch die Journalisten haben einen uneingeschränkten Glauben an die Abbildfunktion der Medien“ (Beyer/ Leuschner 2010: 151).
In diesem Zusammenhang ist auf das Textverstehen als ein konstruktiver, in der Regel unbewusster Prozess zu verweisen, wie bei Schwarz-Friesel (2013: 33 ff.) beschrieben. Texte verfügen über ein Inferenzpotenzial, welches durch die Aktivierung von Weltwissen, realisiert werden kann. RezipientInnen stellen aktiv Kohärenz und kausale Relationen her. Sie füllen textuelle Lücken, die durch referenzielle Unterspezifikationen entstehen, über kontextuell gesteuerte Inferenzen (s. Schwarz 2008: 65). In dieser Hinsicht ist der Aspekt der Persuasion von zentraler Bedeutung. Eine persuasive Absicht wird nach MikoŁajczyk (2004: 37) als „unabdingbare Anfangsannahme“ bewertet, auf deren Grundlage ein Text produziert wird. RezipientInnen können die durch persuasive Strategien vermittelten Blickwinkel und Bewertungen durch explizite sprachliche Darstellungen entweder direkt entnehmen oder bei vielfach impliziten Darstellungen qua Inferenz erschließen.
2.2.1 Persuasive Strategien
„Persuasive Strategien sind kommunikative Verfahrensweisen, die spezifisch rezipienten-beeinflussend, d. h. intentional auf eine bestimmte Wirkung ausgerichtet sind […]“ (Schwarz-Friesel 2013: 225). Im Hinblick auf die Darstellung von Frauen in der Presse wird nach Huhnke (1996: 89) eine solche Wirkung durch persuasive Techniken vor allem implizit intendiert. Von den vielfältigen persuasiven Strategien, die in der Pressebericht-erstattung Anwendung finden (vgl. Schwarz-Friesel 2013: 226; Klein 1994: 4 ff.), eignen sich einige besonders, um bestimmte, durch Stereotype geprägte Einstellungen gegenüber beruflich erfolgreichen Frauen bei RezipientInnen zu forcieren. Dazu zählen:
- das Berufen auf regelhafte Beziehungen (z. B. traditionell liegt das Verteidigungs-ministerium in männlicher Hand; naturgemäß ist dies die Aufgabe der Frauen…)
- die Darstellung über Analogien (z. B. wie eine Raubkatze; das Küken in der Runde)
- das Hervorheben (z.B. eine Frau, dazu eine siebenfache Mutter, an der Spitze des Mili-tärs gab es in Deutschland noch nie) sowie
- das Kontrastieren (die zierliche Frau spricht entschlossen und mit scharfen Gesten)
Zudem können auch Spekulationen seitens der TextproduzentInnen sowie Vagheit bei der Wiedergabe von Informationen (die Raum für Spekulationen aufseiten der RezipientInnen lässt) als persuasive Strategie eingesetzt werden:
(6) Dann gab es noch Eckart von Klaeden, der womöglich schon zu Zeiten als Staats-minister im Kanzleramt eine zu große Nähe zu seinem heutigen Arbeitgeber Daimler hatte. (sz.de, 07.02.2014, Thorsten Denkler)
Auch Emotionalisierung kann als spezifische persuasive Strategie eingesetzt werden (s. Schwarz-Friesel 2013: 224 ff.; s. Kap. 3.1). Im Rahmen der vorliegenden Analyse wird diese Strategie dann relevant, wenn durch sie bestimmte emotionale Einstellungen gegenüber Personen bei den TextrezipientInnen intendiert werden. „Insbesondere die emotionalen Einstellungen, als dauerhaft gespeicherte Bewertungsrepräsentationen zu bestimmten Referenzdomänen, spielen bei allen aktuellen Wahrnehmungs- und Sprach-verarbeitungsprozessen eine entscheidende Rolle“ (Schwarz 2008: 132). Die Emo-tionalisierung im Sinne einer Rekonstruktion emotionaler Zustände der jeweiligen Textweltreferenten sowie einer Aktivierung von Gefühlen bei RezipientInnen ist gängiges Mittel bzw. Intention der Presseberichterstattung (s. Schwarz-Friesel 2013: 224). Dabei hängt die Konstruktion von Emotionen bei LeserInnen in hohem Maß von textuellen Manifestationsformen ab (s. Schwarz-Friesel 2013: 224).
[...]
1 Dazu bspw. Marcinkowski (2002).
2 s. Statistisches Landesamt: http://www.statistik-bw.de/Pressemitt/2013283.asp; Pressemitteilung vom 27.09.2013 [letzter Zugriff am 12.08.2014]
3 s. Statista 2014: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/180102/umfrage/frauenanteil-in-den-vorstaenden-der-200-groessten-deutschen-unternehmen/ [letzter Zugriff am 12.08.2014]
4 Aufgrund des vorgegebenen engen Rahmens der Ausarbeitung soll sich diese Arbeit v. a. auf die qualitative Analyse von Stereotypen und Vorurteilen gegenüber Frauen konzentrieren. Die über Männer existierenden stereotypen Vorstellungen können daher nicht mit der gleichen Ausführlichkeit behandelt werden.
5 An dieser Stelle muss deutlich gemacht werden, dass die Wirkung von sprachlichen Mitteln und persuasiven Strategien auf die RezipientInnen nicht vorhersagbar oder bestimmbar ist. Es können lediglich Vermutungen über potenzielle Auswirkungen angestellt werden. Ebensowenig kann nachgewiesen werden, inwieweit produzentInnenseitig persuasive Mittel bewusst eingesetzt werden.
6 Kognitive Strukturen, also Konzeptinhalte, kennzeichne ich im Fließtext durch die Schreibung in groß-buchstaben. Sprachliche Ausdrucksformen werden kursiv wiedergegeben.
7 für einen Überblick s. auch Carlin/ Winfrey (2009: 327 ff.)
8 Die Autorinnen unterscheiden nicht zwischen dem mutter-Stereotyp (mit der Zuschreibung mütterlicher Eigenschaften) und dem Aspekt der Mutterschaft in der Informationsselektion (s. dazu Kap. 4.2.1).
9 Erfassung von Geschlechterstereotypen mittels psychologischer Eigenschaftslisten und Fragebogen oder der Prozentschätzmethode (Eckes 1997; für einen Überblick s. Eckes 2008: 179).
10 Zum Verhältnis von Wortbedeutungen und kognitiven Strukturen s. auch Schwarz-Friesel (2008: 108ff.)
11 Diese werden bei Eckes (2008) als Substereotype bezeichnet.
12 Die linguistische Unterteilung von Stereotypen in Vorurteile und Klischees kongruiert in etwa mit der Be-schreibung der „dualen Natur“ der Geschlechterstereotype mit ihren individuellen und konsensuellen An-teilen bei Eckes (2008: 178; vgl. Kap. 1.1).
13 Ich übernehme die Termini Global- und Substereotyp von Eckes (2008). Mit Globalstereotyp beziehe ich mich folglich auf allgemeine stereotype Vorstellungen des Klassenkonzepts frau, die Substereotype sind die zu frau semantisch verwandten Konzepte (bspw. mutter, hausfrau).
14 Das Stereotyp eiserne jungfrau (Kanter 1977) kann als übereinstimmend mit der karrierefrau (Eckes 1997) betrachtet werden. Auch verführerin/ sex-objekt/ bunny dürften relativ synonym verwendet werden. Die Bezeichnung Eiserne Jungfrau („iron maiden“) hat ihren etymologischen Ursprung im Namen für ein mittelalterliches Folterinstrument.
15 Referenz meint den sprachlichen Bezug auf außersprachliche Objekte, Personen oder Sachverhalte. Sie ist dabei nicht auf „die perzeptuell erfahrbare Welt beschränkt“ (Schwarz 2008: 211 ff.).
16 Zur wirklichkeitskonstituierenden Rolle von Sprache und Presseberichterstattung siehe auch Kap. 5.
17 Spieß (1988: 126 ff.) bezieht sich dabei auf die Feststellungen von Schmerl (1985/ 1989; s. u.). Ihre qualitative Analyse von Spiegel-Artikeln untersucht u. a. die von Schmerl (1985) konstatierte „Spiegel-häme“. Diese besteht darin, dass „das Ideal einer Feministin entworfen [wird, I.K.], das sich dann an der Realität des 'realexistenten' Femininismus blamiert. […] Gleichzeitig wird damit die Moral zum Ausdruck gebracht, daß doch 'im Grunde nichts dahintersteckt'.“ (Spieß 1988: 137).
18 Diese Aussage ist in Bezug auf Geschlechterstereotype durchaus kontrovers zu betrachten: In Kap. 5 wird diskutiert, ob JournalistInnen eine derartige Absicht, also der intentionale, bewusste Einsatz persuasiver Mittel, in dieser Hinsicht tatsächlich zu unterstellen ist.
19 „Emotionale Einstellungen stellen mentale Bewertungsrepräsentationen hinsichtlich bestimmter Re-ferenten/Referenzbereiche dar. Einstellungen werden sprachlich vermittelt über lexikalische Mittel […] und syntaktische Strukturen […]. Jede emotionale Einstellung hat einen Positiv- oder Negativ-Wert, kann in der Intensität variieren und ist als permanent oder nicht-permanent zu charakterisieren. Emotionseinstellungen können explizit oder implizit dargestellt werden […]“ (Schwarz-Friesel 2009: 228; s. auch Schwarz-Friesel 2013: 81 ff.).
20 Ich gebrauche die Termini „Emotionspotenzial“ bzw. „Emotionalisierung“ im Sinne von Schwarz-Friesel (2013: 212 ff.). Ersteres ist als textuelles, produzentInnenseitig intendiertes, letzteres als kognitives, rezipientInnenseitiges (nicht-beobachtbares) Phänomen zu verstehen.
- Arbeit zitieren
- Isabelle Köntopp (Autor:in), 2014, Zur sprachlichen Realisierung geschlechtsspezifischer Stereotype in der Presseberichterstattung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/289261
Kostenlos Autor werden




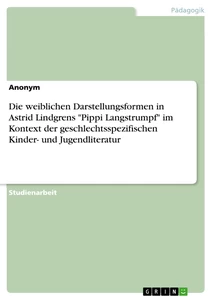
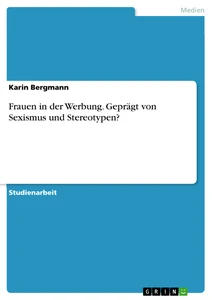
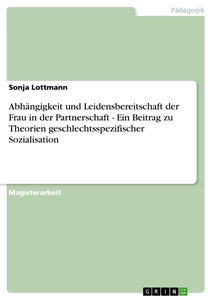

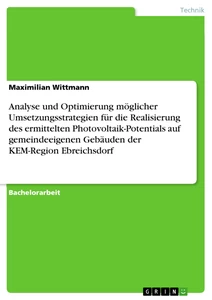


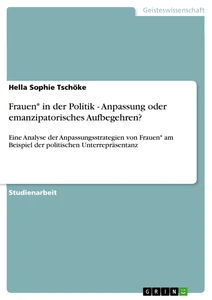
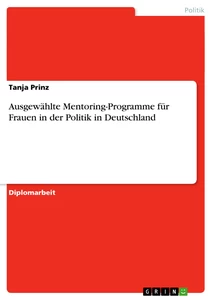
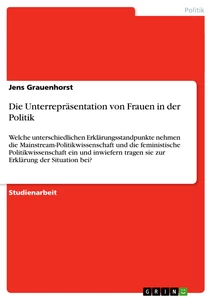
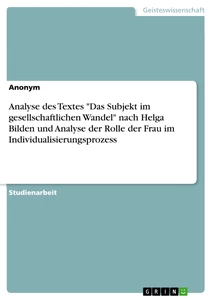




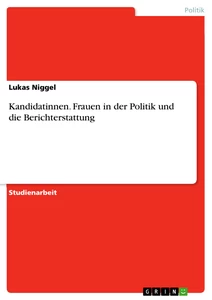
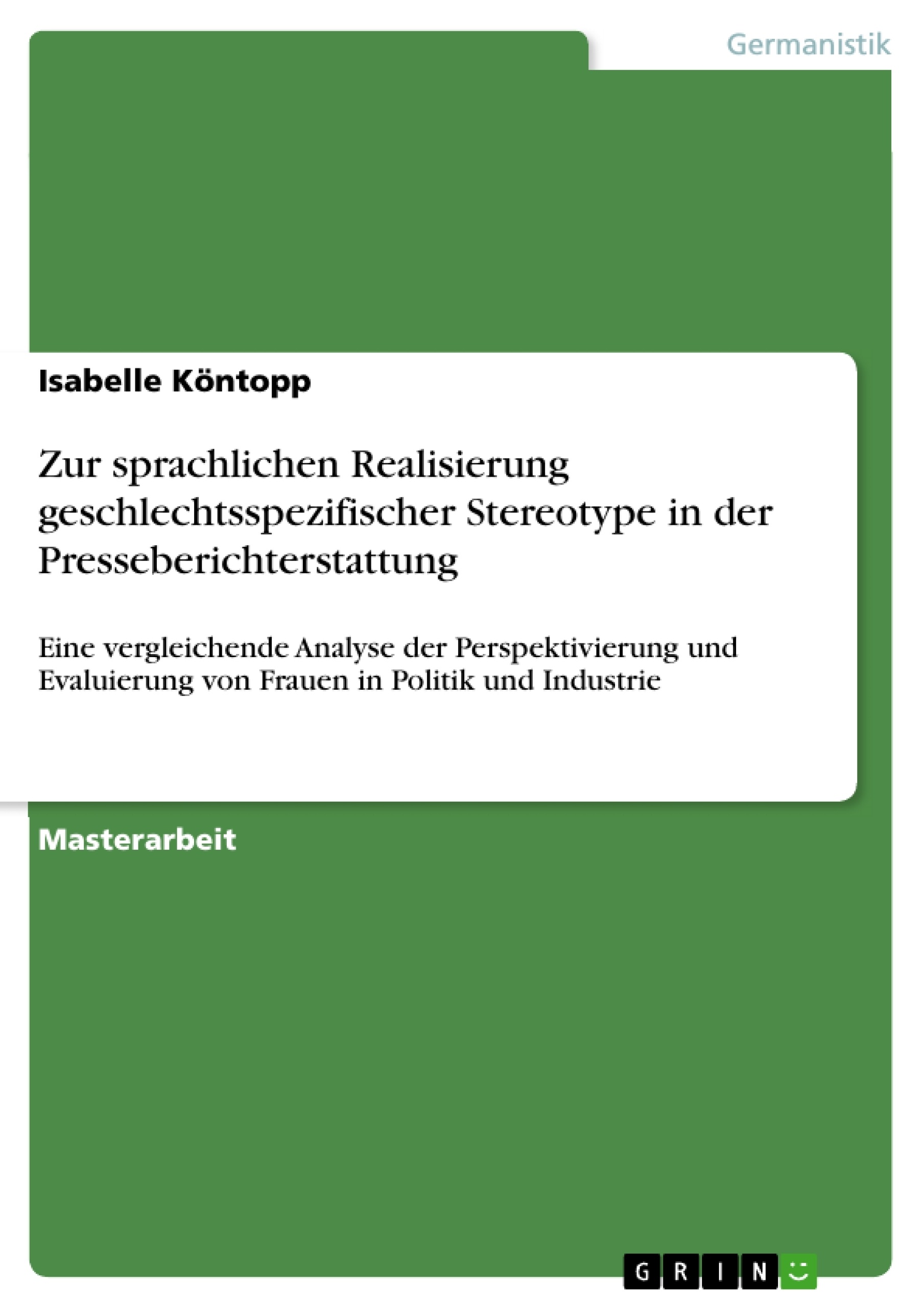

Kommentare