Leseprobe
Inhalt
1. Einleitung
2. Zur Stellung des Themas Krieg in Erich Frieds lyrischem Werk und Anmerkungen zum Werk selbst
3. Zur Biographie des Autors
4. Gedichte zum zweiten Weltkrieg
5. Über den Krieg in Vietnam
6. Die Kritik an den Kriegen und dem Verhalten Israels
7. El Salvador
7. Nicaragua
9. Die Gefahr eines Atomkrieges im Zuge der Blockkonfrontation
10. Kontroversen zu Frieds Vietnamgedichten: Über das politische Gedicht
11. Schluß
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Erich Fried gehört zu den bekanntesten deutschsprachigen Dichtern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Auch mehr als 15 Jahre nach seinem Tod verfügt er über eine umfangreiche Leserschaft. Ein interessantes Phänomen ist, Hunderte seiner Gedichte findet man auf unzähligen privaten Internetseiten verstreut, und auf diese Weise erhält sein Werk nicht nur über die Buchausgaben neue Leser.[1]
In der vorliegenden Arbeit soll behandelt werden, wie geht Erich Fried in seinem dichterischen Werk mit Kriegsgeschehen und Kriegsauswirkungen um, welche Inhalte werden in welcher Form aufgeworfen, wie montiert er politische Wertungen in diese Kontexte? Nicht betrachtet wird seine Prosa. In seinem einzigen Roman „Ein Soldat und ein Mädchen“ bezieht er sich fast gänzlich auf Nachkriegsgeschehen. Nur ein Abschnitt von wenigen Seiten behandelt eine Art surreales Massaker. Der Vorfall ist völlig verfremdet und geschichtlich nicht zuzuordnen in dem Sinne, welche Seite hier die Aggressionen ausübt. Der Beginn der Operation wird z.B. als Erdbeben charakterisiert. Die Beschreibungen kommen realen menschlichen Traumabläufen sehr nahe. Wirklichkeit und Fiktion vermischen sich total. Auch in anderen Kurzerzählungen ist direktes Kriegsgeschehen kaum präsent. Deshalb konzentriert sich die Arbeit weitgehend auf die Gedichte Erich Frieds. Dabei ist die Auswahl unmittelbar auf das Thema Krieg beschränkt, und es kann auch jeweils nur eine repräsentative Auswahl an Gedichten besprochen werden.
Als erstes soll zunächst die Stellung des Themas Krieg in Frieds Werk erörtert und ein paar allgemeine Betrachtungen zum lyrischen Werk vorgenommen werden. Im Anschluß sind einige biographische Angaben zum Autor ausgeführt. Fast alle Gedichte zum Thema Krieg lassen sich konkreten Ereignissen zuordnen. Deshalb sind die nachfolgenden Abschnitte jeweils spezifischen Kriegsgeschehnissen zugeordnet. Abschließend werden Kontroversen, die es zu den Vietnamgedichten gab diskutiert, die aber teilweise die politische Dichtung überhaupt betreffen. Darüber hinaus gibt es kaum Möglichkeiten zum Thema Krieg in Frieds Dichtung sich auch auf Aussagen in Sekundärliteratur zu stützen.
Da ich selber viele Gedichte im Modus konkreter und engagierter Dichtung geschrieben habe, werde ich diese Erfahrungen an einzelnen Stellen mit einbringen. Unvermeidlich ist bei der Bewertung von Literatur, die eigenen Positionen zu verdeutlichen. Aussagen zur Dichtung lassen sich nur bedingt als wissenschaftlich verbindlich markieren. Man sieht das dann auch bei den Kontroversen um die Vietnamgedichte sehr deutlich. Die Auffassungen der verschiedenen Seiten gehen diametral auseinander.
Gedichte zum Thema Krieg gehören, sobald sie über allgemeinere Aussagen hinausreichen, zu denen, die mit am schwierigsten zu schreiben sind. Man muß viele Informationen gezielt sammeln, sich reichlich Zeit nehmen, damit das Gedicht reifen kann und dabei immer damit rechnen, daß es Zusammenhänge und Probleme gibt, von denen man keine Informationen erlangen kann, die aber wichtig sein können für die Bewertung.
Ich schrieb Gedichte über den Kosovokrieg, den Krieg in Afghanistan und den jüngsten IrakKrieg. Von vier eigenen Gedichten zum Afghanistan-Krieg sind drei Gedichte von mir wieder aussortiert worden, weil sie problematische Einseitigkeiten enthalten. Das nur als Hinweis, für die späteren Betrachtungen zu Frieds Gedichten. Was manchmal ganz einfach aussieht, ist zuweilen harte Arbeit am Wort und der inhaltlichen Ausrichtung.
2. Zur Stellung des Themas Krieg in Erich Frieds lyrischem Werk und Anmerkungen zum Werk selbst
Das Thema Krieg und Kriegsgeschehen wird gleich zu Beginn seines Schaffens von Erich Fried thematisiert. Hier taucht es als Reaktion auf den 2.Weltkrieg auf, verschwindet dann aber für lange Zeit aus dem lyrischen Werk. Erst durch den Vietnamkrieg gelangen solche Themen für den Dichter wieder auf die Tagesordnung, dies dann aber ganz massiv. So betitelt er einen ganzen Gedichtband „und VIETNAM und“. Fried selbst spricht davon, daß er sich, durch den Vietnamkrieg ausgelöst, wieder lebhafter für Politik interessierte.[2] Kriegsgeschehen taucht ab diesem Zeitpunktpunkt immer wieder in seinem lyrischen Werk auf. Kriegerische Handlungen Israels, in El Salvador oder die gewalttätige Unterminierung Nicaraguas durch Reagans Contras kommen zur Sprache. In dem letzten Schaffensjahrzehnt Frieds rückt auch der Atomkrieg und die Gefahr der Auslöschung der gesamten Menschheit in eine hervorgehobene Position.
Das lyrische Gesamtwerk umfaßt in der Gesamtausgabe drei Gedichtbände mit mehr als 1900 Seiten. Hochgerechnet dürfte es sich dabei schätzungsweise um 4000 bis 5000 Gedichte handeln. Schätzungsweise die Hälfte dieser Gedichte trägt politischen Charakter. Darunter befinden sich ungefähr 60-80 Gedichte, die sich weitgehend auf Kriegsgeschehen und Kriegsauswirkungen beziehen oder politische Einschätzungen zu kriegerischen Handlungen abgeben. Hinzu kommen eine ganze Reihe Gedichte, die teilweise oder an einer einzelnen Stelle das Thema Krieg oder damit verbundene Inhalte in verschiedener Form ansprechen. Es ist also nur ein kleiner Auszug aus dem lyrischen Werk, der hier für das Thema Krieg und Literatur relevant ist.
Im dichterischen Werk gibt es bei Erich Fried einen sehr starken Bruch. Man kann diesen etwa zwischen den Bänden „Reich der Steine“ und „Warngedichte“ datieren, wobei Frieds neuer Stil sich auch in dem Band „Warngedichte“ erst andeutet und später voll entwickelt wird. Etwa Anfang der sechziger Jahre bekommen viele Gedichte eine unverwechselbare Klarheit. Es findet eine verstärkte Hinwendung zu konkreter Dichtung statt. Die dichterischen Aussagen werden in den politischen wie auch anderen Gedichten stärker in den Vordergrund gerückt, schwer entschlüsselbare Bilder verschwinden. Zu einigen seiner früheren Gedichte wird er Gegengedichte schreiben, um damit kenntlich zu machen, daß sie ihm nicht mehr weit genug reichen, sie zu unverbindlich daherkommen. Viele politische Gedichte erhalten einen engagierten Charakter.
3. Zur Biographie des Autors
Erich Fried wurde am 6. Mai 1921 in Wien geboren. Früh beginnt er Gedichte zu schreiben, und früh wird er auch Zeuge gesellschaftlicher Unbilden. 1927 erlebt er den sogenannten „Blutfreitag“ in Wien, er kann das Geschehen von einem Schaufenster eines Ladens verfolgen, in den seine Mutter mit ihm geflüchtet war. Fast 90 Menschen sterben bei dieser Auseinandersetzung zwischen Polizei und Arbeiterschaft. Der Freispruch rechter Täter von Mordtaten führt zu dem gesellschaftlichen Aufruhr, an dessen Ende der Justizpalast in Flammen aufgeht. Zur Weihnachtszeit des selben Jahres soll Fried vor Festpublikum ein Gedicht aufsagen. Er tritt vor und sagt, er kann kein Gedicht aufsagen, solange der Polizeipräsident im Saal sitzt, der für die Opfer des Blutfreitags verantwortlich ist. Der Präsident verläßt wutentbrannt den Saal.[3] Bereits hier scheint sich der spätere vitale Widerspruchsgeist Frieds anzukündigen.
1938 mit dem Anschluß Österreichs an Deutschland gelten die „Nürnberger Rassegesetze“ auch in diesem Land, und die systematische Verhaftung, Folterung und Ermordung der Juden beginnt. Fluchtpläne werden im Bekanntenkreis der Frieds diskutiert, sie sind Betroffene, der Vater Frieds stirbt nach einem Verhör, ihm wird die Magenwand eingetreten. Die Hälfte von Frieds Verwandtschaft kommt später in den Konzentrationslagern der Nazis um. Fried selbst kann 1938 nach England flüchten. Von dort versucht er ihm bekannte und unbekannte Leidensgenossen bei der Flucht nach England zu unterstützen, kann 73 Visen beschaffen, unter großen finanziellen Entbehrungen.[4] Schon diese wenigen biographischen Stichpunkte geben deutliche Hinweise darauf, warum in seinem späteren Werk Themen, die mit Krieg, Flucht und staatlichem Unrecht in Verbindung stehen, einen wichtigen Platz einnehmen.
Nach dem Krieg wurde Fried Mitarbeiter bei zahlreichen neugegründeten Zeitschriften, später Kommentator deutschsprachiger Sendungen beim BBC. Zunächst muß er sich aber als Fabrikarbeiter und mit Hilfsjobs durchschlagen. Die Position bei der BBC gab er 1968 wegen ihrer unveränderten Kalten-Kriegs-Position auf.[5]
Fried blieb zeitlebens in England wohnhaft, unternahm aber häufig Reisen für Lesungen in Deutschland und Österreich, wurde 1963 Mitglied der Gruppe 47. Er veröffentlichte über 20 Gedichtbände, den Roman „Ein Soldat und ein Mädchen“, zahlreiche Erzählungen, eine Reihe politischer Texte sowie Aufsätze zur Literatur. Überdies übersetze er fast alle Werke Shakespeares und nahm zahlreiche weitere Übersetzungen vom Deutschen ins Englische vor. Des öfteren geriet er in Konflikt mit politisch Andersdenkenden, wenn er offen und kritisch Stellung zu politischen Themen nahm, was er in seinen Gedichten sehr häufig tat. Erst gegen Ende seines Lebens wurde ihm die Anerkennung in Form von Auszeichnungen wie dem Bremer Literaturpreis, dem Österreichischen Staatspreis und dem Georg-Büchner-Preis zuteil. Erich Fried erkrankte an Krebs und starb am 22. November 1988. Er wurde auf dem Kensal Green in London beerdigt.
Mit Bezug auf das Thema Krieg und Literatur sei ergänzt: In Frieds Wohnung hing im Eingangsflur das Bild „Guernica“ von Pablo Picasso als Reproduktion.[6] Das Bild erinnert an die Zerstörung der Stadt durch Hitlers Bomber im Spanischen Bürgerkrieg. So gegenwärtig war das Thema Krieg selbst in seiner Wohnung. In etlichen Gedichten kommt er auf Guernica mit zu sprechen.
4. Gedichte zum zweiten Weltkrieg
In dem Gedicht „Letzte Reise“[7] vergleicht Fried Viehwagen, die in einem Fall Rinder transportieren und im anderen Fall deutsche Soldaten. Die Rinder würden die ganze Nacht brüllen, sich verzweifelt hin und her drängen und sich in gewisser Weise einer Gefahr instinktiv zumindest bewußt sein. Die Soldaten dagegen würden schlafen auf dem Weg in die Schlacht, für viele gewiß der letzte Lebensweg. Die Aussage steht am Ende, die Rinder verhielten sich natürlicher in ihrer Situation als die Soldaten, die sehr viel besser einschätzen könnten, was ihnen jetzt droht.
Ein sehr bemerkenswertes Gedicht zum Thema Krieg und Mitschuld findet sich unter dem Titel „Einigen Gefallenen“.[8] Frieds Plädoyer zielt darauf, nicht jeden deutschen Soldaten als Feind zu klassifizieren, jedenfalls nicht ohne Zögern. Berücksichtigt werden müsse vielmehr und dies verdeutlicht er in Fragen, wer war der Mensch, der dort in den Krieg zog, bzw. in der Regel ziehen mußte. Welchen anderen Weg hätten er gewählt, wenn er es gekonnt hätte? Gibt nicht schon mancher Brief im Gepäck des Gefallenen zumindest indirekt darüber Auskunft? Der Krieg hätte überall auch unter Freunden Opfer gefordert. Gestorben sei eben auch zwischen den „Fronten“ worden. Fried verweigert sich hier einer einfachen Schwarz-Weiß-Sicht und will nicht nur den absichtsvollen oder aus Mitläuferschaft geborenen Mörder in Soldatenkutte gelten lassen.[9]
Ein weiteres Gedicht unter dem Titel „Heimaturlaub“ thematisiert den Selbstmord. Ein Soldat geht in die Berge und erhängt sich, um nicht zurück zur Front zu müssen. Seine Frau (vermutlich) schreit ihm hinterher, mit welcher Intention wird nicht ausgeführt, am ehesten aber ist anzunehmen, weil sie seinen Entschluß nicht mehr abwenden kann. Ansonsten wird auf die Natur Bezug genommen und diese symbolisch mit dem Soldatenentschluß verknüpft, nicht sehr geglückt, zudem noch mit einem zu saloppen Unterton, der hier auch fehl am Platze scheint nach meiner Meinung. Die Kritik von mir zielt keinesfalls auf das Anliegen des Gedichtes, sondern auf die sprachlich verwendeten Mittel.
Mehrere Gedichte befassen sich mit den Luftangriffen auf Wien und den Konsequenzen. In „Es muß sein“ rechtfertigt er die Fliegerangriffe auf seine Heimatstadt, schweren Herzens, wie er zugibt. Von dem „Lächeln“ Wiens würde nunmehr nur Stein, Erde und Eisen bleiben, vermerkt er in „Die Verbündeten“.[10] In der zweiten Strophe gibt er dem Gefängnis eigenständige menschliche Regungen. Es würde grinsen „aus Gitter und Tor“ und die Flugzeuge der Alliierten begrüßen, die Kaserne sich „gierig hervorwölben“ (vielleicht um von den Bomben getroffen zu werden) und der Friedhof „träge nach Toten suchen“. Und im dritten Gedicht „Lied auf dem Vormarsch“ kommt dann die bange Frage auf, wie werden die fremden Truppen in der eigenen Stadt aufgenommen, mit Blumen oder mit Blut.
5. Über den Krieg in Vietnam
Fried konnte sich als politischer Kommentator bei der BBC gut Informationen über Nachrichtenagenturen beschaffen. Wenn er zu einer bestimmten Meldung über den Vietnamkrieg mehr Informationen wollte, rief er dort an oder bei anderen Journalistenkollegen und hatte bald ein Vielfaches an Material, das er benötigte. Mitunter belieferten ihn auch Kollegen direkt, und so erhielt er bald ein sehr umfassendes Bild über den Vietnamkrieg und die damit verbundenen Greuel.[11] Zum Krieg gegen Vietnam existieren zahlreiche Gedichte von Erich Fried, die meisten davon sind im Band „und VIETNAM und“ abgedruckt bzw. in späteren Ausgaben ergänzt worden. Besprochen werden kann hier nur eine Auswahl besonders prägnanter Beispiele für den Kontext Krieg und Literatur. Zunächst einige Worte noch zum historischen Kontext.
Dem eigentlichen Vietnamkrieg geht der sogenannte Indochinakrieg voraus, der 1946 beginnt. Frankreich will seine Kolonialherrschaft aufrecht erhalten, vereinbart, daß die chinesischen Truppen aus dem Land abziehen. Ab 1940 hatte Japan Vietnam im Einvernehmen mit dem französischen Vichy-Regime besetzt gehalten. Interessanterweise wird die vietnamesische Widerstandsbewegung damals von den USA unterstützt. Dies ändert sich aber schnell, und ab 1950 wird die französische Seite unterstützt.
In Dien Bien Phu werden 1954 die französischen Kolonialtruppen vom Vieth Minh vernichtend geschlagen. Die Genfer Unterhändler einigen sich in einem Abkommen auf die Teilung des Landes in ein kommunistisches Nordvietnam und ein kapitalistisches Südvietnam. Bereits in diesem ersten Krieg sterben eine halbe bis zu einer Million Zivilisten, zwischen 200.000 und 300.000 Kämpfer der Viet Minh und 95.000 Mann von den französischen Kolonialtruppen.[12]
Entgegen den Verpflichtungen, die ausgehandelt worden waren, schließt sich Südvietnam dem Militärbündnis SEATO an und begeht Vertragsbruch. Die ebenfalls in dem Abkommen vorgesehenen Wahlen unter internationaler Kontrolle für ganz Vietnam werden vom Süden abgelehnt. Ursache dürfte gewesen sein, daß die Bevölkerung Ho Chi Minh mit überwältigender Mehrheit als Staatschef gewählt haben würde.
Die nordvietnamesische Regierung ging zunächst davon aus, die Guerilla im Süden könnte von sich aus die Diemdiktatur stürzen. Als dies nicht gelang, unterstützt sie zwischen 1959 und 1963 mit Waffen und Kämpfern den Widerstand im Süden. 1962 stockt die US-Regierung auf über 11.000 Soldaten ihre Präsenz im Süden auf. 1964 dringen zwei amerikanische Kriegsschiffe (Kreuzer) in nordvietnamesische Hoheitsgewässer ein und werden von Patrouillenbooten beschossen. Dies wird der Anlaß für die ersten amerikanischen Bombardements auf Nordvietnam, die ab 1965 regelmäßig stattfinden. Man Quang, davon wird gleich die Rede sein, wird am 19.3.1965 bombardiert. In den dreieinhalb Jahren nach Beginn der Luftangriffe wurden über Nordvietnam doppelt soviel Bomben abgeworfen wie im gesamten 2. Weltkrieg.[13]
Mit der sogenannten Ted-Offensive der nordvietnamesischen Armee wendet sich das Kriegsgeschehen zuungunsten der Besatzungsmächte. Zwar wird dieser Angriff auf zahlreiche strategische Ziele fast überall abgewendet, aber auf amerikanischer Seite wird klar, der Krieg ist nicht gewinnbar. 1973 kommt es zu einem Waffenstillstandsabkommen, zwei Jahre später besetzen nordvietnamesische Truppen Saigon, daß geteilte Land wird vereint und der von den Kolonialmächten aufgezwungene jahrzehntelange Krieg ist beendet.[14] Die humanen, materiellen und seelischen Schäden des Krieges sind nicht zu ermessen.
In dem Gedicht „42 Schulkinder“[15] versucht Erich Fried, die geschichtlichen Dimensionen und Kriegsdaten, die mit verschiedenen Städten und Ereignissen in der Welt verbunden sind, in Beziehung zu setzen mit dem Kriegsgeschehen in Vietnam. In diese Dimension hinein bringt er 42 Schulkinder, die getötet worden sind in Man Quang. So beginnt er das Gedicht, wie weit es von Guernica nach Man Quang sei. (Guernica wurde 1937 durch die Flugzeuge der deutschen Legion Condor bombardiert, über 1600 Menschen kamen dabei ums Leben.) Er fragt dann weiter nach Entfernungen u.a. der von Washington nach Berchtesgaden, von München nach Prag usw. So entwickelt er ein Beziehungsgeflecht von zeitlichen und örtlichen Entfernungen und geschichtlichen Daten, die auf eine sehr enge Verwandtschaft des Kriegsgeschehen des Hitlerreiches und des Krieges der USA, der die südvietnamesischen Diktatoren unterstützte, sehr gezielt anspielen. Gewiß machen die offenen Flanken dieser Vergleiche und Abgleiche diese Assoziationsketten riskant, doch letztlich entscheidet der Leser, was er hinein interpretiert oder nicht. Deshalb ist es eben auch spannend.
[...]
[1] siehe z.B. die Internetseite http://www.erichfried.de, wo eine ganze Reihe Internetseiten mit Gedichten verlinkt sind
[2] Erich Fried; Anfragen und Nachreden. Politische Texte, Berlin, 1994, S.120
[3] Erich Fried; Gesammelte Werke. Prosa, Berlin, 1993, S.536
[4] Gerhard Lampe; „Ich will mich erinnern an alles was man vergißt“. Erich Fried – Biographie und Werk eines „deutschen Dichters“, Frankfurt am Main, 1998, S.66
[5] Gerhard Lampe; „Ich will mich erinnern an alles was man vergißt“. Erich Fried – Biographie und Werk eines „deutschen Dichters“, Frankfurt am Main, 1998, S.86
[6] Gerhard Lampe; „Ich will mich erinnern an alles was man vergißt“. Erich Fried – Biographie und Werk eines „deutschen Dichters“, Frankfurt am Main, 1998, S.11
[7] Erich Fried; Gesammelte Werke. Gedichte 1, Berlin, 1993, S.16
[8] Erich Fried; Gesammelte Werke. Gedichte 1, Berlin, 1993, S.27
[9] Die im Gedicht „Einigen Gefallenen“ schon thematisierte Frage nach den Abmaßen und Relationen von Schuld des Einzelnen im Hitlersystem, widmet sich Fried auch in der Prosa. Auf sehr zugespitzte Weise fragt er nach den Konsequenzen von Schuldigkeit in seinem einzigen Roman „Ein Soldat und ein Mädchen“, der 1960 erscheint. Die Handlung spielt kurz nach Kriegsende. Eine sehr junge und hübsche Frau wird von den Alliierten in einem Gerichtsverfahren zum Tode verurteilt. Sie war zuvor Lageraufseherin in einem Konzentrationslager. Im Verfahren gibt sie sich als scheinbar unverbesserlich. Doch im Roman wird nach und nach verdeutlicht, dies ist nur die eine Seite. Einen alliierten Soldaten, der ihr zunächst sehr feindselig gegenübersteht beim Verfahren, nutzt Fried für die seelische Spurensuche, greift dessen schriftlichen Notizen über den Fall auf. Zunächst will die junge Frau keinen letzten Wunsch äußern am Tag vor ihrer Hinrichtung, kommt dann aber auf die Idee zu provozieren und wünscht sich mit ebenjenen Soldaten schlafen zu wollen. Dies wird zwar nicht offiziell ermöglicht, aber inoffiziell zugelassen, da der Soldat darauf eingeht. Fried streut im Laufe der Haupthandlung des Romans noch ein paar knappe Hinweise ein, daß die Frau sich gegenüber den Gefangenen im Rahmen der Möglichkeiten sehr korrekt und hilfsbereit verhalten habe und ihre Schuld, die zweifellos existent ist, eher als geringerer Natur einzustufen ist. Auch die störrischen Äußerungen während des Prozesses würden nicht ihrer wirklichen Seelenverfassung entsprechen, sondern längst hätte die kritische Reflexion eingesetzt. Der Leser wird über weitere Details im Ungewissen gelassen. Klar heraus kommt aber das Votum gegen die Todesstrafe.
[10] Erich Fried; Gesammelte Werke. Gedichte 1, Berlin, 1993, S. 42, 50, 61
[11] Erich Fried; Zeitgenossen des Jahrhunderts: Im Gespräch mit Stephan Reinhardt (CD), o.A., 1999
[12] Erich Fried; Gesammelte Werke. Gedichte 1, Berlin, 1993, S.646 f.; http://www.asiatour.com/vietnam/d-01land/dv-lan24.htm, 4.1.2004
[13] Erich Fried; Gesammelte Werke. Gedichte 1, Berlin, 1993, S.648 ff.; http://www.asiatour.com/vietnam/d-01land/dv-lan24.htm, 4.1.2004
[14] Erich Fried; Gesammelte Werke. Gedichte 1, Berlin, 1993, S.648 ff.; http://www.asiatour.com/vietnam/d-01land/dv-lan24.htm, 4.1.2004
[15] Erich Fried; Gesammelte Werke. Gedichte 1, Berlin, 1993, S.368 f.
- Arbeit zitieren
- Marko Ferst (Autor:in), 2004, Das Thema Krieg in der Dichtung Erich Frieds, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26348
Kostenlos Autor werden
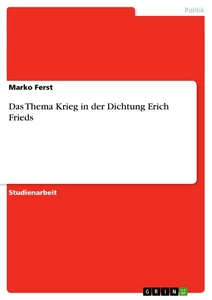
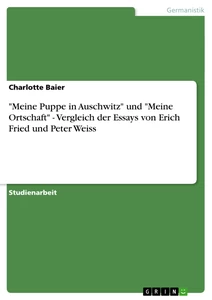

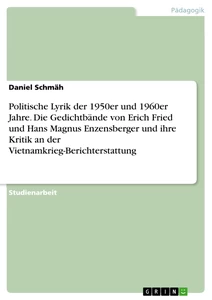
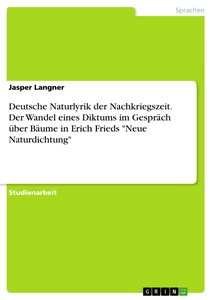
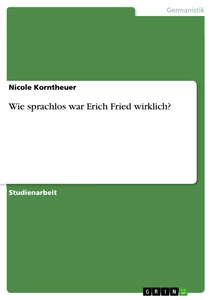


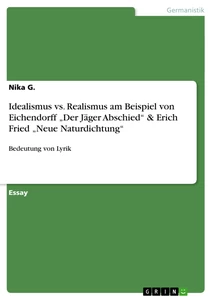




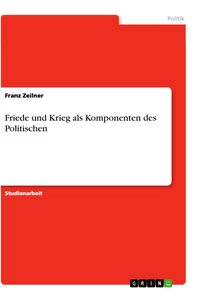
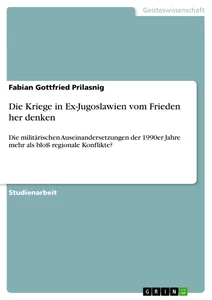
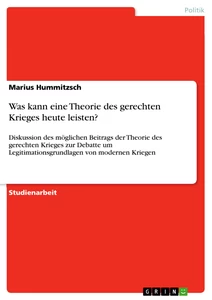
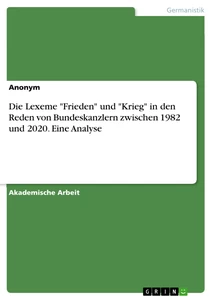
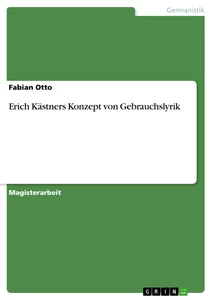
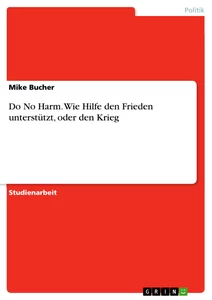
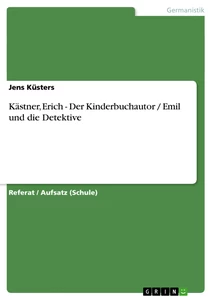
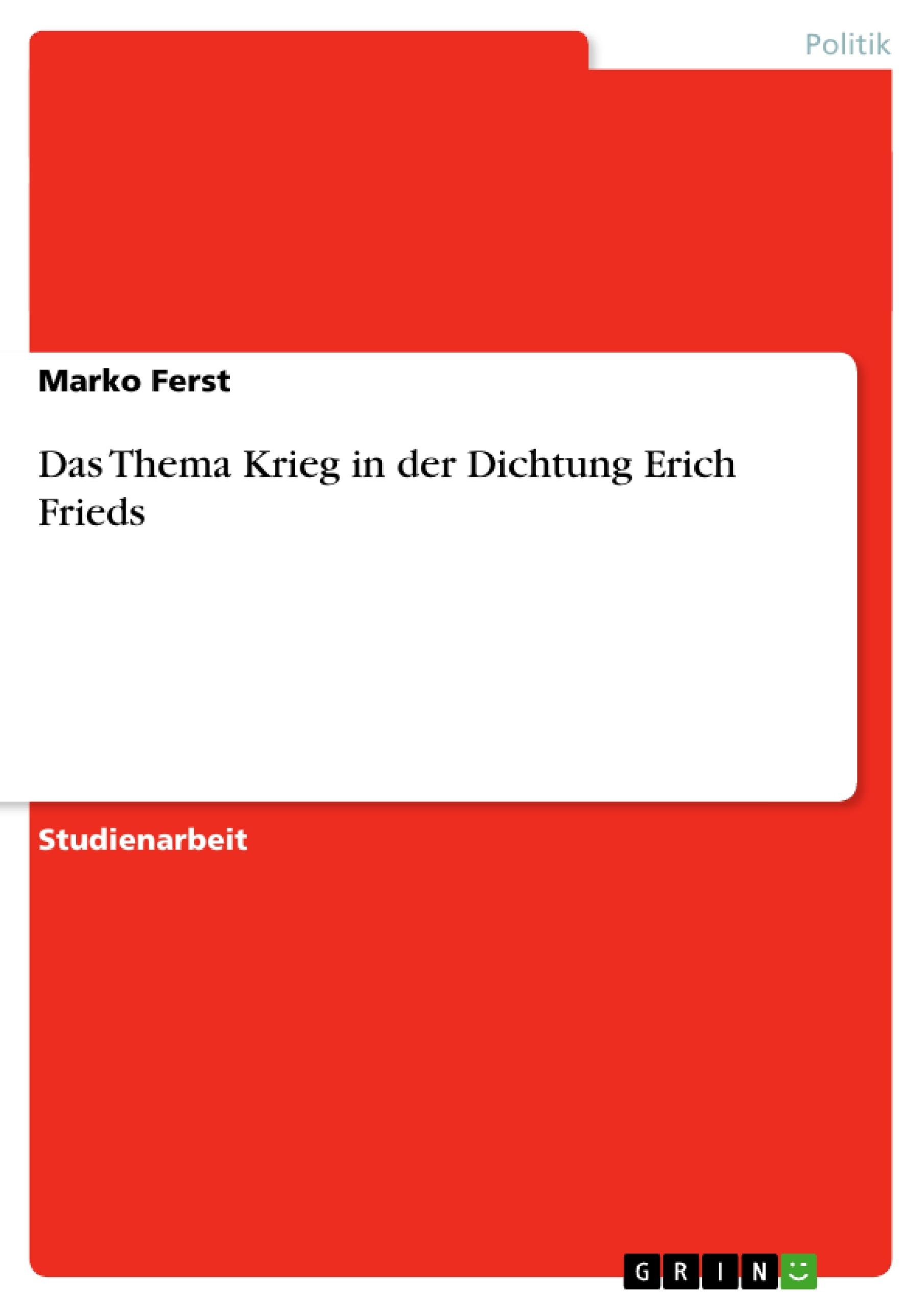

Kommentare