Leseprobe
Inhalt
I. Die verlorenen Jahre der Kinderstars
II. Überforderung
1. Ein Definitionsversuch
2. Fallbeispiel Steffi Graf
Familie Graf – eine prominente dysfunktionale Familie
Was ist eine dysfunktionale Familie?
Was hat ein dysfunktionales Familiensystem mit Überforderung zu tun?
Biographische Notiz
Wieso waren die Grafs eine dysfunktionale Familie?
3. Folgen von Überforderung in der Kindheit
Perfektionismus
Schizoidität
III. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit
IV. Literaturverzeichnis
I. Die verlorenen Jahre der Kinderstars
Britney Spears, Michael Jackson und die Olsen-Schwestern sind in aller Munde. „Kinderstars“, „verlorene Kindheit“ und „ehrgeizige Eltern“ sind Schlagworte, die wohl die meisten von uns mit diesen Namen spontan assoziieren würden. Kinderstars haben Hochkonjunktur - nicht nur weit weg von uns, nicht nur im Land der unbegrenzten Möglichkeiten:
Boris Becker, und Steffi Graf sind im deutschsprachigen Raum sicher die bekanntesten – mittlerweile erwachsenen – Kinderstars.
Auch im Rahmen von Olympia waren im Fernsehen erschreckende Bilder aus chinesischen Olympiacamps zu sehen. Schon Fünfjährige werden dort unter extremsten Bedingungen und mit brutalen Schlägen auf sportliches Höchstniveau getrimmt. Sechs bis acht Stunden tägliches Training sollen aus den kleinen Talenten von heute die Olympiasieger von morgen machen.
Dass all diese Kinder überhöhten Anforderungen ausgesetzt sind, liegt selbst für jeden pädagogischen Laien ganz klar auf der Hand.
In dieser Arbeit werde ich am Fallbeispiel des deutschen Tenniswunders Steffi Graf das Phänomen der Überforderung in der Kindheit untersuchen. Im Anschluss daran werde ich mögliche Folgen einer Überforderung in der Kindheit erörtern. Doch zunächst stellt sich die Frage: Was ist überhaupt unter dem Begriff „Überforderung“ zu verstehen?
II. 1. Überforderung – ein Definitionsversuch
Ab welchem Punkt stellt eine erzieherische Maßnahme oder eine Situation für ein Kind nun keine Förderung mehr dar sondern mündet in einen zu hohen Anspruch, durch den das Kind über fordert ist?
Sattelt man das Pferd von hinten auf und setzt sich zunächst mit dem Begriff der „Förderung“ auseinander, stößt man in Wygotski´s Prämisse der Beachtung der „Zone der nächsten Entwicklung“ auf ein entscheidendes Moment. Demnach muss jede Förderung mit der Orientierung am individuellen Entwicklungsstand einhergehen, „damit es nicht zu Überforderung und motivalen Einbrüchen kommt“ .[1]
Die Orientierung am individuellen Entwicklungsstand, macht Förderung und damit auch Überforderung zu einem relativen Begriff: stellt das Schreibenlernen für den kleinen Tristan eine unüberwindbare Hürde dar, kritzelt die gleichaltrige Hanna mühelos ihren Namen an die Wand.
Der Diplompädagoge Joachim Schreijäg[2] meint:
„ Eine Anforderung die dem jeweiligen Alter und dem Entwicklungsstand des Kindes nicht angemessen ist, bedeutet eine Überforderung - unabhängig vom Potential, das vielleicht vorhanden aber noch nicht entwickelt ist. Überforderung kann demzufolge sowohl psychischer, wie auch körperlicher Natur sein.“ .
Betrachten wir die Bereiche, in denen sich ein Kind entwickelt. Die Diplom-Psychologin Petra-Marina Hammer unterteilt die Entwicklung eines Kindes in die drei folgenden Bereiche
1. in die Denkentwicklung
2. die körperliche/motorische Entwicklung
3. die sozial-emotionale Entwicklung[3]
In jedem Entwicklungsstatus dieser drei Bereiche hat das Kind ein bestimmtes, individuell begrenztes Vermögen, Aufgaben oder Situationen zu bewältigen oder zu verarbeiten. Unter Einbeziehung der oben genannten Wygotski´schen Prämisse kann Überforderung auch definiert werden als
ein Übersteigen des momentanen körperlich/motorischen, sozial-emotionalen oder mentalen Potentiales eines Menschen/Kindes, welches nicht das Erreichen der nächstmöglichen Entwicklungsstufe erwirkt.
Wenn man sich vor Augen führt, dass wohl niemand in unserer westlichen Welt einen Fünfjährigen eine volle Bierkiste tragen ließe – die nahezu die Hälfte seines Körpergewichts ausmachte – wird klar, dass die Überforderung von Kindern aus den Industrienationen in den anderen beiden Bereichen liegen muss. Der Grund dafür mag darin begründet liegen, dass ein Übersteigen des Kraftpotentials sogleich sichtbar ist – aber eine Überforderung im mentalen oder physischen Bereich in den meisten Fällen Spätfolgen zeitigt, d.h. erst offensichtlich wird, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Welche (Spät-)folgen sich aus überhöhten Ansprüchen für ein Kind bzw. den späteren Erwachsenen ergeben können, soll weiter unten diskutiert werden. Zunächst möchte ich jedoch am Fallbeispiel des deutschen „Tenniswunders“ Steffi Graf das Phänomen „Überforderung in der Kindheit“ veranschaulichen und näher untersuchen:
[...]
[1] Prof. em. Dr. Rolf Oerter und Prof. Dr. Leo Montada: Entwicklungspsychologie;
[2] Diplom-Pädagoge und Psychotherapeut mit Praxis in Günzburg, Schwaben;
[3] Dr. med. E. Aust-Claus; Dipl. Psych. P.-M. Hammer: Auch das Lernen kann man lernen.
- Arbeit zitieren
- Michaela Walther (Autor:in), 2004, Überforderung in der Kindheit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39362
Kostenlos Autor werden
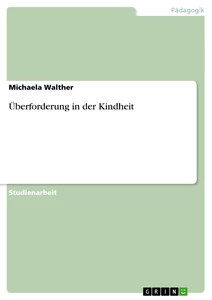
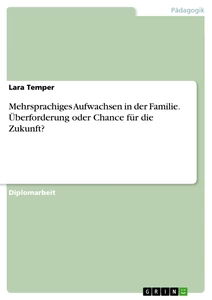
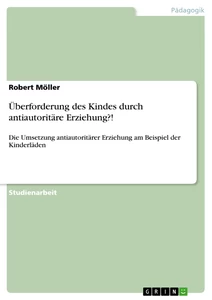
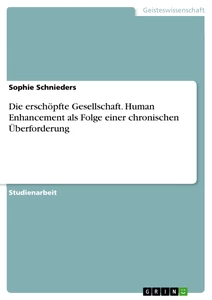
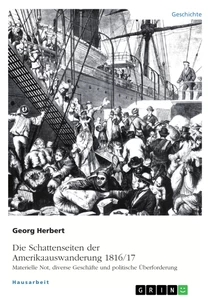
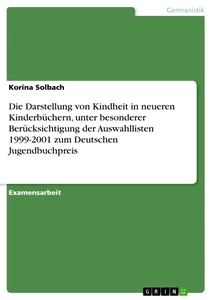
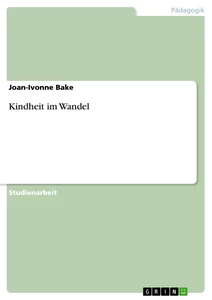




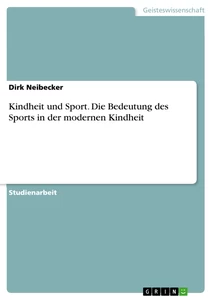
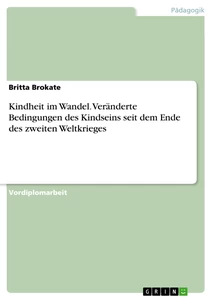
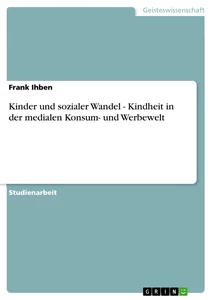

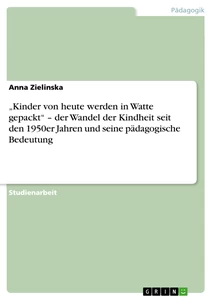
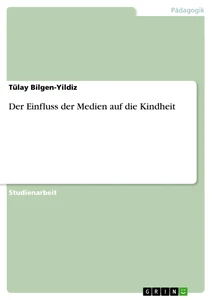
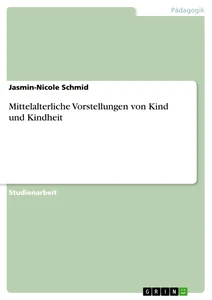

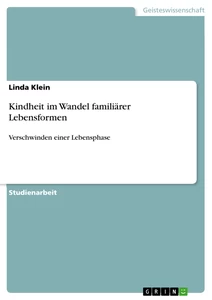
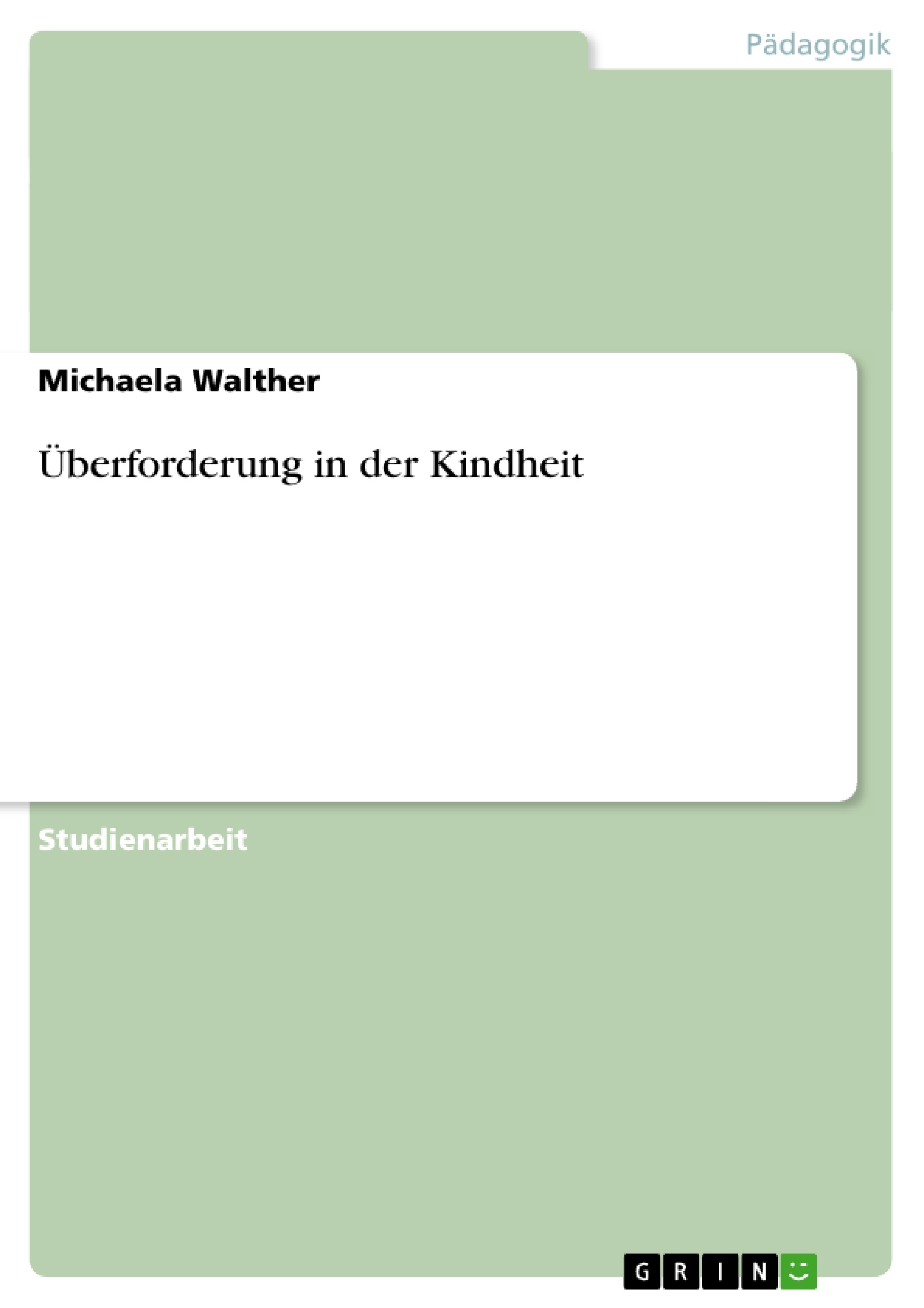

Kommentare